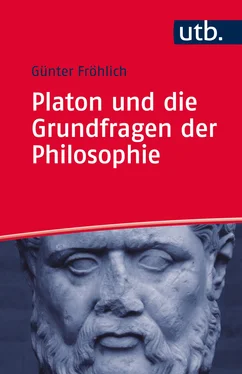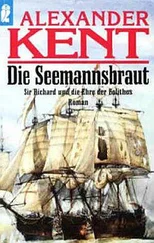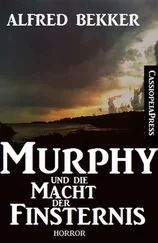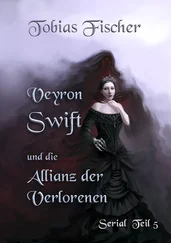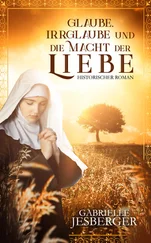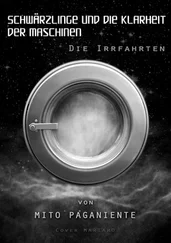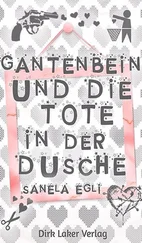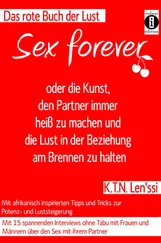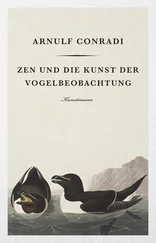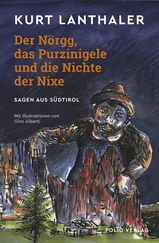Günter Fröhlich - Platon und die Grundfragen der Philosophie
Здесь есть возможность читать онлайн «Günter Fröhlich - Platon und die Grundfragen der Philosophie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Platon und die Grundfragen der Philosophie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Platon und die Grundfragen der Philosophie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Platon und die Grundfragen der Philosophie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Günther Fröhlich stellt die wichtigsten platonischen Grundfragen vor und zeigt in seiner Einführung in die platonische Philosophie deren Relevanz für heutige philosophische Fragestellungen.
Platon und die Grundfragen der Philosophie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Platon und die Grundfragen der Philosophie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
4Der logos umschreibt im Griechischen all unsere intellektuellen Fähigkeiten (Verstand, Vernunft, Bildung von Sinneinheiten) und ist somit auch die Voraussetzung für die Sprache.
5Der Protagoras scheint in der Rahmenhandlung sogar die Hauptaussage Platons in diesem Dialog zu verbergen (vgl. Fröhlich 2004).
6Zur Konstruktion der Rahmenhandlungen bei Platon vgl. auch Wieland 1996, 11.
7Rowe verwendet dafür das griffige Bild von einer Art asymptotischen Annäherung an die Wahrheit (vgl Rowe 1998, 176, 187, 197). Bei der genuin ethischen Ausrichtung des Philosophierens bei Platon greift die mathematische Metapher allerdings zu kurz: Der Mensch soll seine Entscheidungen rechtfertigen, d. h. die Wahrheit seiner Anschauungen hat sich in der Lebenswelt zu erfüllen, auch wenn wir gleichzeitig immer überzeugt sein sollten, dass diese revidiert werden können. In diesem Sinne sehr viel adäquater erscheint mir die Konzeption von Detel 2006, 149. Vgl. zum Begriff der Wahrheit bei Platon Szaif 1996.
8Vgl. hierzu auch Kobusch 1996, 59, 62; sowie Borsche 1996, 96.
9Vgl. für eine Diskussion dieser These in den Nomoi vor allem Horn 2004.
10Zur Ambivalenz sokratischer Definitionen vgl. Wieland 1996, 12 f.; vgl. auch Bordt 2004, 55–73.
11Manchmal wird angenommen, der literarische Sokrates entferne sich inhaltlich immer mehr von der historischen Figur, je später die Dialoge Platons zu datieren sind (vgl. z. B. Penner 1992). Wenn der Schwerpunkt aber nicht auf Lehrmeinungen – die wir bei Platon ohnehin nur schwer identifizieren können – oder auf der Differenziertheit der Argumente liegt, und es uns mehr um die Haltung zur Philosophie von Sokrates geht, wird der frühe und der späte Sokrates bei Platon eher große Ähnlichkeiten aufweisen.
12Sehr viel Erhellendes zum Begriff der Wahrheit (aletheia) bei Platon bringt Szaif (Szaif 2004); allerdings weist er nur unzureichend auf den für Platon zentralen Aspekt des Strebens nach der Wahrheit hin: Für Platon gibt es keinen „Zustand der vollen Einsicht“ (ebd., 195; vgl. auch ebd., 202).
13Die Bedeutung dieser Umbrüche für die ethischen Begriffe erläutert Stemmer 1992, 4–12.
2. Die Hebammenkunst des Sokrates
Das philosophische Wissen kreist um die wichtigen Fragen, wie wir unser Leben führen wollen. Es soll uns Orientierung geben. Doch sicheres Wissen für alle Wechselfälle des Lebens kann es natürlicherweise nicht geben. Philosophisches Wissen kann also kein positives Wissen sein, das auf eine Frage eine eindeutige Antwort gibt. Sokrates bestreitet für sich auch jedes positive Wissen. Er behauptet allerdings, ein philosophisches Unterscheidungswissen zu haben, das ihn erstens befähigt, bei von anderen geäußerten Meinungen gleich zu sehen, ob es sich dabei um etwas Sinnvolles handelt, und zweitens beherrscht er eine Methode, wie die Meinung überprüft und begründet werden kann. Dadurch verhilft er anderen zu einem Wissen, das er selbst nicht hat.
2.1 Hervorbringen von Wissen (Theaitetos 148e–151d)
Was ist Erkenntnis (vgl. Theaitetos 145e)? Sokrates konfrontiert im gleichnamigen Dialog Platons mit dieser Frage den jungen Mathematiker Theaitet. Theodoros, ein Freund des Sokrates, hatte seinen Schüler wegen seiner vielen Kenntnisse und seiner Geschicklichkeit im Antworten sehr gelobt. Theaitet solle gerade so antworten, wie er kurz zuvor über ein mathematisches Problem geurteilt hatte.
Gar oft habe er, Theaitet, über die Frage, was denn Erkenntnis sei, nachgedacht, doch sei er bis jetzt noch nicht zu einer schlüssigen Antwort durchgedrungen. Allerdings sei er an dieser Frage genauso interessiert wie an den anderen Fragen, von denen er gehört hatte, dass Sokrates mit ihnen ständig die Leute belästigt, so sehr, dass er selbst vom Nachsinnen darüber nicht ablassen kann.
Daraufhin sagt Sokrates etwas Sonderbares: „Du hast Geburtsschmerzen, weil du schwanger bist, Theaitet“. Dazu fällt dem Jüngeren nicht viel ein. Sokrates führt aus, dass er der Sohn einer berühmten Hebamme sei und dass er die Hebammentätigkeit auch selbst ausübe. Ob er davon nicht schon gehört habe? Theaitet antwortet, dass das erste ihm bekannt sei, dass aber Sokrates selbst eine Hebamme ist, sei ihm bis dahin noch nicht zu Ohren gekommen.
Gewiss, das ist auch keine stadtbekannte Sache, und Theaitet solle es auch bloß nicht überall herum erzählen. Die Leute denken ohnehin schon, dass Sokrates ein komischer Kauz sei, der den ganzen Tag nur herumgeht und die Menschen ins Zweifeln über ihre Ansichten und Meinungen stürzt.
Theaitet solle doch einmal überlegen, was eine Hebamme im Wesentlichen ausmacht. Diese, so Sokrates, könne erstens selbst nicht mehr gebären, anderen aber sei sie darin behilflich. Hebammen haben darüber hinaus aber auch eine Reihe von Kenntnissen und Fähigkeiten. Sie sehen sofort, wenn eine Frau schwanger ist. Des Weiteren wüssten sie Zaubermittel und Wundersprüche, mit denen sie die Wehen beschleunigen oder verlangsamen können. Ebenso führen sie Abtreibungen durch. Außerdem sind sie zuweilen als Ehestifterinnen tätig, wobei sie genau wüssten, wer mit wem zusammen passt, damit gesunde Kinder dabei entstehen. Doch üben sie diese Tätigkeit selten aus, da sie nicht in den Verdacht der Kuppelei kommen wollen. Daneben gibt es offenbar einige Hebammen, die den Kindern auch gleich ansehen, ob etwas Rechtes aus diesen werden kann oder nicht, ob es sich um ein richtiges Kind oder nur um etwas Kindähnliches (Schleiermacher übersetzt das mit „Mondkalb“) handelt.
Dies alles gilt nun auch für ihn selbst, behauptet Sokrates, nur mit den Unterschieden, dass er erstens Männern Hebammendienste leistet; zweitens für die Seelen und nicht für die Körper Sorge trägt; drittens entsprechend unterscheiden kann, ob etwas Rechtes aus der Seele kommt oder eben nur ein Trugbild; und dass er dagegen viertens selbst in diesem Sinn nicht mehr „gebären“ kann.
Das letztere interpretiert Sokrates so, dass er seine Mitmenschen immerzu fragt, selbst aber nichts weiß oder antwortet, das Wissen, nach dem er fragt, also nicht hat. Das hat man ihm nicht selten, und wie er meint, schon mit Recht vorgeworfen. Die Ursache aber liegt darin, dass er selbst kein Wissen erzeugen kann oder schon in sich hätte. Aber Geburtshilfe für Erkenntnis bei anderen, das kann er leisten. Er ist also gar nicht weise und aus seiner Seele geht nichts hervor.
Es geschieht aber mit denen, die häufig mit ihm zusammen sind, dass sie auf einmal Wissen aus sich heraus hervorbringen, obwohl das zunächst gar nicht so aussah. Von ihm können sie das nicht haben, denn er weiß ja nichts. Das kommt also schon alles aus ihnen selbst. Er aber und der Gott Apoll leisten eben die Geburtshilfe für die Erkenntnisse. Jene aber, die zu ihm kommen, haben oft schon Geburtsschmerzen, und er kann sie dann verstärken oder lindern, gerade wie er es für notwendig hält.
Manche, die mit ihm umgehen und sich von ihm nicht recht helfen lassen, verlassen ihn entweder vorzeitig oder sie verlieren durch Verwahrlosung, was eigentlich etwas Rechtes hätte werden können. Mit den Missgeburten gehen sie dann hausieren und merken nicht einmal, was sie da mit sich herumtragen. Manchmal lässt er sich überreden, die „Geburten“ wieder aufzupäppeln, manchmal dagegen verbietet es ihm der Gott. Aber auch zum „Kuppeln“ taugt die Kunst des Sokrates. Wenn er nämlich merkt, dass einer, der zu ihm gekommen ist, seine Hilfe gar nicht braucht, dann weiß er, zu wem er ihn schicken muss, damit ihm dort geholfen werden kann.
Auch Theaitet kommt offenbar zu Sokrates, weil ihm etwas in der Seele herumgeht, bei dem er sich selbst nicht helfen kann. Das war der Sinn der Aussage, als er gemeint hatte, dass Theaitet Geburtsschmerzen habe und schwanger sei. Er, Sokrates, versteht aber die Kunst, ihm zu helfen. Doch darf Theaitet nicht böse werden, wenn er im Laufe des Gesprächs irgendetwas Unrechtes oder ein Trugbild hervorbringt und Sokrates das dann ablöst und wegwirft. Er macht das nur aus Wohlwollen gegen ihn, wenn er erkennt, dass dieser Unsinn geredet hat, aus dem keine Erkenntnis kommt. Manche sind deswegen auf ihn schon sehr böse geworden, wenn er ihnen ihr Geschwätz erst abgenommen und dann weggeworfen hat, ähnlich wie die Frauen, die, wenn sie eine Missgeburt haben, nicht glauben können, dass nicht die Hebamme Schuld daran trägt. Er will niemandem Übles und steht ja auch mit dem Gott im Bunde, er darf deswegen aber auch nichts „Falsches gelten lassen und Wahres unterschlagen“ (Theaitetos 151d).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Platon und die Grundfragen der Philosophie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Platon und die Grundfragen der Philosophie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Platon und die Grundfragen der Philosophie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.