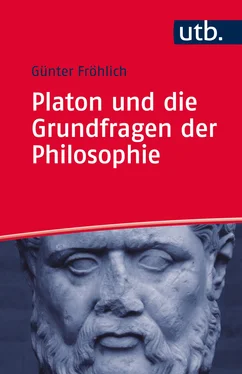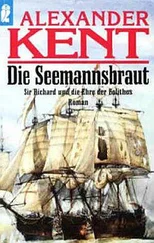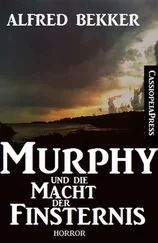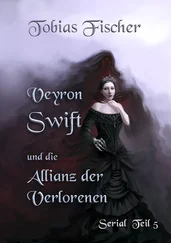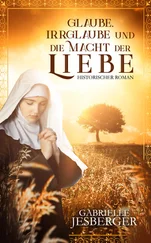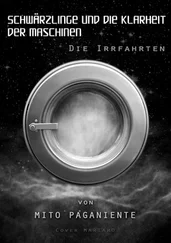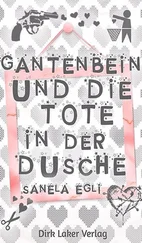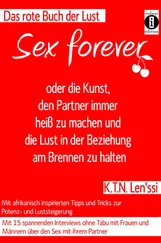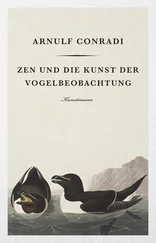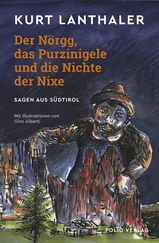Günter Fröhlich - Platon und die Grundfragen der Philosophie
Здесь есть возможность читать онлайн «Günter Fröhlich - Platon und die Grundfragen der Philosophie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Platon und die Grundfragen der Philosophie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Platon und die Grundfragen der Philosophie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Platon und die Grundfragen der Philosophie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Günther Fröhlich stellt die wichtigsten platonischen Grundfragen vor und zeigt in seiner Einführung in die platonische Philosophie deren Relevanz für heutige philosophische Fragestellungen.
Platon und die Grundfragen der Philosophie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Platon und die Grundfragen der Philosophie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1.4 Platons Leben und Werk
Über Platon selbst und sein Leben wissen wir nicht sehr viel Gesichertes. Er lebte in Athen im fünften und vierten Jahrhundert v.Chr., wohl etwa von 427 bis 347 v.Chr., entstammte dem athenischen Hochadel – Sokrates war der Sohn eines Handwerkers – und seine Lebensbestimmung war es sicher, in die Politik zu gehen. Von dieser war Platon tief enttäuscht, was nicht zuletzt an den damaligen politischen Verhältnissen lag. Athen stand in einem fast dreißig Jahre dauernden Krieg mit Sparta, durch dessen Verlauf und der Niederlage es seine politische Vormachtstellung in Griechenland, welche die fünfzig Jahre davor bestand, einbüßte. Eine große Zahl der Bürger war in einem halsbrecherischen Unternehmen in Sizilien, das die Athener erobern wollten, gefallen, die Pest und der lange Kriegsverlauf hatte die Bevölkerung weiter dezimiert.
Die Schuld daran gab man der athenischen Verfassung – einer Demokratie mit fast schon extrem anmutenden plebiszitären Elementen, und den populistischen Agitatoren, die nur ihren eigenen Vorteil im Sinn hatten. Die Folgen des Krieges führten in Athen zum blanken Terror, an der Spitze des Staats wie auf den Straßen. Persönlich war für Platon weiter einschneidend, dass man den „trefflichsten, und auch sonst vernünftigsten und gerechtesten Mann“ (Phaidon 118a), Sokrates nämlich, hingerichtet hatte. Die Legende besagt, dass sich Platon zuvor mit dem Verfassen von Komödien und Tragödien beschäftigt hatte, daraufhin aber all diese Texte verbrannte, und anschließend nur noch philosophische Dialoge schrieb.
Platon hatte wohl schon länger Verbindungen zu den Pythagoreern in Süditalien und damit auch zum Herrscherhaus in Syrakus. Dionysius holte für eine Staatsreform eine ganze Reihe renommierter Theoretiker aus dem ganzen Mittelmeerraum nach Sizilien. Platon allerdings bekam Schwierigkeiten mit ihm und wurde daraufhin in die Sklaverei verkauft, woraus er von seiner Familie wieder freigekauft werden musste. Im Alter von etwa 40 Jahren gründete er im Hain des Akademos eine Schule, die „Akademie“ genannt wurde. Der Schulbetrieb wurde zwar nicht tausend Jahre immer am selben Ort aufrecht erhalten, dennoch ließ erst der römische Kaiser Justinian per Edikt von 529 den Lehrbetrieb endgültig einstellen. Platon reiste zwanzig Jahre nach seinem ersten Scheitern ein zweites Mal nach Syrakus. Er hatte sich nämlich während des ersten Besuchs mit Dion, dem jüngeren Schwager von Dionysius, angefreundet. Aber auch dieser Versuch, auf die politischen Verhältnisse einzuwirken, scheiterte ebenso wie ein dritter einige Jahre später.
Von Platon ist alles, was er veröffentlicht hat, erhalten. Es gibt in der antiken Literatur keinen Hinweis auf eine Stelle, die wir nicht kennen. Allerdings stammen nicht alle der 43 Werke, die unter seinem Namen überliefert sind, auch aus seiner Feder. Bei einigen wird immer noch über deren Echtheit diskutiert. Von denen, die als „unecht“ eingestuft werden, stammen die meisten jedoch aus seinem Umfeld oder dem der Akademie. Die genaue Datierung der Texte ist ein ungelöstes philologisches Problem. Wir unterscheiden aber zwischen frühen, mittleren und späten Dialogen. Weil uns Platon keine Abhandlungen liefert, aus denen wir ersehen könnten, welche Gedanken auf welchen aufbauen, wird eine genaue Reihenfolge auch niemals mit Sicherheit erstellt werden können. Seine wichtigsten Werke sind wohl Gorgias, die Politeia, der Phaidon, der Theaität, der Phaidros, das Symposion und der Timaios.
1.5 Die Dialogform
Die Dialogform ist eine eigene literarisch-philosophische Gattung, die von mehreren Schülern des Sokrates verwendet wurde, auch in der zweiten Generation z. B. von Aristoteles. Bis auf das Werk Platons ist aber fast alles verloren gegangen. Die Kunstfertigkeit, mit der er seine sokratischen Gespräche niederschrieb, scheint so dominant gewesen zu sein, dass man sich nicht die Mühe machte, die anderen Autoren abzuschreiben und damit zu tradieren.
Platon schreibt Gespräche nieder. Die Ausnahme bilden die drei Monologe der sokratischen Verteidigung. Es ist freilich klar, dass die Gespräche niemals so stattgefunden haben. Der Dialog ist eine bewusst gewählte Kunstform. Die philosophischen Inhalte, einschließlich der Meinung des Autors, werden nicht direkt abgehandelt, sondern in einem wechselseitigen Gespräch versteckt, in dem zumeist Sokrates die Hauptrolle spielt. Einige von ihnen werden auch erzählt: etwa direkt von Sokrates, wie die Politeia, oder manchmal in eine Art Rahmenhandlung eingebettet, wie z. B. der Protagoras. 5Der Parmenides wird von Kephalos erzählt, der sich von Antiphon berichten ließ, weil der wiederum jemanden kannte, der bei dem Gespräch dabei gewesen war. Das Gespräch selbst fand vor langer Zeit statt, und Antiphon, nachdem es ihm erzählt wurde, beschäftigte sich seitdem ausschließlich mit der Pferdezucht. Er weigert sich zuerst auch, davon zu berichten, weil die Gegenstände des Gesprächs zu schwierig sind. Diese mehrfachen Brüche in der Überlieferung sind von Platon so konstruiert, dass das Gespräch und seine Inhalte somit zweifelsohne unter Vorbehalt stehen. Dagegen will Platon die besondere Authentizität des Theaitetos dadurch untermauern, dass er seinen Erzähler nicht nur in unmittelbarer Rede und Gegenrede einen schriftlichen Text zum Gespräch vorlesen lässt, sondern vorgibt, der Berichterstatter Eukleides hätte sich bei Sokrates persönlich über den Argumentationsverlauf mehrmals rückversichert. 6
Nun könnte man sich Gespräche denken, welche nach und nach unter den Beteiligten eine Übereinkunft und damit eine Lösung des besprochenen Problems erzielen. Solche Gespräche gibt es jedoch bei Platon nicht. Der lebendige Eindruck der Dialoge entsteht dadurch, dass sich die Fragen und Teilantworten, die immer wieder hinterfragt werden, abwechseln, und an deren Ende kein einfaches Ergebnis präsentiert wird. Oft sagt Sokrates dann, dass man im Verständnis nicht recht weitergekommen sei und sich die Frage noch einmal ganz von vorne vornehmen sollte. Das pädagogische Programm Platons besteht offenbar darin, dass der Leser weiter über die Fragen nachdenken und diese mit anderen diskutieren soll.
1.6 Die Wahrheitssuche
Wir werden noch deutlich sehen, wie grundsätzlich Platon darauf verzichtet, Wissen als einfach Gegebenes und unmittelbar Verständliches, als Information würden wir heute sagen, aufzufassen (vgl. Martens 2006, 68). Was gewusst wird, ist abhängig von dem, der die Erkenntnis hat, in der Vermittlung aber noch viel mehr von demjenigen, dem diese mitgeteilt werden soll. Im Protagoras findet sich ein schöner Vergleich hierzu: Wenn wir auf den Markt gehen und Waren einkaufen, können wir diese in Gefäßen nach Hause tragen und dort von Sachkundigen überprüfen lassen. Kenntnisse aber nehmen wir unmittelbar in unserer Seele auf. Sie verknüpfen sich dort mit dem, was wir schon wissen. Ob das genießbar ist, können wir unabhängig von uns nicht überprüfen lassen. Den Nutzen oder Schaden, der die Aufnahme der Kenntnisse mit sich bringt, haben wir dann schon weg. Es hängt damit von unserem Vorwissen ab, wie wir die neuen Kenntnisse auffassen und was wir mit diesen anfangen können, damit wir beurteilen können, ob diese uns nutzen oder schaden.
Da die Philosophie mündlich mit Sokrates, schriftlich mit Platon für uns beginnt, gehört es zu ihren Grundstatuten, Fragen zu stellen; die Antworten aber, wo sie möglich sind und gegeben werden, stehen immer unter dem Vorbehalt weiteren Nachdenkens. Das ist manchmal bitter und trägt sicher nicht zuletzt dazu bei, dass die Philosophie als unpraktisch gilt. Im Leben müssen wir handeln, auch wenn unsere Handlungen, philosophisch betrachtet, auf unsicherem Boden stehen. Das liegt daran, dass wir die Zukunft nicht kennen, dass wir unser Wissen nicht bis zu einem evidenten Grund ausweisen können, und dass wir die Grundlagen der philosophischen Reflexion, über diese Unsicherheiten nachzudenken, uns auch erst erarbeiten müssen. Das Nachdenken kann abgebrochen werden, es kann sich aber nie erschöpfen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Platon und die Grundfragen der Philosophie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Platon und die Grundfragen der Philosophie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Platon und die Grundfragen der Philosophie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.