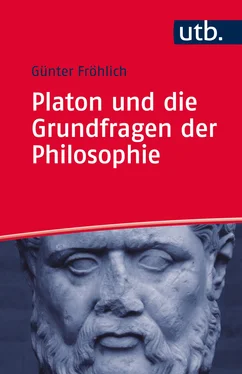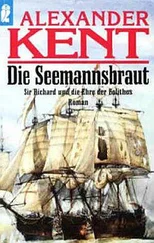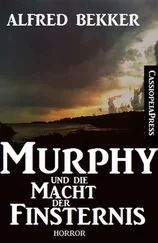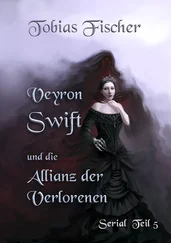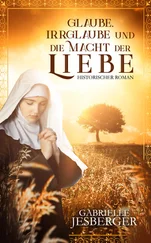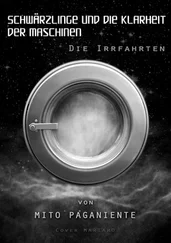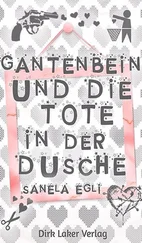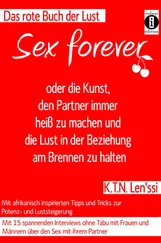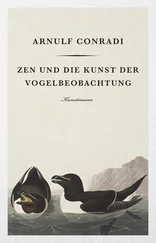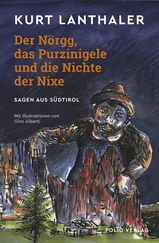Günter Fröhlich - Platon und die Grundfragen der Philosophie
Здесь есть возможность читать онлайн «Günter Fröhlich - Platon und die Grundfragen der Philosophie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Platon und die Grundfragen der Philosophie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Platon und die Grundfragen der Philosophie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Platon und die Grundfragen der Philosophie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Günther Fröhlich stellt die wichtigsten platonischen Grundfragen vor und zeigt in seiner Einführung in die platonische Philosophie deren Relevanz für heutige philosophische Fragestellungen.
Platon und die Grundfragen der Philosophie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Platon und die Grundfragen der Philosophie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2.4 Das philosophische Fragen
Dass heute, also nach zweieinhalbtausend Jahren, immer noch philosophiert wird, heißt offenbar, dass uns die Fragen der Philosophie nicht loslassen. Die Philosophie ist die erste aller Wissenschaften, d. h., sie ist der Ursprung des methodisch reflektierten Nachdenkens. Ihre Anfänge liegen zwar im Dunkeln, diese haben aber wohl mit der Entstehung des Menschen selbst zu tun. Die Krone des historischen Ursprungs des methodischen Untersuchens kann ihr allenfalls die Medizin streitig machen. Doch die antike Medizin ist eine andere als die heutige. Das gilt zwar auch für die Philosophie, aber ihre Fragen sind in vielerlei Hinsicht immer noch dieselben. Manche Ärzte behaupten sogar heute noch, die Medizin sei noch gar keine Wissenschaft – aber das ist eine ganz eigene Frage.
Die Rechtswissenschaft haben die Römer erfunden. Es gab zwar vorher auch schon Regeln des sozialen Zusammenlebens und der staatlichen Ordnung und Praxis, aber diese entstanden eher aus Traditionen purer Überlebens-Notwendigkeit, und wurden erst durch die philosophische Frage nach der Gerechtigkeit methodisch systematisiert; für die Römer war wichtig, wie ein Gesetz zustande kommt und wie und von wem es beschlossen und bekannt gemacht wurde; die Rechtsfindung und Rechtsanwendung wurde ebenso Regeln und – ganz entscheidend – einem Prozess unterworfen; dazu bildete sich im ersten vorchristlichen Jahrhundert eine Gruppe von Fachleuten für Rechtsfragen heraus; und schließlich kam es zur Kodifizierung. Die Theologie ist als Wissenschaft freilich etwas Vieldeutiges, in alter Zeit ist sie von Dichtung oder Philosophie nicht zu unterscheiden – das Fragen über die menschlichen Grundfragen nach Erkenntnis und dem rechten Tun geht auch aus der Dichtung hervor.
Die Medizin sowie die Lehre von den Rechten und die Theologie sind an den heutigen Universitäten seit dem Mittelalter erhalten geblieben; aus der Philosophie sind alle anderen Fächer herausgebrochen: die Naturwissenschaften – Galilei oder Newton verstanden sich noch als Naturphilosophen –, die Ökonomie – nämlich aus der Moralphilosophie – und zuletzt die Psychologie – als empirische Frage nach dem Wahrnehmen, Denken und Fühlen. Alles, was sich als empirische Fragestellung formulieren lässt, hat sich von der Philosophie emanzipiert.
Es herrscht also ein Spannungsverhältnis zwischen den empirischen Fragen und den Fragen und Antworten in der Philosophie. Dieser wirft man vor, sie arbeite nicht einmal empirisch. Dabei sei doch inzwischen erwiesen, dass die Welt anders aussehen kann, als man auf den ersten Blick vermutet. Dazu muss man aber die empirische Wirklichkeit erst einmal zur Kenntnis nehmen und hinsehen, während die Philosophie glaubt, ihre Erkenntnisse durch bloßes Nachdenken sichern zu können.
Dieser Einwand vergisst, dass empirisches Arbeiten nicht einfach so beginnen kann. Manche meinen, empirische Fragestellungen lägen auf der Straße, man brauche sie nur aufzuheben, experimentell zu überprüfen und die gewonnenen Daten lieferten einem für sich schon die Antwort. Dass man ein Erkenntnisinteresse hat, also ein Ziel formuliert, das einen gerade interessiert, für sich selbst als Grundlage oder für eine bestimmte Anwendung, dass man darauf hin eine Fragestellung entwirft, diese methodisch – zumeist mathematisch – absichert, ein Experiment ersinnt, Messverfahren durchführt und die gewonnenen Daten dann interpretieren muss, scheint vielen nicht bewusst zu sein. Jeder dieser Schritte enthält zudem Spielräume. Eine Veränderung der Voraussetzungen, z. B. in der Forschungsfrage, führt immer auch zu einem anderen Ergebnis. Vor allem die Messverfahren und die Datendeutung werden vielfach methodisch nicht auf das Ergebnis hin reflektiert.
Die Philosophie ist die Reflexionsinstanz, Methoden der Erkenntnisgewinnung zu hinterfragen und zu kritisieren. Das kann gar nicht empirisch erfolgen, weil die Reflexion sonst Teil der kritisierten Methode wäre. Wo aber, so kann man fragen, liegt dieses kritische Potential? Was ist das für eine kritische Instanz?
Ähnliches gilt auch für die anderen philosophischen Disziplinen, z. B. die Ethik. Auch diese will zuletzt nicht für sich beanspruchen, letztgültige Antworten auf die Fragen der Lebensführung zu finden, um damit den Anspruch zu erheben, dass der einzelne damit alles gut und richtig macht. Auch sie versteht sich in erster Linie als Reflexionsinstanz, die Methoden eruiert, wie man unter geregelten und vermittelbaren Bedingungen über solche Fragen nachdenkt, um dann mögliche Ergebnisse gegeneinander abzuwägen. Dass die Philosophie nur Fragen stellt und keine Antworten gibt, stimmt freilich nicht. Die philosophische Tradition bietet eine Fülle von unterschiedlichen Antworten. Diese werden aber immer wieder hinterfragt. Man kann sogar sagen, dass die Philosophie die Einrichtung ist, welche die Grundfragen des Menschen und des Lebens für jede Zeit immer wieder neu stellt.
Die Philosophie ist damit eine Wissenschaft, die seit zweieinhalbtausend Jahren immer dieselben Fragen stellt und sich bei den Antworten nicht einig wird. Ihr kommt es aber auch gar nicht darauf an, sich zu einigen. Außerdem weisen ihre methodischen Reflexionen mit den Inhalten zuweilen nur noch eine lose Verbindung auf.
Platon betont dieses dynamische Verhältnis zur Philosophie (vgl. Erler 2006, 63) immer wieder. Offenbar nimmt er aber auch an, dass der mühsame Weg ein Ende finden kann: Nach unserer Stelle im Theaitetos besteht dem Sinn nach immerhin die Möglichkeit, dass Sokrates etwas bestehen lässt, etwas, das dem Blick der sokratischen Seelenhebamme standhält. In der Politeia wird der vollkommene Philosoph und „wahrhaft Lernbegierige“ ebenso als jemand geschildert, der
„so geartet ist, sich um das Seiende zu beeifern, und also nicht bleiben kann bei dem vielen als seiend vorgestellten Einzelnen, sondern weitergehen wird, ohne sich verblenden zu lassen, und nicht eher Befriedigung finden für seine Liebe, bis er die Natur von jedem selbst, was ist, aufgefaßt hat, mit demjenigen in der Seele, womit es geziemt dergleichen zu fassen – es ziemt aber mit dem Verwandten; womit also dem wahrhaft Seienden sich nähernd und sich damit vermischend, und so Vernunft und Wahrheit erzeugend, er erkennen wird und wahrhaft leben und sich nähren und so seiner Schmerzen Ende finden, eher aber nicht“ (Politeia VI 490ab). 14
Es ist schwierig bei Platon zu beurteilen, ob er damit eine Hoffnung verbindet oder ob er überzeugt ist, dass sich das Ziel erreichen lässt. Dieser Doppelgestalt der Philosophie gibt Platon immer wieder Ausdruck. Vor allem hat er ihren Begriff ganz neu verortet (vgl. Erler 2006, 68 f.). Die philologische Bedeutung der Wortverbindung von phileo und sophos bedeutet ursprünglich, dass man mit einem Wissensinhalt vertraut ist, weil man häufig mit diesem Umgang hatte, so wie jemand sich mit Pferden auskennt, wenn er viel mit den Tieren zusammenkommt, und dann ein phil-hippos genannt werden kann. Der häufige Umgang mit Wissen der höchsten und geistigen Art, das der Lebensführung dient, und das von den „Weisen“ gelehrt wird, macht nach Platon seinen Träger allerdings gerade nicht zum Philosophen, sondern zum sophos und Sophisten. Denn in den Gegenständen, um welche es Sokrates und Platon geht, gibt es eben kein positives Wissen, das als solches vorhanden ist und weiter gegeben werden kann.
Von „vertraut sein mit“ ändert sich das phileo bei Platon in ein „Streben nach“, in ein „Freund sein von“. Das bedeutet, dass der Philosoph das Wissen nicht hat, sondern danach strebt. Die Doppelnatur der Philosophie beschreibt Platon auch im Symposium. Dort wird die Philosophie mit der Liebe identifiziert, näherhin mit dem eros, was für den Liebesgott und für sein Prinzip steht, dem Streben nach dem Schönen, dessen Best-form die Weisheit ist. Der Eros nämlich sei ein Sohn von Poros, dem Weg, und Penia, der Armut. So bleibt die Philosophie arm, „rauh, unansehnlich, unbeschuht, ohne Behausung, auf dem Boden immer herumliegend und unverdeckt schläft [sie] vor den Türen und auf den Straßen im Freien“ (Symposion 203cd). Da aber auch das väterliche Erbe durchschlägt, ist Eros gleichzeitig „tapfer, keck und rüstig, ein gewaltiger Jäger, allezeit irgendwelche Ränke schmiedend, nach Einsicht strebend, sinnreich, sein ganzes Leben lang philosophierend, ein arger Zauberer, Giftmischer und Sophist“ (ebd. 203d). 15Was die Philosophie sich damit verschafft, zerrinnt ihr aber gleich wieder. Und dieses Wesen überträgt sich auch auf den philosophischen Umgang mit den Menschen. Die Leute mögen es nicht, wenn ihre Vorstellungen als Missgeburt weggeworfen werden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Platon und die Grundfragen der Philosophie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Platon und die Grundfragen der Philosophie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Platon und die Grundfragen der Philosophie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.