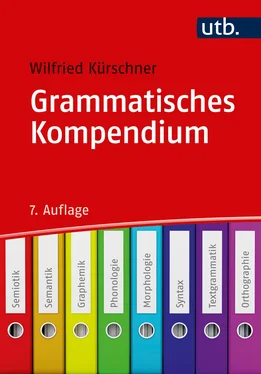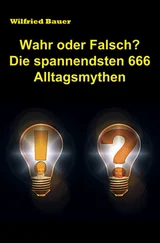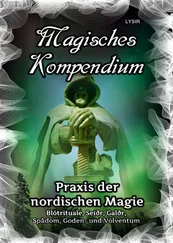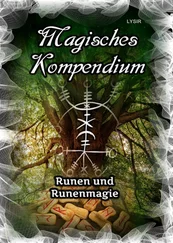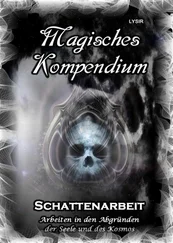Ausdehnung des Bedeutungsumfanges eines ZeichenZeichens; GeneralisierungGeneralisierung.
Beispiel:
mhdMittelhochdeutsch. frouwe ‘Dame von Adel’ > nhdNeuhochdeutsch. Frau ‘weibliche Person’ (zu den Abkürzungen und zur hier zugrundegelegten Einteilung der deutschen Sprachgeschichte ▶ Beginn des Abschnitts 4 . 3)
2.4/4 BedeutungsverengungVerengungBedeutungs-Bedeutungsverengung
Einengung des Bedeutungsumfanges eines ZeichenZeichens; SpezialisierungSpezialisierung.
Beispiele:
ahdAlthochdeutsch./mhdMittelhochdeutsch. varn ‘sich fortbewegen’ > nhdNeuhochdeutsch. fahren ‘sich mithilfe einer antreibenden Kraft fortbewegen’
mhdMittelhochdeutsch. frum ‘tüchtig, nützlich, gottgefällig’ > nhdNeuhochdeutsch. fromm ‘gottgefällig’
2.4/5 BedeutungsverbesserungVerbesserungBedeutungs-Bedeutungsverbesserung
BedeutungswandelBedeutungswandel mit AufwertungAufwertung.
Beispiel:
ahdAlthochdeutsch. marahscalc ‘Pferdeknecht’ > mhdMittelhochdeutsch. marschalc ‘höfischer oder städtischer Beamter mit bestimmten Aufgaben’ > nhdNeuhochdeutsch. Marschall ‘Träger des höchsten Militärranges’
2.4/6 BedeutungsverschlechterungVerschlechterungBedeutungs-Bedeutungsverschlechterung
BedeutungswandelBedeutungswandel mit AbwertungAbwertung.
Beispiele:
mhdMittelhochdeutsch. wîp ‘Frau’ > nhdNeuhochdeutsch. Weib ‘abwertende Bezeichnung für Frau’
mhdMittelhochdeutsch. Knecht ‘Knabe, junger Mann’ > nhdNeuhochdeutsch. Knecht ‘Diener’
2.4/7 BedeutungsverschiebungVerschiebungBedeutungs-Bedeutungsverschiebung
BedeutungswandelBedeutungswandel mit Austausch von Bedeutungen.
Hauptfälle (nach Schweikle 1996, S. 248 f.):
vom Besonderen zum Allgemeinen, z. B.:mhdMittelhochdeutsch. hövesch/hübesch ‘hofgemäß, gebildet, gesittet’ > nhdNeuhochdeutsch. hübsch ‘angenehm, gefällig im Äußeren’
vom Allgemeinen zum Besonderen, z. B.:mhdMittelhochdeutsch. berillus/berille ‘Beryll (Halbedelstein, aus dem Brillen hergestellt wurden)’ > nhdNeuhochdeutsch. Brille
vom Konkreten zum Abstrakten (oft metaphorischeMetapher Verwendung), z. B.:mhdMittelhochdeutsch. sweric/swiric ‘voll Schwären, eitrig’ > nhd. schwierig mhdMittelhochdeutsch. zwec ‘Nagel aus Holz oder Eisen’ , seit dem 15. Jh.: ‘Nagel, an dem eine Zielscheibe aufgehängt ist’ , dann: ‘das Ziel selbst’ > nhd. Zweck
vom Abstrakten zum Konkreten, z. B.:mhdMittelhochdeutsch. sache ‘Rechtsgegenstand’ > nhd. Sache (jeder konkrete Gegenstand)
3 GraphemikGraphemik: Lehre von der SchreibungSchreibung
3.1 ExistenzweiseExistenzweisen der Sprache
3.1/1 Geschriebene SpracheSprachegeschriebenegeschriebene Sprache und gesprochene SpracheSprachegesprochenegesprochene Sprache – GraphieGraphie und PhoniePhonie – GraphemikGraphemik und PhonologiePhonologie:
Sprachen wie das Deutsche werden auf zweierlei Weise verwendet: als geschriebene Sprachegeschriebene Sprache und als gesprochene Sprachegesprochene Sprache (= ExistenzweisenExistenzweise der Sprache). Der Terminus SchreibungSchreibung = GraphieGraphie bezieht sich auf die AusdrucksseiteAusdrucksseite der ZeichenZeichen in geschriebener Sprache, der Terminus LautungLautung = PhoniePhonie auf die AusdrucksseiteAusdrucksseite der ZeichenZeichen in gesprochener Sprache. Mit der Graphie befasst sich die grammatische Teildisziplin GraphemikGraphemik, mit der Phonie die grammatische Teildisziplin PhonologiePhonologie. Normgerechtes Schreiben ( RechtschreibungRechtschreibungOrthographie) ist Gegenstand der OrthographieOrthographieRechtschreibung.
Wissenschaftsgeschichtlich gesehen älter als die Graphemik ist die PhonologiePhonologie = LautlehreLautlehre. Beim Einsetzen einer eigenen SchreiblehreSchreiblehreBuchstabe/BuchstabenlehreBuchstabenlehre war der Terminus »GraphologieGraphologie« schon vergeben (‘Lehre von der Deutung der HandschriftHandschrift als Ausdruck des Charakters’). Daher steht für die Lehre von der SchreibungSchreibung = von der GraphieGraphie kein Terminus zur Verfügung, der formal parallel zum Terminus »PhonologiePhonologie« gebaut wäre (der Vorschlag »GrapheologieGrapheologie« hat sich nicht durchgesetzt). Wir verwenden hier »GraphemikGraphemik« als Allgemeinterminus (‘Lehre von der Verschriftung von Sprache und von den Schreibsystemen’). Der Terminus »GraphemikGraphemik« wird darüber hinaus auch spezieller verwendet, und zwar als Bezeichnung für die ‘Lehre von den Graphemen’ (▶ Nr. 3.2/2). Er entspricht dann der »PhonemikPhonemik« (‘Lehre von den Phonemen’, ▶ Nr. 4.1/2; »PhonemikPhonemik« ist Unterbegriff zu »PhonologiePhonologie«). Es lassen sich die in ▶ Tabelle 2angeführten terminologische Entsprechungen feststellen:
| PhoniePhonie |
GraphieGraphie |
| PhonologiePhonologie |
Graphemik i. w. S.Graphemik |
| PhonemikPhonemik |
Graphemik i. e. S.Graphemik |
| PhonetikPhonetik |
GraphetikGraphetik |
Tabelle 2: Terminologische Entsprechungen »Phonie« – »Graphie«
(Statt »PhonemikPhonemik« ist auch »PhonematikPhonematik« in Gebrauch, statt »GraphemikGraphemik« auch »GraphematikGraphematik«.) Die PhonetikPhonetik beschäftigt sich als naturwissenschaftlich ausgerichtete Disziplin mit der Lautproduktion, mit den akustischen Abläufen und mit der Lautwahrnehmung. Entsprechend behandelt die GraphetikGraphetik Verschriftungssysteme vor allem unter individuellen, sozialen, historischen und typographischen (die Gestalt der Schriftsymbole betreffenden) Aspekten.
Abweichend von der sonst üblichen Reihenfolge wird hier die GraphemikGraphemik vor der PhonologiePhonologie behandelt, und zwar deshalb, weil die Verfahrensweisen und Begriffsbildungen, die auch in der PhonologiePhonologie zum Tragen kommen (und, wissenschaftshistorisch gesehen, in dieser zuerst entwickelt wurden), erfahrungsgemäß im Bereich der GraphieGraphie anschaulicher eingeführt und dargestellt werden können. Die OrthographieOrthographie umfasst mehr als nur die Ebene der Buchstaben und wird daher in einem eigenen Kapitel (▶ Kap. 9) behandelt.
3.2 Zur Beschreibung der GraphieGraphie
Für die Beschäftigung mit der SchreibungSchreibung (des Deutschen und anderer Sprachen, in denen AlphabetschriftSchriftAlphabet-Alphabetschriften verwendet werden) ist der Begriff BuchstabeBuchstabe zentral. »BuchstabeBuchstabe« wird alltagssprachlich allerdings in (mindestens) zweierlei Sinn gebraucht, wie aus den Antworten auf eine Frage wie »Aus wie vielen Buchstaben besteht (die graphische AusdrucksseiteAusdrucksseite des Wortes) besenrein ?« deutlich wird. Wenn die Antwort »neun« lautet, werden BuchstabenvorkommenVorkommenBuchstaben-Buchstabenvorkommen (b, e, s, e, n, r, e, i, n) gezählt, wenn sie »sechs« lautet, BuchstabentypTypBuchstaben-Buchstabentyp en (b, e, s, n, r, i) . BuchstabenvorkommenBuchstabenvorkommen können jeweils unterschiedliche Formen haben, z. B. a, A, a, a, a; b, b , b, b – sie werden dennoch als zum selben BuchstabentypBuchstabentyp gehörig betrachtet, und zwar deshalb, weil sie jeweils denselben WertWert haben: Gleichgültig, ob ab, Ab, ab, a b , ab , ab, a b , a b… geschrieben wird, immer handelt es sich um die graphische Wiedergabe des ZeichenZeichens ab .
Читать дальше