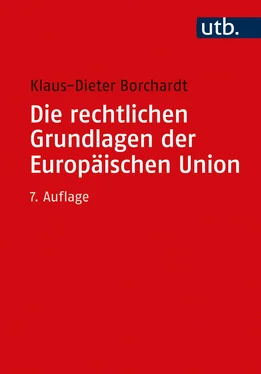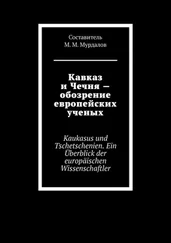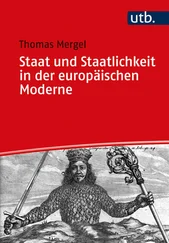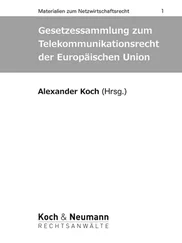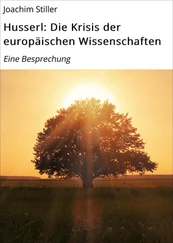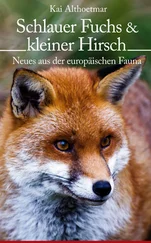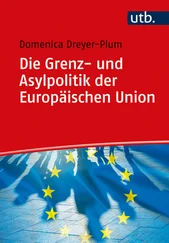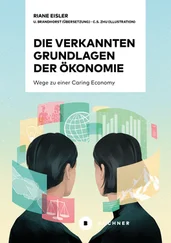Von diesem Grundanliegen sind auch die ursprünglichen Gründungsverträge der EG und die heute geltenden EU-Verträge geprägt. Als oberste Ziele formulieren sie die Wahrung und Festigung des Friedens, die wirtschaftliche Einigung zum Nutzen aller innerhalb der EU lebenden Bürger durch Schaffung eines europäischen Binnenmarktes, das Streben nach politischer Einheit und nicht zuletzt die Stärkung und Förderung des sozialen Zusammenhalts in der Union (vgl. den Zielekatalog in Art. 3 EUV):
I. Die Sicherung des Friedens
[57]Bereits der Schuman-Plan, der zur Gründung der EGKS geführt hat, sah in der deutsch-französischen Aussöhnung nicht nur das Kernstück einer neuen europäischen Ordnung, sondern zielte ausdrücklich auf die Schaffung von Bedingungen ab, die jeden Krieg unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich machen sollten. Dies ist mit der Schaffung zunächst der E(W)G und danach der EU gelungen. Mehr als 70 Jahre Frieden in Europa beweisen das. Gewalt in der Form des Krieges ist zwischen den Mitgliedstaaten der EU undenkbar geworden. 2012 wurde die EU für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Frieden in Europa ist aber keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr gilt es über die innerhalb der EU geschaffene Friedenszone hinaus friedensstiftend tätig zu werden. Verbesserte Möglichkeiten sollten sich dafür im Rahmen der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik bieten.
II. Die wirtschaftliche Einigung
[58]Die wirtschaftliche Einigung war stets die Triebfeder des europäischen Einigungsprozesses. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl(EGKS) erfüllte diese Aufgabe bis 2002 im Rahmen der gemeinschaftlichen Verwaltung der Kohle- und Stahlindustrie. Mit Wirkung vom 24. Juli 2002 wurden die Bereiche Kohle und Stahl zunächst den Regeln des EG-Vertrages und später den Regeln der EU- Verträge unterstellt. Zu den Zielen der Europäischen Atomgemeinschaft(EAG) heißt es in Art. 1 des EAG-Vertrages: „Aufgabe der Atomgemeinschaft ist es, durch die Schaffung der für die schnelle Bildung und Entwicklung der Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Beziehungen mit den anderen Ländern beizutragen.“ Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft(EWG) ging über den sektoriellen Ansatz der beiden anderen Gemeinschaften hinaus, indem sie die Mitgliedstaaten auf allen Wirtschaftsgebieten zu einer Gemeinschaft zusammenführen sollte.
[59]Als grundlegende Ziele dieser Einigunggelten bis heute:
• die harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens
• eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung
• die Hebung des Lebensstandards
• das Bemühen um ein hohes Beschäftigungsniveau
• die Gewährleistung wirtschafts- und währungspolitischer Stabilität.
Im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Einigung stehen dabei (1) die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes, (2) die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten und (3) die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion.
1. Die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes
[60]Was mit der Errichtung eines Gemeinsamen Marktes gemeint war, wird deutlich, wenn man die zur Herstellung des Gemeinsamen Marktesnotwendigen Maßnahmen betrachtet:
• die Abschaffung der Zölle und mengenmäßigen Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von Waren sowie aller sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten
• eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber dritten Ländern
• die Beseitigung der Hindernisse für den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
• die Errichtung eines Systems, das den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Verfälschungen schützt
• die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, soweit dies für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes erforderlich ist.
[S. 73]
[61]Neben dem Begriff des Gemeinsamen Marktes ist durch die EEA der Begriff des Binnenmarkteseingefügt worden. Nach Art. 26 Abs. 2 AEUV umfasst der Binnenmarkt „... einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital ... gewährleistet ist.“ Die Konzeption des Binnenmarktes 54orientiert sich inhaltlich an der des Gemeinsamen Marktes und soll die gleichen Ziele verwirklichen, bedeutet jedoch eine qualitative Verbesserung von Marktfreiheits- und Gleichheitsrechten 55.
2. Die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion
[62]Nach Art. 119 AEUV umfasst die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der EU im Rahmen der wirtschaftlichen Einigung:
„(1) ... die Einführung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.
(2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit ... eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen.
(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der folgenden richtungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz.“
III. Die politische Einigung
[63]Die politische Einigung Europas sollte nach den Vorstellungen der Gründungsväter der früheren EWG zwangsläufig aus dem wirtschaftlichen Integrationsprozess hervorgehen. Die wirtschaftliche Einigung, auf die man sich zunächst in konkreter Form verständigt hatte, war zu keiner Zeit Selbstzweck, sondern lediglich ein Zwischenstadium auf dem Weg zur politischen Einigung. In der Präambel zum EGKS-Vertrag wird dies mit den Worten zum Ausdruck gebracht, durch „konkrete Leistungen“ sei zunächst eine „tatsächliche Verbundenheit“ zu schaffen, und die „Einrichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft“ solle „den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter Völkern legen“. Die Präambel des EWG-Vertrages spricht den festen Willen aus, „die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen“.
[S. 74]
[64]Bereits zu Beginn der 60er Jahre zeigte sich jedoch im Scheitern der Fouchet-Pläne, dass auch ein erfolgreiches Wirken der Wirtschaftsgemeinschaft nicht automatisch in die Qualität einer unauflöslichen politischen Gemeinschaft umschlägt. Dies vor allem deshalb nicht, weil zwar über die Grundlagen der wirtschaftlichen Einigung ein mehr oder weniger breiter Konsens unter den Mitgliedstaaten bestand, eine gemeinsame „europäische Philosophie“ im Hinblick auf Struktur und Inhalt der künftigen politischen Gemeinschaft aber selbst unter den ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten nicht vorhanden war. Die später vollzogenen Beitritte haben diese Situation noch verschärft. Die zunächst vorherrschenden Integrationsvorstellungen der europäischen Föderalisten, für die eine europäische politische Gemeinschaft nur in Form eines Europäischen Bundesstaates denkbar war, wurden vor allem durch den vom französischen Staatspräsidenten de Gaulle vorgetragenen Gedanken eines „Europa der Vaterländer“, das auf der Zusammenarbeit souveräner Nationalstaaten beruht, zurückgedrängt. Seine konkreten Vorstellungen über dieses „Europa der Vaterländer“ umriss de Gaulle am 5. September 1960 auf einer Pressekonferenz wie folgt:
Читать дальше