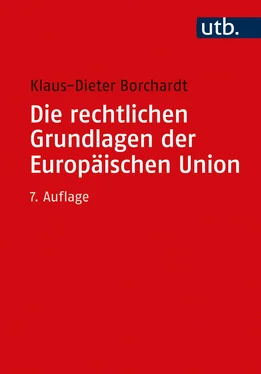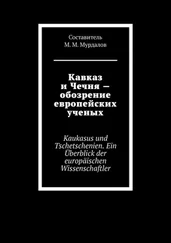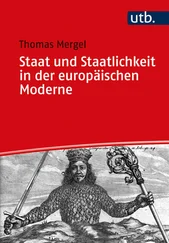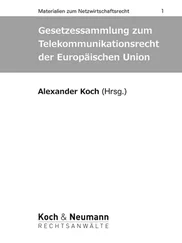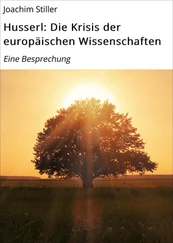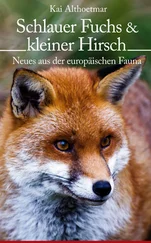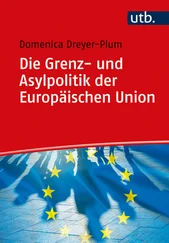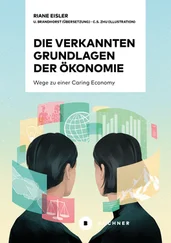[45](4) Serbienhat seine EU-Mitgliedschaft am 22. Dezember 2009 beantragt. Aufgrund einer positiven Stellungnahme der Kommission hat der Europäische Rat den Kandidatenstatus Serbiens am 1. März 2012 bestätigt und die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen beschlossen. Verhandlungen wurden am 21. Januar 2014 aufgenommen und haben durchaus Fortschritte gebracht; allerdings hängt das Tempo der Gesamtverhandlungen stark von der Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo ab.
[46](5) Albanienhat seinen Beitrittsantrag am 28. April 2009 eingereicht. Die Kommission hat zu diesem Antrag am 27. Mai 2010 eine Stellungnahme abgegeben, in der die wichtigsten Reformvorhaben für eine Annäherung Albaniens zur EU aufgelistet wurden. Diese Vorhaben wurden nach einem konkreten Aktionsplan umgesetzt, so dass Albanien am 27. Juni 2014 den Status als Kandidatenland erhalten konnte und die Kommission im April 2018 dem Rat empfohlen hat, die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu beschliessen.
[47](6) Seit 2005 laufen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die ihren Beitrittsantrag am 14. April 1987 gestellt hat. Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei haben jedoch eine noch weiter zurückreichende Geschichte. Schon 1963 wurde ein Assoziationsabkommen zwischen der damaligen EWG und der Türkei geschlossen, in dem auf eine Beitrittsperspektive Bezug genommen wird. 1995 wurde eine Zollunion gegründet. Im Dezember 1999 hat der Europäischen Rat in Helsinki der Türkei offiziell den Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt. Dies war Ausdruck der Überzeugung, dass dieses Land die Grundlagen für ein demokratisches System besitzt, auch wenn noch enormer Handlungsbedarf bei der Achtung der Menschenrechte und dem Schutz der Minderheiten besteht. Die Beitrittsverhandlungen beruhen auf drei Säulen: Die erste Säule betrifft die Zusammenarbeit zur Unterstützung des Reformprozesses in der Türkei, insbesondere im Hinblick auf eine fortlaufende Erfüllung der politischen Beitrittskriterien. Die Kommission kann im Falle schwerwiegender[S. 58] und fortgesetzter Verletzungen der freiheitlichen und demokratischen Grundsätze, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit eine Aussetzung der Verhandlungen empfehlen. Eine solche Aussetzung hat das EP in einer Entschließung vom 13. März 2019 wegen der schlechten Bilanz bei der Achtung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, der Freiheit der Medien und der Korruptionsbekämpfung sowie des Präsidialsystems gefordert (370 Ja-Stimmen, 109 Nein-Stimmen, 143 Enthaltungen). Nach einer solchen Empfehlung kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit die effektive Aussetzung der Verhandlungen beschließen. Bei der zweiten Säule geht es um die spezifische Herangehensweise in Bezug auf die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Die Beitrittsverhandlungen finden im Rahmen einer Regierungskonferenz mit voller Beteiligung aller EU-Mitglieder statt. Für jedes Verhandlungskapitel legt der Rat die Referenzkriterien für den vorläufigen Abschluss der Verhandlungen fest, wozu insbesondere eine befriedigende Bilanz in Bezug auf die Umsetzung des unionsrechtlichen Besitzstandes gehört. Die rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus der Übernahme des Besitzstandes ergeben, müssen vor Aufnahme der Verhandlungen über die betreffenden Kapitel erfüllt sein. Hier können sich längere Übergangszeiträume als notwendig erweisen. In Bezug auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zieht die Kommission unbefristete Schutzklauseln in Betracht. Außerdem ist der Beitritt der Türkei mit einschneidenden finanziellen und institutionellen Konsequenzen verbunden, die vor dem Abschluss der Beitrittsverhandlungen einer konkreten Lösung zugeführt sein müssen. Die dritte Säule sieht einen wesentlich verstärkten politischen und kulturellen Dialog zwischen den Völkern der Mitgliedstaaten der EU und der Türkei vor. In diesem Dialog geht es um kulturelle und religiöse Unterschiede, um Migrationsfragen, Probleme im Zusammenhang mit den Minderheitenrechten und um Terrorismus. Das Endziel dieser Verhandlungen ist der Beitritt. Allerdings besteht keine Garantie dafür, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Das im Jahre 1999 anvisierte Datum für einen möglichen Beitritt im Jahre 2014 ist verstrichen und es wurde keine neue Zeitlinie vorgegeben 38. Zudem hat sich die Türkei in den letzten Jahren erheblich von der EU wegbewegt, vor allem in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsschutz. Nur bei einer Umkehr dieser negativen Tendenzen ist die Fortführung der Beitrittsverhandlungen realistisch.
c) Potentielle Kandidaten
[48]Potentielle Kandidaten für einen Beitritt zur EU sind weitere Staaten des westlichen Balkans, nämlich Bosnien und Herzegowina sowie das Kosovo 39.
[S. 59]
III. Die Austrittsgeschichte
[49]Mit dem Vertrag von Lissabon wurde im EU-Vertrag eine Austrittsklausel eingeführt, die es einem Mitgliedstaat erlaubt, die EU zu verlassen (Art. 50 EUV). Danach kann ein Mitgliedstaat im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften den Beschluss fassen, von seinem einseitigen und an keine weiteren Voraussetzungen geknüpften Austrittsrecht nach Art. 50 Abs. 1 EUV Gebrauch zu machen. Der Mitgliedstaat hat dann dem Europäischen Rat nach Art. 50 Abs. 2 S. 1 EUV seine Austrittsabsicht mitzuteilen. Erst mit der offiziellen Notifizierung des Rates wird das förmliche Austrittsverfahren und damit auch die Zwei-Jahres-Frist des Art. 50 Abs. 2 S. 1 EUV in Gang gesetzt. Der Europäische Rat beschliesst sodann nach Art. 50 Abs. 2 S. 2 EUV einstimmig verbindliche Leitlinien, die den nun folgenden Verhandlungen eines Austrittsabkommens zugrunde gelegt werden, über das er schliesslich mit qualifizierter Mehrheit entscheidet (Art. 50 Abs. 4 S. 2 EUV i.V.m. Art. 238 Abs. 3 lit. b AEUV). Der Abschluss eines Austrittsabkommens ist für die Wirksamkeit des Austritts allerdings nicht konstitutiv. Kommt es innerhalb von zwei Jahren nach der Ausübung des Austrittsrechts durch Notifizierung des Europäischen Rates nicht zu einem Austrittsabkommen, so wird der Austritt automatisch wirksam (sog. sunset clause), sofern die Zwei-Jahres-Frist nicht im Einvernehmen mit dem austrittswilligen Mitgliedstaat durch einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates verlängert wird (Art. 50 abs. 3 EUV). Im Rahmen der turbulenten Verhandlungen über den Brexit auch auf Vorlage durch ein schottisches Gericht der EuGH mit der Frage befasst, ob, wann und wie eine Notifizierung vor Ende der Zwei-Jahres-Frist einseitig zurückgenommen werden kann. Der EuGH hat hierzu entschieden 40, dass eine einseitige Rücknahme der Austrittserklärung „in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Notwendigkeiten“ im Vereinigten Königreich möglich sei. Dann bliebe das Vereinigte Königreich unter unveränderten Bedingungen Mitglied der EU. „Kein Staat kann gezwungen werden, gegen seinen Willen der Europäischen Union beizutreten und genausowenig kann er gezwungen werden, die Europäische Union gegen seinen Willen zu verlassen.“ Die Möglichkeit einer einseitigen Rücknahme besteht bis zum Ende der Zwei-Jahres-Frist bzw. einer entsprechend verlängerten Austrittsfrist. Mit der Wirksamkeit des Austritts durch Ablauf der Zwei-Jahres-Frist bzw. einer entsprechend verlängerten Austrittsfrist finden die EU-Verträge und damit auch das europäische Sekundärrecht auf den ausgetretenen Mitgliedstaat automatisch keine Anwendung mehr.
Eine Bestimmung über den Ausschluss eines Mitgliedstaates aus der EU wurde in Art. 50 EUV nicht aufgenommen.
Читать дальше