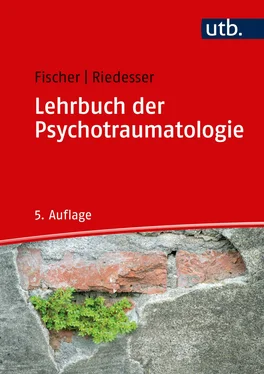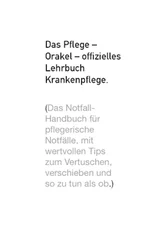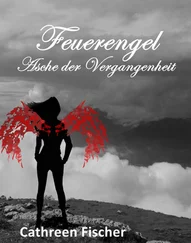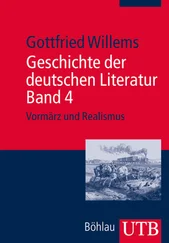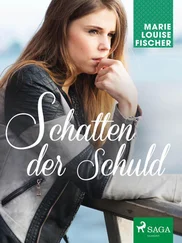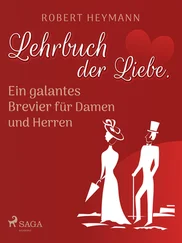Gottfried Fischer - Lehrbuch der Psychotraumatologie
Здесь есть возможность читать онлайн «Gottfried Fischer - Lehrbuch der Psychotraumatologie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Lehrbuch der Psychotraumatologie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Lehrbuch der Psychotraumatologie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lehrbuch der Psychotraumatologie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Überarbeitung von Adrian Georg Fischer, Monika Becker-Fischer, Theo O. J. Gründler, Ferdinand Haenel, Kurt Mosetter, Reiner Mosetter, Peter
Lehrbuch der Psychotraumatologie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lehrbuch der Psychotraumatologie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es ist nun interessant zu sehen, dass sich in den USA eine ganz ähnliche Diskussion ergeben hatte und ähnliche Überlegungen zu einer vergleichbaren Benennung führten. Dort befasst sich schon sehr viel länger als in Deutschland ein Kreis von Wissenschaftlern systematisch mit der Erforschung von schweren und schwersten Stressphänomenen. Wegweisend war die Publikation „Stress-Response-Syndromes“ von Mardi Horowitz, einem Psychiater und Psychoanalytiker aus San Francisco (1986). Eine Akzentverschiebung auf „traumatischen“ Stress, die bei Horowitz schon angelegt ist, führte schließlich zur Bezeichnung der so genannten nach-traumatischen Belastungsstörung, dem „posttraumatic stress disorder“, wie sie in das „Diagnostische und Statistische Manual“ (DSM) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (1994 in seiner vierten Fassung erschienen) eingegangen ist. Hier werden die Begriffe Stress und Trauma eng miteinander verbunden, was vom intuitiven Sprachgefühl her nicht ganz unproblematisch ist. Wir werden später auf Fragen der Terminologie zurückkommen. Hier sei nur soviel angemerkt: Im täglichen Sprachgebrauch unterscheiden wir deutlich zwischen Trauma und Stress. Trauma wird eher als seelische Verletzung verstanden, während Stress eine recht alltägliche Erscheinung ist. Jeder leidet bisweilen darunter und kommt doch irgendwie damit zurecht. Trauma nimmt eher die Konnotation von Leiden und Kranksein an.
Möglicherweise aus dieser sprachlichen Intuition heraus verwandten die Kinderpsychiater Donovan und McIntyre in einer Veröffentlichung mit dem Titel: „Healing the hurt child: A Developmental-contextual approach“ im Jahre 1990 weltweit zum erstenmal den Ausdruck „Traumatology“, wie eine Computerrecherche ergab. Donovan war sehr erstaunt, als er später als Vater dieser Wortprägung entdeckt wurde. Er und sein Kollege McIntyre hatten gar nicht die Absicht gehabt, einen neuen Terminus einzuführen. Sie befassten sich mit den verheerenden Langzeitfolgen psychischer Traumatisierung bei Kindern und bezeichneten ihre Arbeit ganz selbstverständlich als Beitrag zur „Traumatology“ (Donovan 1991, 433). „Healing the hurt child“: das verletzte Kind zu heilen und als Voraussetzung für die Heilung die seelischen Verletzungen und Wunden zu beschreiben, darum war es den beiden Kinderpsychiatern gegangen. Die Wortfindung war hier ebenso „natürlich“ und intuitiv verlaufen wie bei unserer Freiburger Institutsgründung. Für eine wissenschaftliche Disziplin muss das nicht unbedingt ein Nachteil sein. Deutlicher als bei „ausgedachten“, mühsam entwickelten Kunstwörtern können wir in solchen Fällen von einem terminologischen Bedarf ausgehen, der aus der Praxis entsteht und auch in praktischen Anforderungen begründet ist.
Für Donovan hat der Ausdruck „Traumatology“ programmatischen Charakter. Er grenzt ihn zunächst von der chirurgischen Traumatologie ab und kommt dann auf das erweiterte besondere Forschungsfeld zu sprechen, das der Ausdruck bezeichnen soll:
„Der Ausdruck ,Traumatologie‘ ist nicht neu in der Medizin. Traditionellerweise bezeichnet er einen Zweig der Chirurgie, der sich beschäftigt mit Wunden und Behinderungen, die von einer Verletzung stammen. Unsere Verwendung jedoch spiegelt das Entstehen eines genuinen Forschungsfeldes wider, das aus Bemühungen entstanden ist, die früher als disparat wahrgenommen wurden. Bei allem Respekt, den wir den vielfältigen mikrokosmischen Universen des menschlichen Körpers schulden und der Komplexität seiner Reaktion auf physische Verletzungen, so bezeichnet unsere Verwendung des Begriffs Traumatologie doch ein viel breiteres, ein wirklich umfassendes Feld, ein schon existierendes Forschungsfeld, das darauf wartet, erkannt, organisiert und entwickelt zu werden – ganz ähnlich wie ein Land darauf wartet, entdeckt zu werden“ (Donovan 1991, 433, Übersetzung G. F.).
Für Donovan stellt also Traumatologie ein übergeordnetes Gebiet dar, das die chirurgische Traumatologie als ein besonderes Fach einschließt. Er kommt zu folgender Definition:
„Traumatologie ist das Studium der natürlichen und vom Menschen hervorgerufenen Traumata (vom ,natürlichen‘ Trauma, von Unfällen und Erdbeben bis hin zu den Schrecken unbeabsichtigter oder auch beabsichtigter menschlicher Grausamkeit), von deren sozialen und psychobiologischen Folgen und den prädiktiven/präventiven/interventionistischen Regeln, die sich aus diesem Studium ergeben“ (434).
Donovan betont, dass die Traumatologie seiner Meinung nach ein neues, in sich zusammenhängendes Forschungsfeld darstelle und als solches betrieben werden sollte. Er führt einige Ansätze an, die als Vorläufer dieser künftig zu entwickelnden Disziplin betrachtet werden können, die aber bezeichnenderweise im etablierten Wissenschaftsbetrieb mehr oder weniger untergegangen seien, so etwa die Erforschung traumatischer Sozialisationserfahrungen, die in der modernen „biologischen Psychiatrie“ heute kaum noch Beachtung finde. Ein ähnliches Schicksal hätten viele Bereiche traumatologischer Forschung erfahren. In verschiedenen Disziplinen führen sie eine Rand- oder Schattenexistenz. Sie haben sich bisher nicht zu einer konsistenten Theorie und Bestimmung eines Forschungsfeldes zusammengefunden. Desto notwendiger erscheint Donovan ein transdisziplinärer Forschungsansatz „Traumatologie“, der in sehr unterschiedliche Felder hineinreicht. Traumatologie sei notwendigerweise so komplex, dass sie sehr unterschiedliche Bereiche von Forschung und klinischer Erfahrung einbeziehen müsse, wie etwa: „Cognitive studies; developmental, clinical and research psychology; medicine, anthropology; epidemiology; and even education research“ (loc. zit.).
Eine so umfassende Konzeption des neuen Forschungsgebietes blieb nicht unwidersprochen. Schnitt (1993) argumentiert zunächst, dass der Begriff „Traumatologie“ schon von der Chirurgie belegt sei. Er äußert im Übrigen die Befürchtung, eine neue Bezeichnung und die Abgrenzung eines neuen Forschungsgebietes könne die von Donovan beklagte Aufsplitterung des traumatologischen Wissens sogar noch weiter fördern und zu Separatismus führen. In seiner Erwiderung hält Donovan (1993) an Programmatik und Namen der neuen Disziplin fest und betont vor allem die Chance, bisher verstreute Wissensbestände zu integrieren. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, ob angesichts der Komplexität des Wissens und der Dringlichkeit seiner praktischen Umsetzung nicht möglicherweise auch eine eigene Berufsgruppe ausgebildet werden sollte. Donovan beurteilt eine solche Möglichkeit grundsätzlich positiv, während Schnitt Dilettantismus befürchtet und den Berufsabschluss in einer traditionellen Disziplin als Voraussetzung für praktische traumatologische Tätigkeit betrachtet.
Zumindest für den deutschen Sprachraum scheint es uns sinnvoll zu sein, den Ausdruck Psycho-Traumatologie zu verwenden, unter anderem in Abgrenzung von der Chirurgischen Traumatologie. In ihrem Lehrbuch beschreiben Kuner und Schlosser (1988) die Geschichte der chirurgischen Traumatologie folgendermaßen:
„Die Erkennung und Behandlung von Unfall- und Verletzungsfolgen gehört zu den ältesten Zweigen ärztlicher Tätigkeit. Verletzungen des Menschen durch Unfälle als Folge menschlicher Auseinandersetzungen sind so alt wie die Menschheit selbst, und in der Notwendigkeit, dem verletzten Mitmenschen zu helfen, liegt die Wurzel jeder Traumatologie“.
Psycho-Traumatologie, die Untersuchung und Behandlung seelischer Verletzungen und ihrer Folgen hat sicher ein ähnliches therapeutisches Ziel wie die chirurgische Traumatologie. Es ist aber aufschlussreich, dass sich eine solche Disziplin erst heute, also sehr viel später als die Wissenschaft von den körperlichen Wunden zu bilden beginnt. Haben die Menschen ihre seelischen Wunden bisher vernachlässigt, vielleicht schon deshalb, weil sie im Unterschied zu den körperlichen unsichtbar sind? Wir kommen im Folgenden Abschnitt auf diese Frage zurück. Jedenfalls stellt eine explizit psychologische und psychosomatische Traumatologie in der Geschichte der Medizin ein Novum dar. Dies sollte in der Bezeichnung auch zum Ausdruck kommen und terminologisch nicht mit der traditionellen medizinischen Traumatologie konfundiert werden. Eine Gefahr dieser Begriffswahl besteht vielleicht darin, das Gebiet zu stark zu verengen, so dass der fächerübergreifende Bezug, den Donovan mit seiner Programmatik fördern möchte, gefährdet wird. Diese Gefahr erscheint uns allerdings geringer als die komplementäre einer erneuten Vernachlässigung der menschlichen Erlebnissphäre, wie sie leider in der Medizin und sogar in der Psychologie lange Zeit zu beklagen war. Als terminologisches Anhängsel einer erweiterten medizinischen „Traumatologie“ sähe die neue Disziplin einem ungewissen oder, angesichts der bisherigen Erfahrungen, wohl sogar gewissen Schicksal entgegen. Der Ausdruck Psycho-Traumatologie soll die Aufmerksamkeit auf die menschliche Erlebnissphäre richten. Dabei dürfen die somato-psychischen und psycho-somatischen Wechselbeziehungen natürlich nicht vernachlässigt werden. Ebenso wenig die sozialen Bezüge der menschlichen Erfahrungswelt. Die Verletzungen jedoch, von denen das neue Gebiet handeln soll, liegen nicht primär im körperlichen und auch nicht vage in einem irgendwie konzipierten „sozialen Bereich“. Betroffen ist auch keine behavioristische „black-box“ oder sonst ein „Konstrukt“, sondern das verletzbare, sich-empfindende und sich-verhaltende menschliche Individuum, wenn es in seinen elementaren Lebensbedürfnissen bedroht und verletzt, in seiner menschlichen Würde und Freiheit missachtet wird. Psychologie als die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten kann hier zentrale Beiträge leisten, wenn sie sich nicht schon im Vorhinein ihres eigentlichen Gegenstandes entledigt, wie dies der → Behaviorismus tat. Von einer „Verhaltens-Traumatologie“ zu reden, wäre zumindest im deutschen Sprachverständnis einigermaßen widersinnig. Das Festhalten dagegen am Bezugspunkt einer je besonderen, individuellen Erlebnissphäre schafft erst die begriffliche Voraussetzung für eine Lehre von den psychischen Verletzungen, ihrem „natürlichen“, unbehandelten Verlauf und den Möglichkeiten ihrer therapeutischen Beeinflussung. Wie in den folgenden Abschnitten noch deutlich wird, verstehen wir den Ausdruck „Psycho-“ in Psychotraumatologie im Rahmen eines „Mehr-Ebenen-Konzepts“ von der psychosozialen und physischen Wirklichkeit. Die psychische Ebene wird darin als eine Differenzierungsform der körperlich-physischen gesehen. Sie stellt zugleich eine Individuierung, eine Besonderung der gesellschaftlich allgemeinen Kommunikations- und Beziehungsformen dar. Von daher muss die Psychotraumatologie unter sozialen und physiologisch-somatischen Gesichtspunkten zugleich betrieben werden. Ihr zentraler Bezugspunkt ist jedoch die menschliche Erlebnissphäre, die nicht weniger verletzbar, in ihren Funktions- und Regulationsbedingungen nicht weniger stör- und „kränkbar“ ist als die körperliche Ebene des psychophysischen menschlichen Weltverhältnisses.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Lehrbuch der Psychotraumatologie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lehrbuch der Psychotraumatologie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Lehrbuch der Psychotraumatologie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.