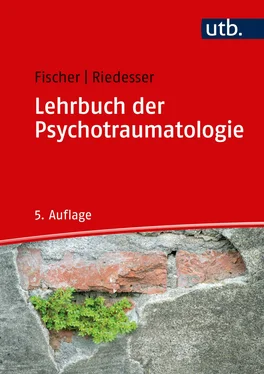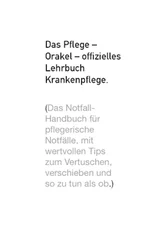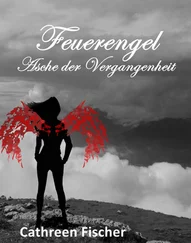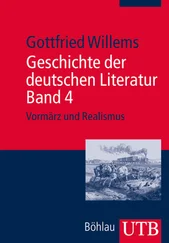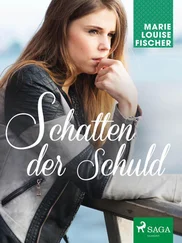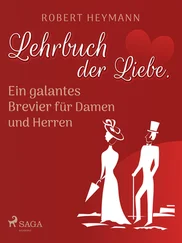Mit einem dialektisch-ökologischen Ansatz lässt sich durch die Kombination geeigneter Forschungsmethoden (Abschnitt 3.4) prinzipiell ein kausales Verständnis psychotraumatischer Störungsbilder erreichen, so weit es gelingt, an Gruppen und/oder Individuen eine systematische Kovariation zwischen traumatogenen Umweltfaktoren und subjektiven Verarbeitungsprozessen bzw. Verletzungsphänomenen aufzuzeigen.
In der Systematik des Lehrbuchs scheint der Entwicklungsaspekt zu fehlen, ein besonderer Abschnitt zur Psychotraumatologie der Entwicklung etwa. Der Gesichtspunkt der Entwicklung wird jedoch, unserem dialektisch-prozessorientierten Ansatz entsprechend, innerhalb der AP, DP und SP bereits systematisch berücksichtigt. Es handelt sich dabei nicht um eine weitere Zugangsweise oder Forschungsperspektive, sondern um ein allgemeines Merkmal des Gegenstands, wenn wir nämlich das menschliche Leben insgesamt als Entwicklungsprozess verstehen.
Als grammatische Allgemeinbezeichnungen verwenden wir mehr oder weniger beliebig entweder die männliche oder die weibliche Form (z. B. Patientinnen oder Patienten). Wenn das Genus für den Sinn der Passage von Bedeutung ist, wird dies durch kursive Schrift hervorgehoben, z. B. Patientinnen, wenn Frauen gemeint sind und nicht die Gruppe der Patienten oder Patientinnen im Allgemeinen.
Das Glossar am Ende des Buches gibt terminologische Definitionen und klärt außerdem Fachausdrücke, die nicht in allen „Mutterdisziplinen“ der Psychotraumatologie geläufig sind. Im Text wird durch einen Pfeil (→) auf das Glossar verwiesen.
Das Glossar kann natürlich gewisse Grundkenntnisse in Nachbardisziplinen nicht ersetzen. Wir hoffen aber, dass es das Verständnis des Textes erleichtern kann und dass es zugleich dazu beiträgt, dass die interdisziplinäre Disziplin Psychotraumatologie zu einem einheitlichen Gebiet zusammenwächst.
Abkürzungen
| ACTH |
Adrenocorticotropes Hormon |
| AP |
Allgemeine Psychotraumatologie |
| BICC |
Bonn International Center of Conversion |
| bPTBS |
basales psychotraumatisches Belastungssyndrom |
| CAPS |
Clinician-administered PTSD-Scale |
| CAT |
Cognitive-Analytic-Therapy |
| CISD |
Critical Incident Stress Debriefing |
| CS |
Konditionierter Stimulus |
| DBS |
Double-Bind-Situation |
| DES |
Dissociative Experience Scale |
| DESNOS |
Diagnosis of extreme Stress not otherwise specified |
| DIPS |
Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen |
| DP |
Differenzielle Psychotraumatologie |
| DSM |
Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen der American Psychiatric Association |
| DVM |
Dialektisches Veränderungsmodell |
| EEG |
Elektroencephalogramm |
| EMDR |
Eye Movement Desensitization and Reprocessing |
| GABA |
Gammaaminobuttersäure |
| HHN |
Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse |
| HTQ |
Harvard Trauma Questionnaire |
| ICD |
International Classification of Diseases |
| IES |
Impact of Event Scale |
| IN-Strategie |
Individuell-nomothetische Forschungsstrategie |
| IPT |
Institut für Psychotraumatologie Köln |
| KÖDOPS |
Kölner Dokumentationssystem für Psychotherapie und Traumabehandlung |
| KOM |
Kölner Opferhilfe Modell |
| kPTBS |
komplexes psychotraumatisches Belastungssyndrom |
| KTD |
Kölner Therapie Dokumentation |
| KTI |
Kölner Traumainventar |
| LIPT |
Leymann Inventory of psychological Terrorization |
| M-CID |
Münchener composite international diagnostic interview |
| MMPI |
Minnesota Multiphasic Personality Inventory |
| MPTT |
Mehrdimensionale psychoanalytische Traumatherapie |
| OPD |
Operationalisierte psychodynamische Diagnostik |
| PDEQ |
Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire |
| PET |
Positronen-Emissions-Tomographie |
| PFP |
Psychotraumatologisch fundierte Psychotherapie |
| PMT |
Professionales Missbrauchstrauma |
| PTBS |
Psychotraumatisches Belastungssyndrom |
| PTSD |
Posttraumatic Stress Disorder |
| PTsfD |
Posttraumatic Self Disorder |
| PTSS |
Posttraumatic Symptom Scale |
| RCT |
Rehabilitation Center for Torture Victims |
| SCID |
Structured Clinical Interview for DSM III |
| SCL-90-R |
Symptom Checklist, 90 Items, revised |
| SIT |
Stress Inoculation Training |
| SKPP |
Fragebogen zu sexuellen Kontakten in Psychotherapie und |
| Psychiatrie |
| SP |
Spezielle Psychotraumatologie |
| SUD-Skala |
Subjective Units of Discomfort |
| TKS |
Traumakompensatorisches Schema |
| TS |
Traumaschema |
| UCR |
Unkonditionierte Reaktion |
| UCS |
Unkonditionierter Stimulus |
| VI-Strategie |
Variablenisolierende (Forschungs-)Strategie |
| VS |
Victimisierungssyndrom |
| ZNS |
Zentralnervensystem |
| ZTST |
Zentrales traumatisches Situationsthema |
Teil I:
Allgemeine Psychotraumatologie
1 Einführung
1.1 Psychotraumatologie als Forschungs- und Praxisfeld
Ideen liegen manchmal in der Luft – und Namen dafür auch. Seit einigen Jahren hatten wir, eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus Psychologie, Medizin, Rechtswissenschaft und vor allem aus Psychoanalyse und Psychotherapie, uns Gedanken gemacht über die Notwendigkeit, psychische Traumata näher zu erforschen. Da dieses Thema unseren sonst recht unterschiedlichen Praxisfeldern gemeinsam war, entstand die Idee, ein Forschungsinstitut zu gründen, das sich mit der Auswirkung von psychischer Traumatisierung auf Entstehung und Verlauf von Krankheiten, psychischen und psychosomatischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten beschäftigen sollte. Die Frage war, wie sollte dieses Institut heißen. Unsere ersten Ideen knüpften an schon etablierte Fachdisziplinen an mit Vorschlägen wie Institut für „medizinisch-psychologische Forschung“ oder bewegten sich in noch weiteren Wortkombinationen wie Medizinisch-Psychologisch-Psychosomatisches Forschungsinstitut usf. Wir verblieben also mit unserer Namenssuche zunächst innerhalb der schon etablierten Disziplinen. Eher zufällig fanden wir dann einen Namen für das, womit wir uns in den praktischen Projekten, die wir damals schon betrieben, auch tatsächlich beschäftigen: eine interdisziplinär ausgerichtete Lehre von psychischen Verletzungen und ihren vielfältigen negativen Folgen für die davon Betroffenen. So entstand schließlich die Bezeichnung Psychotraumatologie, ohne dass wir bewusst eine Wortneuprägung angestrebt hätten. Uns war dabei auch nicht klar, dass dieser Ausdruck bisher noch gar nicht eingeführt war. Er gab ganz selbstverständlich das wieder, womit wir uns befassten: Fragen der Auswirkung von Kindheitstraumen in psychotherapeutischen und psychoanalytischen Behandlungen, Therapie von Exilanten und Opfern von Krieg und politischer Verfolgung, Folgen sexueller Übergriffe in Psychotherapie und Psychiatrie, Diagnosemitteilung bei lebensbedrohlichen Krankheiten, seelische Belastungen bei Katastrophenhelfern und Schadensersatzansprüche nach Verkehrs- oder Arbeitsunfällen. Der Ausdruck Psychotraumatologie bot sich an als gemeinsamer Nenner all dieser Themenbereiche. Am 19.5.1991 gründeten wir nach etwa eineinhalbjähriger Vorbereitung in Freiburg das „Institut für Psychotraumatologie“, um einen Rahmen zur Koordinierung der verschiedenen Forschungsinteressen zu haben. Die Vorsilbe „Psycho“-Traumatologie hatten wir gewählt zur Abgrenzung von der chirurgischen Traumatologie, ein Fach, das an fast allen Universitätskliniken der Bundesrepublik als klinische Einheit und Unterrichtsfach vertreten ist.
Читать дальше