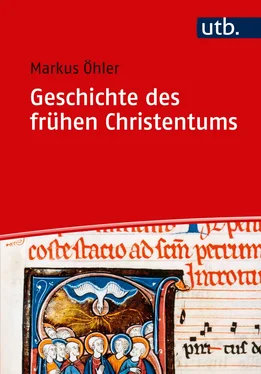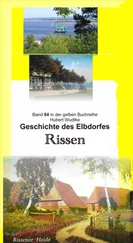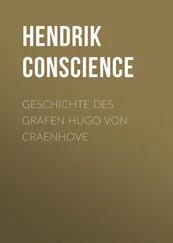(Streit unter den Aufständischen)
In den Jahren 68/69 n. Chr. erfolgte von römischer Seite eine Kampfpause, da die Nachfolge auf dem Kaiserthron abgewartet wurde. In dieser Zeit brach aber unter den judäischen Gruppierungen ein Bürgerkrieg aus, in dem radikale Kräfte um Johannes von Gischala die Gemäßigten aus den Kreisen der Hohepriester und Pharisäer vernichteten. Später trat mit Simon bar Giora ein weiterer Zelotenführer in diese Auseinandersetzung ein. Messianische Ambitionen und soziale Umbrüche gingen damit jeweils einher.
(Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels)
Vespasian zog im Jahr 69 n. Chr. erneut los und eroberte rasch den Rest Judäas mit Ausnahme Jerusalems und der herodianischen Festungen Herodeion, Masada und Machairus. Verzweifelte Appelle an die Vernunft der Aufständischen durch Agrippa II. oder auch Josephus, der zu den Römern übergelaufen war, wurden nicht beachtet. Als Vespasian Kaiser wurde, übernahm sein Sohn Titus das Kommando und konnte Jerusalem nach fünf Monaten Belagerung Ende August/Anfang September 70 n. Chr. einnehmen. Mit der Stadt Jerusalem wurde auch der Tempel, das religiöse Zentrum des Judentums, zerstört. Die Einwohner wurden zum Großteil getötet oder versklavt. Mit Masada fiel im Jahr 73/74 n. Chr. die letzte Festung der Zeloten.
3.5.2 Die Zeit zwischen den Aufständen (70–132 n. Chr.)
(Folgen des Aufstands)
Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die Tötung bzw. Versklavung von bis zu einem Drittel der Bevölkerung sowie die Verwüstung weiter Landstriche Judäas, Samarias und Galiläas führten zu einer angespannten wirtschaftlichen und sozialen Lage unter den Verbliebenen. Teile des Grundbesitzes fielen an den römischen Kaiser, der diese weiterverpachtete, sodass die Landbevölkerung weitgehend unselbstständig wurde. Mit der Versklavung und durch die Fluchtbewegungen während des Aufstands wuchs auch die judäische Diaspora zahlenmäßig deutlich an. Die Eliten des Volkes hatten jede Macht verloren, was u. a. auch zum Verschwinden der sadduzäischen Partei führte.
(Neuorientierung an der Tora)
Der Verlust des Jerusalemer Tempels als Kultzentrum wurde vor allem von jenen Gruppierungen innerhalb des Judentums bewältigt, die schon zuvor die über den Tempelkult hinausgehende Orientierung an der Tora in das Zentrum der jüdischen religiösen Existenz gestellt hatten. Dies begünstigte vor allem die Pharisäer, aus denen sich Teile der frührabbinischen Bewegung entwickelten (s. u. 3.6). Texte wie das 4. Makkabäerbuch versuchen hingegen, die Vereinbarkeit des Gesetzes, das als Grundlage der „Philosophie des Judentums“ gedeutet wird, mit griechisch-römischen Tugendethik aufzuzeigen.
(Neuorientierung in der Apokalyptik)
Auch die apokalyptischen Bewegungen des Judentums, für die die Zerstörung des Tempels einen herben Rückschlag ihrer Heilserwartungen bedeutete, mussten sich neu orientieren. So wurde im syrischen Baruchbuch am Ende des 1. Jh. n. Chr. der Versuch unternommen, die Tempelzerstörung als Teil von Gottes Heilsplan zu verstehen (6f.). Dieser werde mit dem Kommen des Messias, dem Gericht und der Wiederherstellung Israels vollendet (72–74). Die Bücher 4 und 5 der jüdischen Sibyllinen, die in Ägypten im 1. und 2. Jh. n. Chr. entstanden, sind ganz darauf ausgerichtet, das vernichtende Gericht über die Feinde, also das Imperium Romanum, zu erwarten, dessen Vorzeichen in Kriegen, Hungersnöten und Naturkatastrophen jetzt schon erlebt würden. Zugleich wurde aber auch das Ende blutiger Opfer begrüßt (4,24–30).
In Palästina entstand an der Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr. das 4. Buch Esra, das einen anderen Weg zur Bewältigung der Katastrophe einschlug: Die Zerstörung des Tempels wird hier in die grundsätzliche Verstricktheit des Menschen in die Schuld eingeordnet, die ein Grundelement des gegenwärtigen Zeitalters (Äons) sei. Dagegen stehe die Forderung nach Einhaltung der Gebote Gottes, die dem Einzelnen die Möglichkeit eröffne, das zu erreichen, was Gott in seinem erwählenden Handeln versprochen habe, nämlich das endzeitliche Heil. Der Fokus auf die individuelle Erlösung sowohl durch Gottes Gnadenhandeln als auch durch Einhaltung der Tora wurde über diese Schrift hinaus zu einem wichtigen Element des jüdischen Glaubens nach der Tempelzerstörung.
(Das Imperium und das judäische Volk / Fiscus Iudaicus)
In der Stadt Jerusalem wurde währenddessen die Legio X Fretensis stationiert und Judäa zu einer eigenständigen Provinz unter der Leitung des Legionskommandanten gemacht. Der römische Kaiser Vespasian sowie sein Sohn und Nachfolger Titus propagierten den Sieg über die Judäer durch eigene Münzprägungen, die u. a. dazu dienen sollten, andere Völker von Aufständen abzuschrecken. Auch der Triumphzug des Titus, der auf dem Titusbogen in Rom dargestellt ist, rückte die Unterwerfung der Judäer in die Mitte des öffentlichen Bewusstseins. Die Judäer wurden vonseiten des römischen Staates nun als Gesamtheit für den Aufstand verantwortlich gemacht, obwohl sich die Diaspora nicht daran beteiligt hatte. Es wurde eine Sonderabgabe, die ausschließlich Angehörige des judäischen Volkes zu zahlen hatten, der fiscus Iudaicus eingeführt (s. u. 3.7.2). Auch der JHWH-Tempel im ägyptischen Leontopolis wurde 71 n. Chr. geschlossen (Josephus, bell. 7,433–436).
3.5.3 Der zweite Aufstand (132–135 n. Chr.)
(Simon bar Kochba / Aelia Capitolina)
Der nach dem Anführer der Judäer benannte Bar-Kochba-Aufstand setzte im Jahr 132 n. Chr. ein. Als Anlass ist die Neugründung Jerusalems durch Kaiser Hadrian als Aelia Capitolina anzusehen. Diese war außerdem mit dem Bau eines Jupitertempels verbunden (Cassius Dio, hist. 69,12). Simon bar Kochba wurde zum Anführer des Aufstandes. Er wurde als Messias angesehen (yTaan 4,8 fol. 68d) und bezeichnete sich selbst als Fürst Israels (nasi). Über den Verlauf des Aufstands ist nicht viel bekannt. So ist unklar, ob die Aufständischen Jerusalem eroberten, den Tempelkult wieder begannen oder auch in Galiläa kämpften. Nach knapp vier Jahren wurde die Rebellion aber blutig niedergeschlagen. Die Bevölkerung wurde versklavt, die Städte der Region zerstört. Jerusalem wurde zur römischen Colonia Aelia Capitolina, Judäern das Betreten der Stadt verboten.
3.6 Das frühe rabbinische Judentum
(Rabbi)
Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 n. Chr. sowie der Tötung bzw. Versklavung großer Teile der Bevölkerung musste sich das Judentum neu konstituieren. Nicht nur die letzten Reste politischer Selbstständigkeit, die bis zum ersten Aufstand durch das Synhedrion verwaltet worden waren, sondern vor allem die Orientierung am Jerusalemer Heiligtum mit seinem Kult war verloren gegangen. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich daher u. a. aus der pharisäischen Gruppierung und den Schriftgelehrten eine neue Richtung innerhalb des Judentums, die nach den Titeln ihrer Lehrer („Rabbi“) als rabbinische Bewegung bezeichnet wird. Sie rückte statt des verlorenen Tempelkults die Tora in das Zentrum der jüdischen religiösen Identität. Deren Auslegung und Anwendung, vor allem hinsichtlich der Reinheits- und Speisevorschriften, sollte Israel zum heiligen Volk werden lassen.
(Die Rabbinerbewegung)
Obwohl die Überlieferungen in den rabbinischen Schriften (Mischna, Talmud, Tosefta, Midraschim) einen anderen Eindruck erwecken, war die rabbinische Bewegung nicht von Beginn an dominierend. Allerdings waren die Rabbinen dort, wo Fragen um judäische Identität und Grenzziehung zu anderen Formen des Judentums diskutiert wurden, offenbar von großem Einfluss. Hinter der polemischen Darstellung der Pharisäer und Schriftgelehrten in den Evangelien (v. a. Mt 23) lässt sich diese Konfrontation noch erahnen. Prägende Gestalten der frühen „formativen“ Phase der rabbinischen Bewegung waren Jochanan ben Zakkai, Gamaliel II., Aqiva und Jischmael. Das erste Zentrum war in Javne/Iamnia an der Mittelmeerküste, nach 135 n. Chr. im galiläischen Usha.
Читать дальше