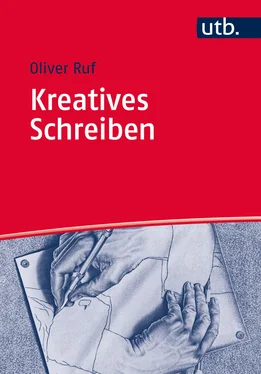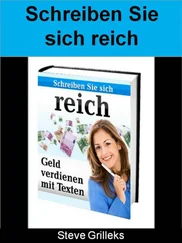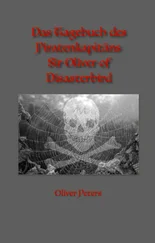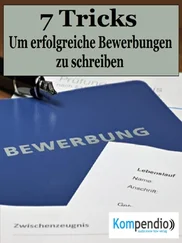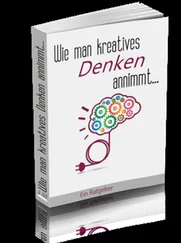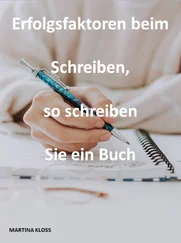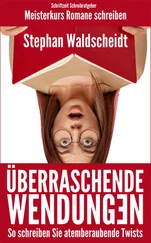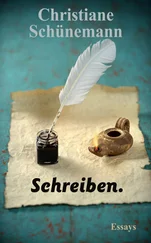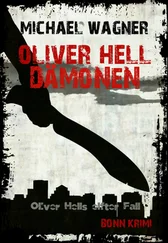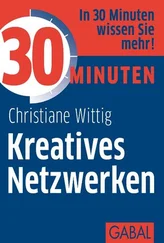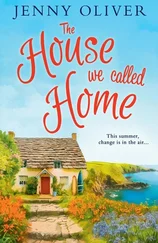[…] 4 Suchverfahren, deren es bedarf, um den nötigen Inhalt zu finden. Diese Verfahren können explizit sein, etwa wenn bestimmte Dokumente eingesehen oder Informanten angerufen werden. Oder es handelt sich um implizite, gedächtnisgestützte Strategien. 5 Anforderungen zur Feinabstimmungdes sprachlichen Outputs.109Bereiter, Carl Zu diesen ›Intentionen‹, ›Strategien‹, ›Inhaltskategorien‹, ›Suchverfahren‹ und ›Anforderungen zur sprachlichen Feinabstimmung‹ kommt, so BereiterBereiter, Carl, ein weiteres Element hinzu: »Unterhalb des Textsortenkonzepts« finde »die Verarbeitung von Inhalten[41]statt«, bei der »semantisches MaterialMaterial aus dem Gedächtnis hervorgeholt und den Anforderungen des Textsortenkonzepts gemäß organisiert« werde.110 In der Ausdeutung dieses Befundes für das Kreative Schreiben lässt sich eine einfache These formulieren, die weitreichende Konsequenzen birgt und an das bereits im vorherigen Kapitel Ausgeführte anknüpft: Ohne das ›Gedächtnismaterial‹ –Ohne »Gedächtnismaterial« kein Kreatives Schreiben ohne Gelesenes/Rezipiertes oder Erlebtes, ohne Tradition oder Geschichte, mithin ohne ästhetische Erfahrung – entwickelt sich auch kein Kreatives Schreiben, das gleichzeitig an Schreib- Fähigkeitengebunden bleibt, an »Flüssigkeit im geschriebenen Ausdruck« wie an »Leichtigkeit in der Entwicklung von IdeenIdee«, an »Beherrschung von Schreibkonventionen« wie an »soziale Kompetenz (verstanden als Fähigkeit, Leseerwartungen zu berücksichtigen)«, an »literarisches Unterscheidungsvermögen« wie an die »Fähigkeit zur Reflexion«.111Bereiter, Carl Bereits deutlich wurde allerdings bereits, dass die Prozesse des Kreativen Schreibens nicht derart eindeutig schematisch abbildbar sind, da der kreative Schreiber nicht zwangsläufig vollkommen zielgerichtet, zweckentsprechend, strategisch und adressatengerecht gedanklich plant, sprachlich formuliert oder seinen ›Text‹ in allen Schreibphasen jeweils progressiv überarbeitet; vielmehr verfertigt er diesen allmählichbeim Schreiben, um einen Satz Kleists112 mit Almuth GrésillonGrésillon, Almuth abzuwandeln,113Grésillon, Almuth die die bereits erwähnte ›Schule‹ der Critique GénétiqueCritique Génétique Critique GénétiqueCritique Génétiquemaßgeblich anhand von Forschungen an literarischen HandschriftenHandschrift (als Fallstudien) vorgestellt hat. 1.2.2. Vom freien Gedanken zum geschriebenen Wort GrésillonsGrésillon, Almuth Aufsatz Über die allmähliche Verfertigung von Texten beim Schreibendistanziert sich ausdrücklich von den Schreibprozessmodellen der Kommunikations-, Kognitions- und auch der SprachwissenschaftSprachwissenschaft, wie sie BereiterBereiter, Carl vertritt und die darin ausführlich [42]kritisiert sind.114Grésillon, AlmuthLudwig, OttoTextproduktion Plädiert wird für ein »Zusammenspiel der betroffenen Disziplinen«, um die »Viefalt von Schreibsituationen tatsächlich ins Auge« zu fassen;115Grésillon, Almuth Grésillon stört sich an jenen »Feld- und Laborexperimenten, die mit Schreiberinterviews und Eigenkommentaren, mit VideoVideo-Aufnahmen, Fehler- und Pausenanalysen arbeiten.«116 Der Zugang, den die Critique GénétiqueCritique Génétiqueim Gegensatz dazu anbietet, thematisiert weniger »Gedanken und EinfälleEinfall ›im Rohzustand‹« als »geschriebene EntwürfeEntwurf, Pläne, MaterialsammlungenEntwürfe, Pläne, Materialsammlungen des Schreibens sowie weitere Phasen des Entstehens und der Überarbeitung«.117 Von Grésillon unterschieden werden sechs Untersuchungsstandpunkte »schwarzer SpurenSpur auf weißem Grund«:118Spur (1.) Zeitverhältnisse, (2.) Raumverhältnisse, (3.) Schrift und Schreibwerkzeug, (4.) SchriftstellerSchriftsteller als Subjekt des SchreibprozessesSchreibprozess, (5.) Teilprozesse literarischen Schreibens, (6.) Ecriture à processusbzw. literarische bottom up-Schreibprozesse.119Grésillon, Almuth Ad 1.) Die Betrachtung des aus Biographien, Korrespondenzen, PapierPapier- oder Wasserzeichenforschungen zu rekonstruierenden Entstehungsdatums eines literarischen Werkes birgt das Problem, dass der genaue zeitliche Ablauf wie auch die Dauer einzelner Schreibphasen kaum konkret festzustellen sind – GrésillonGrésillon, Almuth nennt dies die »gefrorene Zeit« einer HandschriftHandschriftDie »gefrorene Zeit« einer Handschrift.120 In der Konsequenz dieser Perspektive wird deren enorme Bedeutung für die Erforschung des SchreibprozessesSchreibprozess klarer: Im Sinne objektiver, historischer Zeit können literarische HandschriftenHandschrift Epochen zugehören, für welche Informationen über die konkrete SchreibsituationSchreibsituation nicht spontan zur Verfügung stehen: Man denke nur an Beschaffung und Preis des PapiersPapier, an die Umständlichkeit abgeschliffener Gänsefedern [43]und die Unbeständigkeit der Tinte selbst sowie auch der Tintenfässer; all dies gehörte im 19. Jahrhundert noch zum Schreiberalltag. Im Sinne kulturhistorischer Gesetzlichkeiten ist weiterhin klar, daß literarische Handschriften nicht systematisch aufbewahrt wurden. So existieren in Deutschland und Frankreich relativ wenige Arbeitshandschriften, die über das 18. Jahrhundert zurückreichen, während dies in Italien […] schon viel früher bezeugt ist. Zum zweiten ist das Prestige, das ein AutorAutor im literarischen KanonKanon einer Nation erwirbt, ausschlaggebend dafür, daß seine Handschriften nicht nur privat, sondern auch staatlich überliefert werden. Wenn dies der Fall ist, so verfügt man tatsächlich über ein MaterialMaterial von faszinierendem Reichtum.121 Heute stellt sich vor diesem Hintergrund dieselbe Frage umso dringlicher, wie nämlich im ›Zeitalter‹ elektronischer MedienHandschriftenHandschrift im digitalen Zeitalter die Zeitverhältnisse der ComputerComputer- Handschriftdie temporalen Phänomene des Schreibens zu bestimmen sind? Auch deshalb hat das ›Deutsche Literaturarchiv Marbach‹ mit seinem ›Literaturmuseum der ModerneLiteraturmuseum der Moderne‹ als wichtigste Institution in Deutschland längst damit begonnen, nicht nur wie eh und je ManuskripteManuskript und Typoskripte auf PapierPapier, sondern auch DiskettenDiskette, CDs, CD-RomsCD-Rom, FestplattenFestplatte bzw. digitale/digitalisierte DatenträgerDatenträger u.ä. zu archivieren, auszuwerten und kuratorisch auszustellen.122HandDerrida, Jacques Ad 2.) Problematisch ist es in gleicher Weise, zu untersuchen, in welcher Schreibersituation – mit welcher Körpersprache (Gestik, Mimik) und mit welchen metasprachlichen Kommentaren (simultan oder retrospektiv) – jemand einen Text verfasst hat. Und »[u]m so mehr« sei man, so Grésillion, »angewiesen auf die räumlichen Indizien des PapiersPapier«123Grésillon, AlmuthDie »räumlichen Indizien des Papiers« in ihrer schriftlichen Zweidimensionalität:124Semiotik HeftHeft oder fliegende BlätterBlatt? Nur rectooder rectound versobeschrieben? Große oder kleine Blattränder, beschrieben oder nicht? Zwischenzeiliger Raum [44]beschrieben oder nicht? Lineare, horizontales Fortlaufen der Schrift (dem Schriftbild einer Druckseite vergleichbar) oder freieres Spiel der Schriftzeichen mit dem graphischen Raum (an das Raumspiel der Graphik erinnernd und besonders für schreibvorbereitende Phasen bezeichnend, wenn die Gedanken- und Spracharbeit sich relativ umstrukturiert in alle Richtungen hin entwickelt)? Format der Blätter: klein wie gewisse Taschennotizblöcke […] oder groß (heutiges A3-Format) […]?125Grésillon, Almuth Jedem Schreiber geläufig sei die »Tatsache, daß sich gegen das untere Ende einer Seite der Zeilenabstand sowie die Schrift selbst verkleinern«, und dies werfe ein »Licht auf den Zusammenhang zwischen gedanklicher Einheit des zu Schreibenden und materieller sowie visueller Einheit des SchreibraumsSchreibraum«; der »Griff zu einem neuen BlattBlatt« unterbreche »nicht nur den Schreibfluß, sondern auch den visuellen Überblick über das Geschriebene.
Читать дальше