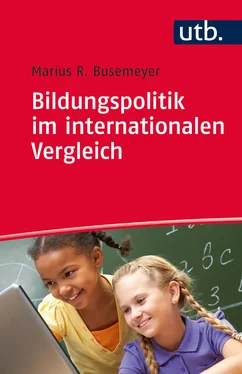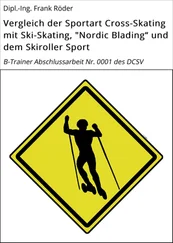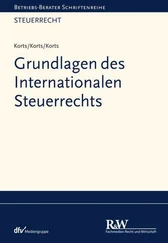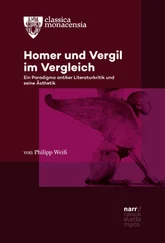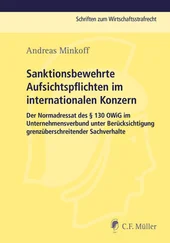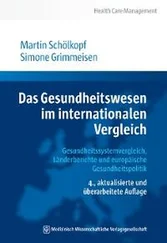Die zweite Variante institutionalistischer Theorien betrachtet vor allem die Auswirkungen bestehender Institutionen auf Politikinhalte. Hier ist insbesondere der Ansatz des »historischen Institutionalismus« zu nennen (Thelen 1999; Pierson 2004), der die Pfadabhängigkeit politischer Entscheidungen betont. Dieser Ansatz versucht zu erklären, warum Reformprozesse in entwickelten politischen Ökonomien selten große Umbrüche nach sich ziehen, sondern Kontinuität dominiert und sich Wandel bestenfalls in inkrementellen Schritten vollzieht. Eine wesentliche Ursache für die hohe Pfadabhängigkeit von Reformprozessen ist, dass Institutionen Ressourcen an bestimmte (Wähler-)Gruppen verteilen, die dann selbst wiederum ein Interesse am Fortbestand dieser Institutionen haben (Hall/Thelen 2009; Pierson 1993, 2004). Auf die Bildungspolitik bezogen, kann davon ausgegangen werden, dass das institutionelle Erbe von wohlfahrtsstaatlichen und bildungspolitischen Institutionen einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, welche Reformoptionen politischen Akteuren in der Gegenwart offenstehen. Sie prägen damit – ähnlich wie sozioökonomische Kontextfaktoren – den allgemeinen Handlungsrahmen von Akteuren, determinieren deren Handlungen aber nicht vollkommen.

Infokasten
Pluralismus und Korporatismus
»Das Konzept des Pluralismus […] betrachtet die Interessendurchsetzung als einen dynamischen politischen Wettbewerb […]. Dabei gilt der Staat als der Adressat für widerstreitende Interessen, die von kollektiven Akteuren geäußert werden. […] Im Grunde genommen überträgt der Pluralismus das Konzept eines funktionierenden Marktes auf die Politik. Politik wird zum Prozess des Gruppenwettbewerbs bei der Durchsetzung von Interessen. Die politische Willensbildung ist dann ein fortwährender Prozess wechselseitig ausgeübten Drucks und Gegendrucks von Interessengruppen. Der Staat ist Empfänger der Impulse und fungiert letztlich als Schiedsrichter. Im Korporatismus wird die Interessenvermittlung anhand von Statusgruppen gebündelt und Interessenkonflikte werden unter diesen ausgehandelt. […] Der Neokorporatismus geht davon aus, dass der Interessenwettbewerb nicht offen, sondern durch Interessenübereinkommen kollektiver Akteure bestimmt ist. Der Neokorporatismus geht von einem koordinierten Zusammenspiel von staatlichen und nicht-staatlichen aus.« (Jahn 2006a: 112 f.)
Die akteursorientierte Perspektive wird von Theorien eingenommen, die die Bedeutung von politischen Faktoren und hierbei insbesondere die Machtbalance zwischen unterschiedlichen parteipolitischen und zivilgesellschaftlichen Kräften betonen. Auch hier sind maßgeblich zwei Varianten zu unterscheiden. Die erste ist die Machtressourcentheorie (Esping-Andersen 1985; Korpi 1983; Stephens 1979). Sie betont die unterschiedliche Verteilung von Machtressourcen auf die organisierten Interessen von Kapital und Arbeit. Demzufolge ist eine Kernaussage dieses Theoriestranges, dass die Machtposition von Gewerkschaften eine entscheidende Variable zur Erklärung der relativen Größe des Sozialstaats sowie des Ausmaßes der sozialen Ungleichheit ist: Je größer der Anteil der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft (Organisationsdichte), desto großzügiger – so die These – ist der umverteilende Wohlfahrtsstaat institutionell ausgestaltet. Neben Gewerkschaften und Arbeitgeberinteressen können jedoch auch andere Arten von organisierten Interessen im Rahmen der Machtressourcentheorie betrachtet werden, zum Beispiel Umwelt-, Menschenrechts- oder Agrarverbände. Die Theorie kollektiven Handelns nach Olson (1965) lehrt jedoch, dass diffuse Interessen (z. B. am Umweltschutz) schwieriger zu organisieren sind als Partikularinteressen (z. B. die Interessen bestimmter Berufsgruppen).
Die Machtressourcentheorie thematisiert auch den Einfluss von Regierungsparteien auf Politikinhalte. Aus der Perspektive dieser Theorie sind Parteien jedoch vor allem der »verlängerte Arm« der organisierten Arbeitsmarktinteressen in der parlamentarischen Arena, d. h. linksgerichtete (sozialdemokratische oder sozialistische) Parteien vertreten vor allem die Interessen der Arbeiterbewegung, während rechtsgerichtete Parteien sich für die Arbeitgeber stark machen. Es ist offensichtlich, dass dieses Verständnis von Parteipolitik wenig komplex ist. Das Handeln von Regierungsparteien wird nicht (nur) von organisierten Interessen geprägt, sondern ganz wesentlich auch von Wählerinteressen. Die Parteiendifferenztheorie (Castles 1982; Hibbs 1977; Schmidt 1996) – eine enge Verwandte der Machtressourcentheorie – argumentiert daher, dass die parteipolitische Zusammensetzung von Regierungen deshalb einen Einfluss auf Politikinhalte hat, weil die Parteien unterschiedliche Wählergruppen vertreten: Linke Parteien sind die Fürsprecher der unteren Einkommensschichten, während rechte Parteien die Interessen des wohlhabenderen Teils der Bevölkerung repräsentieren.
Zusammenfassend gesprochen führte dieses Kapitel in grundlegende Begriffe und Theorieansätze der vergleichenden Policy-Forschung ein, insbesondere in die Grundlagen der Methode des Vergleichs, den Anspruch und Zweck der vergleichenden Policy-Forschung, die dabei wichtige Unterscheidung zwischen Policy-Output und -Outcome sowie die wichtigsten Theorien der vergleichenden Policy-Forschung. Kapitel 5stellt weitere jüngere Theoriebeiträge vor, insbesondere Theorien zur Erklärung von Diffusion und Konvergenz sowie die Multiple-Streams-Theorie von Kingdon (2011).

Weiterführende Lektüre
Blum, S., & Schubert, K. (2007). Politikfeldanalyse . Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Castles, F. G. (1998). Comparative Public Policy: Patterns of Post-War Transformation . Cheltenham: Edward Elgar.
Jahn, D. (2006). Einführung in die vergleichende Politikwissenschaft . Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Lauth, H. J. (Ed.) (2010). Vergleichende Regierungslehre: Eine Einführung . Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schmidt, M. G. (1993). Theorien in der international vergleichenden Staatstätigkeitsforschung. In A. Héritier (Ed.), Policy-Analyse: Kritik und Neuorientierung, PVS-Sonderheft 24/1993 (pp. 371–393). Opladen: Westdeutscher Verlag.
Schmidt, M. G., Ostheim, T., Zohlnhöfer, R., & Siegel, N. A. (Ed.). (2007). Der Wohlfahrtsstaat: Eine Einführung in den historischen und internationalen Vergleich . Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schneider, V., & Janning, F. (2006). Politikfeldanalyse: Akteure, Diskurse und Netzwerke in der öffentlichen Politik . Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.