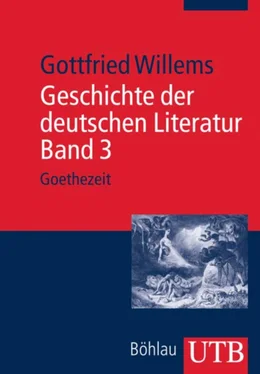Es dauerte allerdings noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, bis zu Hermann August Korff und seiner fünfbändigen Epochenmonographie „Der Geist der Goethezeit“ (1929–1957), bis der Begriff der „Goethezeit“ als Name für die Epoche in Gebrauch kam. Bis dahin hatte man sich vor allem an die Begriffe „Klassik“ und „Romantik“ gehalten. Verwirrenderweise hat man sich dieser sowohl bedient, um die gesamte Epoche zu benennen, als auch um vom Neben-, Gegen- und Nacheinander ihrer beiden wichtigsten literarischen Gruppierungen, der „Weimarer Klassik“ und der verschiedenen Zirkel von Romantikern zu handeln.
Daß die Begriffe der „Klassik“ und „Romantik“ nicht nur gebraucht worden sind, um unterschiedliche Bestrebungen innerhalb der Großepoche kenntlich zu machen, sondern auch, um dieser als ganzer einen Namen zu geben, ist zunächst kaum zu verstehen. Auch wer sich mit der Literatur der Goethezeit nur wenig auskennt, wird im allgemeinen mitbekommen haben, daß sie in sehr unterschiedliche, ja geradezu diametral entgegengesetzte Richtungen weisen. „Klassik“ läßt an eine Kunst denken, die sich um klare, strenge Formen, um letzten Ernst und höchste Verbindlichkeit bemüht, „Romantik“
[<< 8]
hingegen an eine verspielte und verträumte, sich ganz der Phantasie überlassende Kunst; wie sollen sie sich da auf das gleiche Korpus von Texten anwenden lassen! Aber in Deutschland war und ist es durchaus üblich, von „Deutscher Klassik“ zu sprechen, wenn man nicht nur die „Weimarer Klassik“ – Goethe und seinen Kreis – sondern auch die „Klassiker der Romantik“ – Novalis, Tieck, Arnim, Brentano, Hoffmann, Eichendorff – meint. Und außerhalb Deutschlands, etwa in Frankreich und England, wird die gesamte Epoche bis heute im allgemeinen unter „Romantik“ abgebucht, einschließlich der „Weimarer Klassiker“ Goethe und Schiller.
Dieser verwirrende Begriffsgebrauch ist der Niederschlag eines ständigen Ringens zwischen zwei verschiedenen Perspektiven auf die Epoche. Während für die einen die epochalen Gemeinsamkeiten im Vordergrund stehen, wie sie sich aus den großen geschichtlich-gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben – wobei hier wiederum zwischen denen zu unterscheiden ist, die die „innere Einheit“ der Epoche eher auf „klassische“ oder eher auf „romantische“ Prinzipien zurückführen – denken die anderen zunächst und vor allem an das Widerspiel von „klassischer“ und „romantischer“ Kunst. Als Korff seinen „Geist der Goethezeit“ schrieb, hatte die Germanistik gerade eine Phase hinter sich, in der sie sich besonders energisch um die Abgrenzung von „Klassik“ und „Romantik“ bemüht hatte, so daß Korff es für nötig hielt, den inneren Zusammenhang der Epoche neuerlich zur Geltung zu bringen. Und dieser innere Zusammenhang hieß für ihn eben Goethe, so wie schon für Heine und die anderen frühen Literarhistoriker.
Goethe und die Goethezeit
Johann Wolfgang Goethe – seit 1782 „von Goethe“ – ist 1749 geboren und 1832 gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch zwei Werke, durch das Drama „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand“ (1773) und den Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774), und nicht nur bekannt – er wurde durch sie mit einem Schlag zur zentralen Figur des literarischen Lebens in Deutschland. Schon der „Götz“ war eine literarische Sensation, und erst recht der „Werther“. Dieser entwickelte sich zu einem Bucherfolg, wie ihn ein deutscher Autor bis dahin noch nicht erlebt hatte. Wer immer auf sich hielt, wer auf der Höhe der Zeit sein und mitreden wollte, las Goethes Roman. Die jungen Leute kleideten sich wie Werther und seine geliebte Lotte,
[<< 9]
gaben sich und redeten wie sie, und die alten Leute schüttelten darüber den Kopf und verstanden die Welt nicht mehr. Es entstand eine regelrechte Werther-Mode, das sogenannte „Werther-Fieber“, 1ein kultureller Hype, der in manchem schon an das moderne Fanwesen und den Rummel um „Kultfilme“ und „Kultstars“ erinnert. Der „Werther“ war übrigens nicht nur eine deutsche, sondern auch eine europäische Sensation. So hat der französische Kaiser Napoleon einmal Goethe gegenüber bekannt, daß er seinen Roman siebenmal gelesen habe.
In solchen neuen Formen des Umgangs mit Literatur werden tiefgreifende Wandlungen faßbar, Wandlungen nicht nur des literarischen Lebens, sondern des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens überhaupt, und sie sind für die Zeitgenossen wesentlich mit dem Namen Goethes verknüpft. Eine immer größere Zahl von Menschen bringt der Literatur ein immer höheres Maß an Interesse entgegen, und ein immer vitaleres, persönlicheres, existentielleres Interesse; und dieses richtet sich gerade auch auf die zeitgenössische Literatur, sucht sie eben um ihrer Zeitgenossenschaft willen. Die Literatur gewinnt so einen neuen Stellenwert im Gefüge der gesellschaftlichen Institutionen, und damit wiederum neue Möglichkeiten, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Zugleich werden hier Wandlungen des gesellschaftlichen Lebens überhaupt greifbar. Daß die Literatur einen solchen Bedeutungszuwachs erfährt, setzt ja doch voraus, daß sich die Gesellschaft auf eine bestimmte Weise öffnet, daß sie nämlich jener medialen Öffentlichkeit, in der die Literatur zuhause ist, immer mehr Raum gibt und sie mehr und mehr zu dem Ort macht, an dem sich ihre Steuerdiskurse formieren.
Dies alles sind Entwicklungen, die sich schon früher im 18. Jahrhundert abzuzeichnen beginnen, die nämlich bereits von der Aufklärung auf den Weg gebracht worden sind, die aber nun, in der Goethezeit, immer stürmischere Formen annehmen, so daß hier das gesamte soziokulturelle Gefüge ein anderes wird, in das Kunst und Literatur eingestellt sind, und damit auch diese selbst. Kunst und Literatur
[<< 10]
werden institutionell autark und ideologisch autonom, ja mancherorts werden sie nun geradezu zu einer Art Religionsersatz, zum Kultobjekt einer „Kunstreligion“.
Jeder Künstler, der sich der Erinnerung der Menschen einprägen und in das kulturelle Gedächtnis eingehen will, muß wenigstens einmal im Leben eine Sensation gewesen sein, muß einmal ein Rendezvous mit dem Zeitgeist gehabt, einmal den Nerv der Zeit getroffen haben. So war es bei Goethe im Fall des „Götz“ und des „Werther“. Wohl haben einzelne seiner Werke auch später noch ein gewaltiges Echo gehabt, etwa das Drama „Iphigenie auf Tauris“ (1779 / 1787), der Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ (1795–1796), die epische Idylle „Hermann und Dorothea“ (1797), die Tragödie „Faust“ (1808 / 1833) und die Autobiographie „Dichtung und Wahrheit“ (1811–1813 / 1833), von seinen Gedichten ganz zu schweigen. Und einige von diesen Werken haben womöglich noch entschiedener und nachhaltiger auf die Entwicklung der Literatur eingewirkt als der „Götz“ und der „Werther“. So begann mit der „Iphigenie“ das Reden von einer klassischen deutschen Dichtung, begann mit „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ das Nachdenken über romantische Kunst, und der „Faust“ wurde nach Heine gar zu einer Art „Bibel der Deutschen“ (HS 5, 400), um es 150 Jahre lang zu bleiben. Aber einen solchen allgemeinen Aufstand wie mit dem „Götz“ und dem „Werther“ hat Goethe nie wieder erlebt.
In den frühen siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts also ist Goethe zur zentralen Figur des literarischen Lebens in Deutschland geworden, und er ist es bis zu seinem Tod geblieben. Zwar waren bis dahin schon zwei Generationen von jungen Autoren aufgetreten, die Goethe als überholt empfanden und sich alle Mühe gaben, ihn und sein Werk als veraltet zu brandmarken – eine erste Generation hatte sich in den neunziger Jahren zu Wort gemeldet, die Generation der Frühromantiker, der Brüder Schlegel, der Tieck und Novalis, und eine zweite in den zwanziger Jahren, die Generation Heines und der Jungdeutschen – aber sie hatten dessen Position letztlich nicht erschüttern können, ja diese hatte sich angesichts ihrer Angriffe eher weiter befestigt. So wurde Goethes Tod 1832 allgemein als das Ende einer Epoche erlebt, auch von seinen Gegnern, und zwar als das Ende einer besonders glanzvollen Epoche, als Schlußpunkt hinter dem Besten, was die deutsche Literatur bis dahin gesehen hatte.
Читать дальше