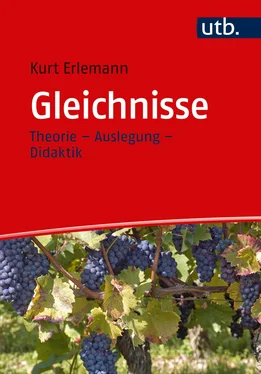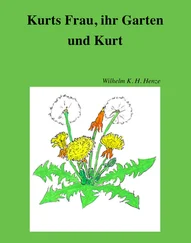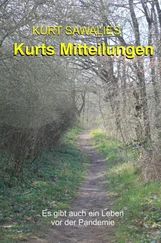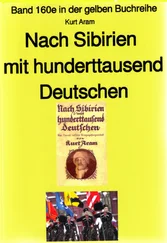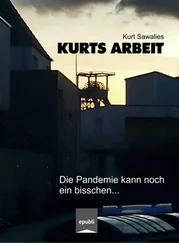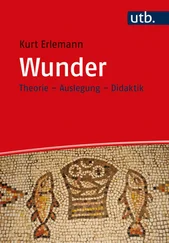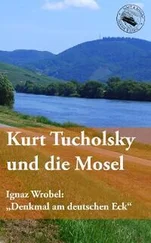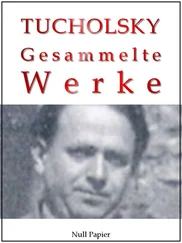1.4 Vergleichende Textformen1
Rund um die Gleichnisforschung sind einige Fachbegriffe vorab zu klären. Mehr als hundert Jahre verzweigter Forschungsgeschichte über verschiedene Fachdisziplinen hinweg führten zu uneinheitlichen Begriffsdefinitionen, so etwa die vergleichenden Textformen selbst und Jülichers formkritisch motivierte Bestimmung von Gleichnistypen.2 Andere Begriffe, wie Bildhälfte, Sachhälfte, ‚Sache‘, Sachebene, Bildwort und Gleichnisdiskurs, sind kritisch zu prüfen (→ 1.5; 2.1.3).
1.4.1 Parabel / Gleichnis / Parömie
Der Begriff Parabel (gr. parabolḗ ) ist vom griechischen Verb parabállein abgeleitet, was daneben stellen , vergleichen meint. Verglichen werden in der Parabel zwei ursprünglich unabhängige Größen oder Wirklichkeitsbereiche, die durch bestimmte Merkmale vergleichbar erscheinen (z. B. menschliche Alltagswirklichkeit und Wirklichkeit Gottes in den Reich-Gottes-Gleichnissen).
Parabel ist im Neuen Testament der gängigste Terminus für bildhaft-vergleichende, fiktionale Rede. Sie kann morphologisch äußerst unterschiedlich ausfallen; die Palette reicht von klassischen Gleichnissen über Rätselworte und Weisheitssprüche bis hin zu Vergleich und Denkspruch. So betrachtet, ist parabolḗ ein umfassender, dem biblischen Sprachgebrauch adäquater Sammelbegriff. Ihm entspricht im Deutschen der Sammelbegriff Gleichnis , wie er auch in diesem Buch Verwendung findet. Von Jülicher werden die Begriffe Parabel und Gleichnis nicht als Sammelbezeichnung verwendet; er differenziert vielmehr zwischen Gleichnis, Parabel und anderen Gleichnistypen (→ 2.1.3; 2.5.1).
Definition: Parabel / Gleichnis ist ein Sammelbegriff für bildhaft-vergleichende, fiktionale Texte aller Art (Rätselwort, Sprichwort, Vergleich, Gleichnis u. a.).1
Parömie (gr. paroimía ) ist das johanneische Pendant zu parabolḗ und bedeutet Rätselrede , Sprichwort (Joh 10,6; 16,25.29). Der Begriff impliziert die Deutungsbedürftigkeit der Rede. Der Gegenbegriff lautet parrhesía (offener, mutiger ‚Klartext‘, Joh 16,29). In diesem Band gelten die Parömien nicht als eigenständige Textform; sie werden den Identitätsgleichnissen zugeordnet (→ 2.1.3e; 2.5.7).
Definition: Parömie ist der johanneische Ausdruck für Gleichnis. Der Begriff charakterisiert die gleichnishafte Rede Jesu als deutungsbedürftige Rätselrede.
1.4.2 Fabel / Mythos / Deklamation
Mit dem Gleichnis teilt die Fabel Kürze, Fiktionalität, Anschaulichkeit, analogischen Charakter, erzählerische Geschlossenheit und das Lernziel der Plausibilisierung umstrittener Inhalte.1 Der grundlegende Unterschied ist die fehlende Realistik insbesondere der Tierfabel, was sie in die Nähe anderer surrealer Textsorten, wie Traum und Allegorie, rückt (→ 2.5.7c). Jülicher definiert die Fabel als
die Redefigur, in welcher die Wirkung eines Satzes (Gedankens) gesichert werden soll durch Nebenstellung einer auf anderm Gebiet ablaufenden, ihrer Wirkung gewissen erdichteten Geschichte, deren Gedankengerippe dem jenes Satzes ähnlich ist. [Das heißt für ihn:] Die Mehrzahl der parabolaí Jesu, die erzählende Form tragen, sind Fabeln wie die des Stesichoros und des Aesop.2
Während Gleichnisse eine religiöse Dimension haben, fehlt diese bei den Fabeln.
Definition: Eine Fabel ist eine fiktionale, bildhaft-vergleichende, bisweilen surreale Kurzgeschichte, die eine allgemeine, oft moralische Lebensweisheit vermittelt.
Ebenfalls im Bereich des Surrealen bewegt sich der Mythos .3 Der Duden definiert den Mythos als
Sage und Dichtung von Göttern, Helden und Geistern [der Urzeit] eines Volkes [bzw. eine] legendär gewordene Gestalt od. Begebenheit, der man große Verehrung entgegenbringt.4
Surreal wirken Mythen, da sie etwa Naturmächte personifizieren und Götter in Menschengestalt wunderbare Dinge tun lassen. Seit der Neuzeit werden auch biblische Wundergeschichten als Mythen gedeutet. – Mythen teilen mit Gleichnissen Fiktionalität, erzählerische Geschlossenheit und das Lernziel, eine bestimmte Wirklichkeitssicht plausibel zu machen. In dieser Wirklichkeitssicht spielen Götter eine gewichtige Rolle. Gleichwohl fallen Mythen, wie auch die Fabeln, wegen ihrer Surrealistik und anderer Merkmale aus der weiteren Betrachtung heraus.
Definition: Ein Mythos zeigt mittels einer vorgeschichtlichen, legendenhaften Erzählung über Götter und Menschen den Ursprung der geltenden Weltordnung auf.
Die Deklamation ist die formkritisch und textpragmatisch nächste Analogie narrativ ausgestalteter (Alltags-)Gleichnisse.5 Declamationes (lat.) sind antike, fiktionale Fallbeispiele für angehende Anwälte und sollen deren Argumentations- und Urteilsfähigkeit verbessern. Die Deklamation ist Teil eines Plädoyers vor Gericht und läuft auf einen im Sinne des Autors gelenkten, paradigmatischen Rechtsentscheid hinaus.6 Damit die Strategie gelingt, werden rhetorische Stilmittel zur Hörerlenkung eingesetzt, die denen narrativ ausgestalteter Gleichnisse ähneln. Hierzu gehören die Plausibilität des Geschilderten, perspektivische Darstellung zur Schaffung von Sympathie, suggestive Fragen, Emotionalität usw.7 Für die Nähe zu Deklamationen sprechen auch die juristischen Bildfelder in vielen Gleichnissen. – Paradigmatische Rechtsentscheide sind schon im Alten Testament eine beliebte Form, ein göttliches Rechtsurteil plausibel zu machen (vgl. 2 Sam 12; Jes 5,1-7). Deklamationen sind demnach nicht zwingend Prätexte für die neutestamentlichen Gleichnisse, sie unterstreichen aber deren rhetorischen Kontext.
Definition: Eine Deklamation ist ein fiktional-vergleichendes Fallbeispiel, das Rhetoren und Anwälten hilft, ihre Argumentationsfähigkeit, etwa für Plädoyers, zu steigern. Der textpragmatische Zuschnitt ist dem von Gleichnissen ähnlich.
Laut den römischen Rhetoren Cicero (106-43 v. Chr.) und Quintilian (35-100 n. Chr.) ist die Allegorie eine fortgeführte Metapher , die auf der Ähnlichkeit zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was gemeint ist, aufbaut.1 Dieses Verständnis wurde von Jülicher aufgegriffen.2 Die Definition von Allegorie wurde im Verlauf der Gleichnisforschung revidiert. Der Jülichersche Gegensatz von Gleichnis und Allegorie als ‚eigentlicher‘ bzw. ‚uneigentlicher‘ Rede wird heutzutage, unter Hinweis auf viele Mischformen sowie aufgrund der Neubestimmung der Metapher und einer präzisierten Begrifflichkeit, weithin abgelehnt (→ 2.2.1; 2.2.5).
Im vorliegenden Entwurf bezeichnet Allegorie erstens ein literarisches und nicht-literarisches Stilmittel . Allegorische Stilelemente begegnen in allen möglichen Textsorten, z.B in Romanliteratur und Lyrik, selbst in der Malerei oder in der Musik, sofern das eigentlich Gemeinte jenseits des wörtlichen Sinns bzw. des optischen oder akustischen Ersteindrucks zu suchen ist. – Zweitens gilt Allegorie nach wie vor als literarischer Gattungsbegriff. Charakteristisch sind die Dominanz verschleiernder Transfersignale (→ 1.5.9), erzählerische Surrealistik und Inkonzinnität. Allegorien sind nicht werbend-missionarisch, sondern subversiv-hermetisch ausgerichtet;3 das ist der einzige Gegensatz zu den Gleichnissen (→ 2.5.2a).
Definition: Die Allegorie ist ein literarisches oder nicht-literarisches Artefakt, das etwas anderes sagt, als es meint. Charakteristisch ist die systematische Verhüllung des Gemeinten durch Codierung und Chiffrierung. Allegorien sind tendenziell subversiv-hermetisch angelegt und richten sich exklusiv an eingeweihte Insider-Kreise.
Читать дальше