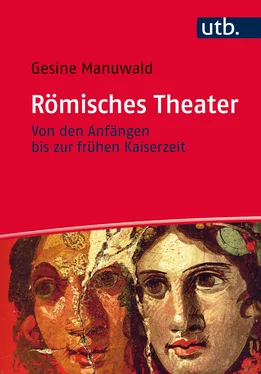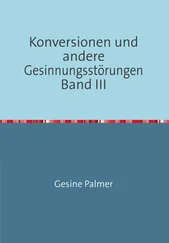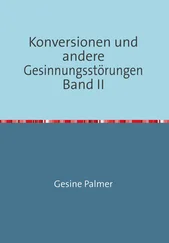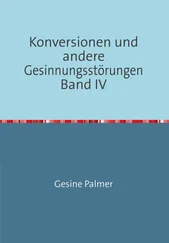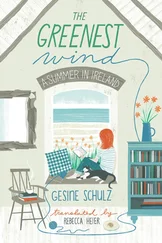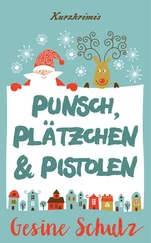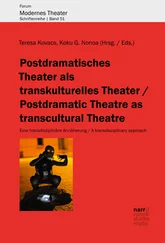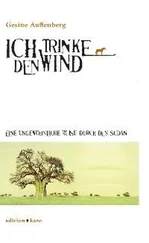Auch wenn diese Vasen damit nicht mehr Belege für einheimische komödienhafte Aufführungen in Italien sind, können sie weiterhin als Zeugen für die Beliebtheit von Theater und die Aufführungspraxis in Süditaliengelten: Sie lassen erkennen, dass es wandernde Schauspieler gab, die einfache Bühnen und Requisiten mit sich führten, und zeigen eine verbreitete Kultur mimetischer Repräsentation im vierten Jahrhundert v. Chr., die sich wahrscheinlich über die griechischen Städte Süditaliens nach Latium und Etrurien erstreckte. Weitere süditalische Vasenbilder, die essenzielle Elemente bestimmter griechischer Mythen oder identifizierbarer Szenen aus griechischen Tragödien abbilden, deuten auf die weitverbreitete Bekanntheit und Popularität der griechischen Tragödie hin. Solche Illustrationen mögen auch auf eine Einstellung zum Theater hinweisen, die sich von der im klassischen Athen unterscheidet, wo Vasenbilder in der Regel nicht bestimmte Theateraufführungen darstellten. In Süditalien hingegen wurden Dramenaufführungen als eine etablierte Kunst übernommen und nicht als Element des bürgerlichen und politischen Lebens entwickelt wie in Athen. Dramenaufführungen hatten daher eher den Status von vergnüglicher Unterhaltung, die auch als Dekoration von Vasen fungieren konnte.
Die lokale dorische griechische Komödie in Italienerhielt literarische Form im fünften Jahrhundert v. Chr. durch Epicharmus (Epicharmus, T 1, 18 Kassel/Austin). Er scheint hauptsächlich komische Stücke über mythische Helden verfasst zu haben.
Wenn man auch nicht mehr glaubt, dass die sogenannten Phlyakenvasen mit den Phlyaken-Stücken, den Vorläufern der literarischen fabula Rhinthonica , in Beziehung stehen, gab es, unabhängig davon, eine solche Form der rustikalen Komödie, die Burlesken, Travestien von Mythen, Parodien von Tragödien und alltägliche komische Szenen vorführte, wie sich aus erhaltenen Fragmenten erschließen lässt. Diese Dramenform wurde wahrscheinlich von dorischen Siedlern nach Italien gebracht und hat einige Merkmale mit der griechischen Mittleren Komödie gemeinsam. Eine literarische Form erhielt diese Art von Drama durch Rhinthon, der aus Syrakus kam und um 300 v. Chr. in Tarent tätig war. Seine Stücke waren offenbar Tragödienparodien, genannt tragikoi phlyakes , hilarotragoediae oder (später) fabulae Rhinthonicae (Rhinthon, T 1–3, 5 Kassel/Austin). Spätantike Wissenschaftler definieren fabulae Rhinthonicae als eine Form des komischen und/oder lateinischen Dramas (Don. com. 6,1; zu Ter. Ad. 7; Euanth. fab. 4,1; Lyd. mag. 1,40; [Caes. Bass.], GL VI, p. 312,7–9 [= Rhinthon, T 5 Kassel/Austin]). Diese Lokalisierung basiert wahrscheinlich auf der Beobachtung, dass Dramen dieser Art in Italien aufgeführt wurden. Es gibt jedoch keine eindeutigen Belege für die Präsenz der fabula Rhinthonica in Rom.
Ein anderer Typ unterhaltender Bühnenpräsentation, der Mimus, wurde in Italien durch Griechen im Süden und in Sizilien eingeführt: Mimen gab es in Griechenland seit der archaischen Zeit, und sie deckten ein weites Spektrum von Aufführungen ab, im Wesentlichen basierend auf Improvisation und Virtuosität. Griechische Mimen benutzten eine einfache dorische Sprache; sie beinhalteten Gesang, Tanz, Imitation alltäglicher Situationen und pantomimische Repräsentationen mythischer Szenen (z.B. Xen. symp. 9,1–7). Die Themen waren in der Regel erotisch, burlesk oder fantastisch; die Handlung spielte oft in der schlichten Umgebung durchschnittlicher Familien und Handwerker. Der Mimus wurde durch den Sizilier Sophron im fünften Jahrhundert v. Chr. literarisch, während vorliterarische improvisierte Mimen vermutlich weiterbestanden. Auch wenn der Mimus nie den Status und die weite Verbreitung der athenischen Tragöde und Komödie erreichte, wurde er als ein unabhängiges dramatisches Genre geschätzt und überlebte lokal. Vom dritten Jahrhundert v. Chr. an wurde der Mimus über die dorischen Siedlungen in Süditalien und Sizilien in ganz Italien bekannt (▶ Kap. 4.6).
Bei den Oskern gab es ebenfalls eine Version des populären leichten Dramas, fabula Atellana , benannt nach der oskischen Stadt Atella in Kampanien, wo diese Gattung nach den Angaben späterer römischer Autoren herkam (Liv. 7,2,11–12 [▶ T 1]; Val. Max. 2,4,4; Diom. ars 3, GL I, pp. 489,14–490,7; Euanth. fab. 4,1). Die oskische Atellane scheint ursprünglich eine burleske Farce gewesen zu sein, die merkwürdige Erlebnisse stereotyper komischer Figuren zeigt (Tac. ann. 4,14,3). Schon die Typen verweisen auf einen derben Charakter und einen auf Lächerlichkeit abzielenden Inhalt. Ursprung und Details der Einführung der Atellane in Rom sind unsicher: Sie mag sich unter dem Einfluss von Formen des griechischen leichten Dramas entwickelt haben, und es ist vermutet worden, dass oskische Handwerker, vor allem Walker, die Atellane im Verlauf des dritten Jahrhunderts v. Chr. nach Rom gebracht haben (▶ Kap. 4.5).
Im frühen Rom gab es die sogenannten Fescenninischen Verse, wahrscheinlich benannt nach der faliskischen Stadt Fescennia. Dabei handelt es sich um improvisierte und responsive Wechselgesänge in Versen mit Spott und Scherz. Sie wurden als rustikal betrachtet und besonders bei Hochzeiten oder Erntefesten aufgeführt; ursprünglich scheinen sie apotropäische Funktion gehabt zu haben (Liv. 7,2,7 [▶ T 1]; Hor. epist. 2,1,145–149; Porph. zu Hor. epist. 2,1,145; Fest., p. 76 L.; Macr. Sat. 2,4,21; Serv. zu Verg. Aen. 7,695; Diom. ars 3, GL I, p. 479,13).
Als erstmals Dramen in Rom aufgeführt wurden, die nach einer griechischen Vorlage gestaltet waren, werden die Römer also bereits sowohl eine eigene Bühnentradition gehabt haben als auch mit anderen italischen Traditionen in Berührung gekommen sein. Dabei handelt es sich eher um burleske, komische, improvisierte Aufführungen, mit einer bedeutsamen Rolle von Musik und Tanz, drastischen und einfachen Kostümen und einer schlichten Bühne, aber ohne eine lineare narrative Handlung. Das (im Vergleich zum griechischen Drama) verstärkte musikalische Element in der literarischen Komödie in Rom und die Vorliebe für Szenen mit Situationskomik werden häufig als Reflexionen des populären italischen Dramas angesehen.
2.4. ‚Literarisches‘ Drama in Rom
Die Römer haben sich selbst mit der Frage beschäftigt, wie es dazu kam, dass in ihrer Kultur das ‚römische literarische Drama‘ entstand. Die ausführlichsten, aber auch schwierigsten Quellen für das vorliterarische und frühe literarische Drama in Romsind ein Kapitel bei dem Historiker Livius (Liv. 7,2 [▶ T 1]) und die parallele, jedoch leicht abweichende Darstellung bei Valerius Maximus (Val. Max. 2,4,4), die wahrscheinlich beide auf Werke des spätrepublikanischen Gelehrten Varro zurückgehen (vgl. auch z.B. Hor. epist. 2,1,139–167; Aug. civ. 2,8; Oros. 3,4,5; Tert. spect. 5,5; Plut. qu. R. 107 [289D]). Elemente des von Livius geschildeten Ablaufs stimmen überein mit Informationen in anderen literarischen Quellen oder mit dem, was generell für das Aufkommen dramatischer Aufführungen plausibel ist. Auch wenn Details des Szenarios auf Rekonstruktionen von Interpreten aus spätrepublikanischer und frühaugusteischer Zeit basieren, mag eine solche Darlegung einen Kern authentischer Information enthalten.
Livius beschreibt, wie zunächst als Reaktion auf eine Pestepidemie 364 v. Chr. in religiös motivierter Absicht etruskische Tänzer nach Rom geholt wurden, wo Schauspiele außerhalb des Circus vorher nicht bekannt waren, sich dann allmählich in Auseinandersetzung mit bestehenden Traditionen die verschiedenen Formen des republikanischen Dramas entwickelten und das Theater in Rom zu einer einflussreichen Einrichtung wurde.
Читать дальше