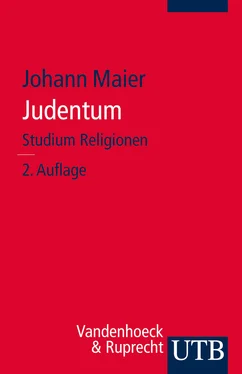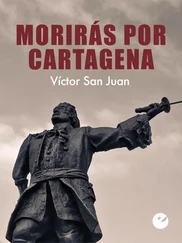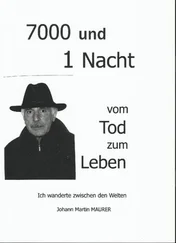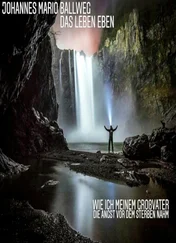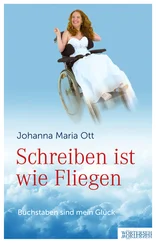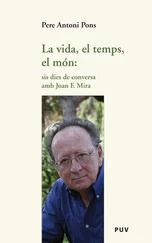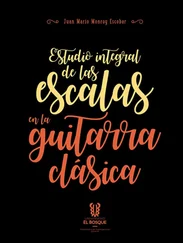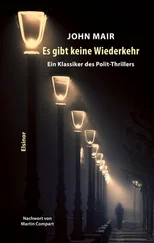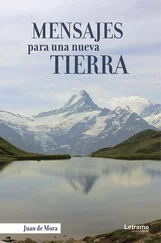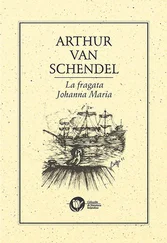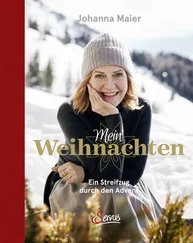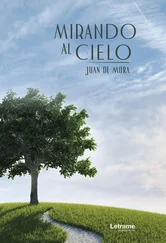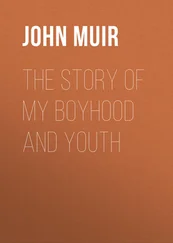Johann Maier - Judentum
Здесь есть возможность читать онлайн «Johann Maier - Judentum» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Judentum
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Judentum: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Judentum»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Judentum — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Judentum», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
In Ex 3,14 beantwortet Gott die Frage des Mose nach dem Namen mit ′ähjäh ′ ašär ,ähjäh, wörtlich übersetzt, etwa: »Ich werde sein, der ich sein werde«. Man hat den Nahmen JHWH von diesem Verb hjh (werden, sein) her zu erklären versucht. Und weil es in Ex 3,14 danach heißt: »′ähjäh hat mich zu euch geschickt«, wurde auch ,ähjäh für sich als Gottesname verstanden. In der Kabbalah bezeichnete man damit die erste Sefirah, die erste Wirkungsweise bzw. Seinsstufe, die aus der verborgenen Gottheit emaniert, und aus der wieder alle weiteren neun Sefirot und alles darunter emanieren, während JHWH für die zentrale sechste Sefirah verwendet wurde, ′ el für die vierte Sefirah (absolute Güte) und ′ älohîm für die fünfte h(absolute Strenge), ′ ädonaj (Herr) für die zehnte.
1.7 Die Erschaffung des Menschen, die Gottebenbildlichkeit und die Natur des Menschengeschlechts
Der priesterliche Schöpfungsbericht setzt die Erschaffung des Menschen auf den letzten Tag der Schöpfungswoche an, den Freitag. Gen 1,26 spricht dem Menschen eine stellvertretende Herrschaftsfunktion über die Schöpfung zu, daher fungiert als Abbild bzw. Repräsentation des Herrschers. Und zwar Mann und Frau zusammen, als »männlich und weiblich«, ohne erkennbare Abstufung (Gen 1,26 f) und als Abschluss der mit »sehr gut« bewerteten Schöpfung (Gen 1,31). 18 Diese schöpfungsmäßige Gleichheit begründete aber keine sozialrechtliche Gleichstellung, denn in der kultischen Tradition wurde die Position der Frau gegenüber jener des Mannes merklich herabgestuft. In der älteren und noch recht mythisch gestalteten Schöpfungserzählung (Gen 2,4b–25) erscheint Eva von vornherein als ein dem Adam beigeordnetes Geschöpf. Rolle und Status der Frau konnten im Judentum daher schöpfungstheologisch nicht einheitlich begründet werden.
Der Sündenfall im Paradies führt zum Verlust der Ebenbildlichkeit, die im Gehorsam gegenüber Gottes Willen begründet ist, und darum wird vorausgesetzt, dass die Torah-Offenbarung am Sinai die Ebenbildlichkeit für Israel(iten) potentiell wiederbringt (s. Reader, Nr. 3).
Der Begriff Ebenbild Gottes setzt aber nicht nur die Gottähnlichkeit des Menschen, sondern auch die Menschenähnlichkeit Gottes voraus, und das verursachte heftige Auseinandersetzungen. Ihre Verfechter wussten sich v. a. durch die prophetischen Visionsberichte in Jes 6 und in Ez 1–3 bestätigt, in denen Gott bzw. die Erscheinung seiner Gegenwart (kabôd, später: š ekînah) im Heiligtum als überdimensionale Königsgestalt thront. Doch gab es schon früh Tendenzen, Gottes Übermenschlichkeit und Überweltlichkeit deutlicher hervorzuheben, und biblische Passagen, in denen Gott körperliche und psychische Eigenschaften und Verhaltensweisen (Anthropomorphismen und Anthropopathismen) zugeschrieben werden, als bildliche Rede zu verstehen. Für die Volksfrömmigkeit verbürgte eine solche Redeweise zusammen mit der Vorstellung eines persönlichen Gottes die Gottesnähe. Wann immer aber unter Juden philosophische Bildung zum Zug kam, wurde der Widerspruch zur Vorstellung einer transzendenten Gottheit bewusst und entsprechend thematisiert. Im 13./14.Jh. n.Chr. entbrannten darüber so heftige Kontroversen, dass es fast zu einem Schisma kam. Der Kabbalah des Mittelalters gelang es, diesen Konflikt aufzulösen, indem sie an der absoluten Transzendenz der Gottheit selbst festhielt und die anstößigen biblischen Aussagen auf die aus der transzendenten Gottheit emanierenden zehn Sefirot (Wirkungskräfte der Gottheit) bezog. Damit konnte der Wortsinn der betroffenen Bibeltexte unbeschadet der anderen (drei) Schriftsinne beibehalten werden.
1.8 Paradies und Sündenfall
Der »sehr gute« Urzustand, versinnbildlicht durch den Garten von Eden, wird durch die Übertretung des göttlichen Gebots beendet. 19 In der Folge muss sich der Mensch durch Arbeit ernähren, mit unsicherem Erfolg, weil der Acker verflucht ist, und wegen der eingetretenen Sterblichkeit muss er sich – mit besonderen Risiken für die Frau – fortpflanzen. Das aber wird nicht nur auf das erste Menschenpaar zurückgeführt, denn da war noch die Schlange, im späteren Verständnis der Satan, eine Macht, die den Menschen versucht und verleitet. 20 Die neuen Zwänge des Daseins, das Wissen um Gut und Böse, somit die Notwendigkeit moralischer Entscheidungen und die Unentrinnbarkeit der Verantwortung bestimmen die menschliche Existenz nach dem missglückten Versuch, »wie Gott« zu werden. Kennzeichnend für diesen neuen Normalzustand ist der Brudermord Kains an Abel und die Rückführung zivilisatorischer »Errungenschaften« auf die Kainiter. Der stufenweise Niedergang der Menschheit wird überdies auch mit abnehmenden Lebensalterdaten markiert.
In alter Zeit hat man von zwei Geistern gesprochen, die im Menschen um den Menschen ringen und zwischen denen man sich entscheiden muss, auch wenn sehr viel einfach vorgegeben bzw. determiniert ist, vor allem auch durch den Einfluss der Gestirnsmächte. 21 In der talmudischen Literatur begegnet dafür die Rede von zwei Veranlagungen, einem guten und einem schlechten Trieb (jeçär ţôb und jeçär ra`), wobei der »schlechte Trieb«, wenn er im Torahgehorsam unter Kontrolle gehalten wird, auch positiv zur Wirkung gebracht werden kann, nämlich im Sinne berechtigter Selbsterhaltung und gebotener Fortpflanzung. Mittel und Wegweisung bei solchen Entscheidungen, die Grundlage des jüdischen Ethos, ist natürlich die Torah. 22
Die Paradieserzählung mit dem Sündenfall (Gen 2–3) und der Totschlag des Kain an seinem Bruder Abel (Gen 4,1–16) markieren die Zäsur zwischen dem »sehr guten« Urzustand und den späteren Verhältnissen. 23 Die ersten Errungenschaften der Zivilisation und die Gründung von Städten, im Alten Orient ein festes Thema, wurden in der Bibel im Rahmen des Kainiterstammbaums aufgeführt (4,17–24) und skeptisch beurteilt; zusammen mit fragwürdigen Künsten wie Magie, Kosmetik und Waffentechnik. 24 Diese zunehmende Verderbnis wurde freilich auch durch übermenschliche Mächte mitverursacht (Gen 6,1–4; vgl. Hen 6–11; Buch der Giganten). 25 Schließlich endet die schematisch konstruierte Generationenfolge von Adam bis Noah (Gen 5) beinahe in der Sintflut (Gen 6–9), ebenfalls ein altes, weit verbreitetes Motiv. 26 Die Bewertung der Urgeschichte ist also vernichtend: einzig Noah überlebt mit seiner Familie die Katastrophe. Alles Weitere steht schöpfungstheologisch gesehen nicht mehr unter dem Prädikat »sehr gut«, doch für Israel bietet die Torah einen Heilsweg und begründet die Hoffnung auf eine Restitution des Urzustandes am Ende der Geschichte bzw. die Erwartung einer Neuschöpfung.
1.9 Das Wissen der Vorzeit
Abgesehen vom Kainiterstammbaum (Gen 4,17 ff) behaupten Überlieferungen, die in Gen 6,1–4 knapp angedeutet und in anderen Kontexten (wie Hen 1–36) breiter ausgeführt werden, dass die Entwicklung der Menschheit maßgeblich durch ein Wissen bestimmt wird, das ambivalent bis negativ zu werten ist. Vor allem, weil ein Teil dieses Wissens durch gefallene Engel vermittelt wurde. Dem gegenüber stehen positive Wissenstraditionen, die von der Urzeit her über die Sintflut hinweg weitergegeben werden konnten. Auch dies beruht auf verbreiteten altorientalischen Vorstellungen. 27 Das positive Wissen wurde teils von Adam her über Set weitergegeben, teils auf den Urvater Henoch (Gen 5,21–24; Jub 4,16–26; Henoch-Bücher), der sie von seinem Aufenthalt in himmlischen Regionen mitgebracht haben soll. Dahinter steht der Anspruch einer Bildungselite, von Schreibern, die vorrangig an Heiligtümern wirkten, also an Orten, deren mythische Qualität sowieso eine enge Beziehung zwischen himmlischem und irdischem Kultpersonal voraussetzte. Die Henochfigur wurde für die Folgezeit zum Inbegriff einer Bildungstradition, für die überirdischer Ursprung und eine Kontinuität von der Urzeit her behauptet wird. 28 Henochs Lebensjahre, 365, entsprechen der Zahl der Tage des natürlichen Jahres fast genau, in den Kalendersystemen war aber diese schlecht teilbare Zahl nicht praktikabel anwendbar. Man wusste um diesen richtigen Sachverhalt und damit auch um die Unzulänglichkeit der gängigen Systeme. Der Gedanke, dass die Urverderbnis der Menschen eine gewisse Unordnung in der Schöpfungsordnung bewirkt hat, lag also nahe. Umso wichtiger erschien die Kontinuität einer Tradition dank einer genealogischen Reihe von Auserwählten, die das positive Urwissen kennen, das mit der »vollkommenen Torah« in eins fällt und auf »himmlischen Tafeln« von ewig her und auf immer festgeschrieben ist. Es ging dabei nicht nur um Spekulationen, sondern um die Begründung und Verteidigung von bestehenden Ordnungen und Ansprüchen. Das hat einen gewissen Zwang zur Systematisierung mit sich gebracht und in der Folge zu mehr oder weniger geschlossenen Weltbildern geführt. In der Spätantike bot die Stoa dafür Parallelerscheinungen, die man kaum als fremd empfinden konnte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Judentum»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Judentum» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Judentum» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.