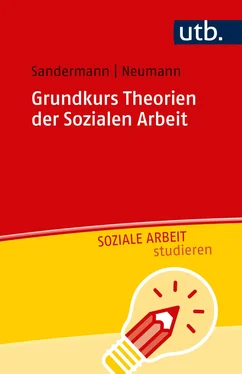In der Sozialen Arbeit hat es wie auch in ihren Nachbardisziplinen, immer wieder Versuche gegeben, solche „Technologien“ zu entwickeln oder Theorien mit einem technologischen Anspruch zu versehen.

So findet man Beispiele für Theorien mit technologischem Anspruch etwa im Kontext von Schule und Lehrerbildung. Hier gibt es eine Vielzahl von allgemein- und fachdidaktischen Ansätzen der Schulpädagogik, in denen es ausdrücklich darum geht, Technologien des Lehrens und Lernens zu konzipieren, die ganz auf die Rationalisierung der Wissensvermittlung im Unterricht ausgerichtet sind. Und auch in der Sozialen Arbeit wird man fündig, wenn es um technologische Modelle geht. Ein geläufiges Beispiel hierfür ist etwa die Diskussion um Methoden der Sozialen Arbeit. Die Grenze zwischen strukturierten, d. h. zunächst einmal auf eine Strukturierung des Handelns von Professionellen ausgerichteten Vorgehensweisen, und technisierten Vorgehensweisen, die mit der Vorstellung verbunden sind, man könnte durch bestimmte Handlungsabläufe gewünschte Effekte bei AdressatInnen des professionellen Handelns erreichen, sind hier fließend (Galuske 2013). Ein weiteres Beispiel bieten Ansätze einer sog. „evidenzbasierten Sozialen Arbeit“ (Otto et al. 2009; Otto et al. 2010a). Sie operieren mit dem Versprechen, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse das praktische Handeln in der Sozialen Arbeit zumindest mittelbar wirkungsvoller zu machen, indem sie es mit Manualen und festgelegten Organisationsabläufen flankieren, die sich als angeblich „erfolgreich“ in Bezug auf vorher festgelegte Kriterien herausgestellt haben. Und zuletzt gibt es jenseits der Diskussion um Methoden sogar technologisch-empiristische Theorieprogramme der Sozialen Arbeit, die sich als praxisanleitende Theorien sozialarbeiterischen Handelns verstehen (Rössner 1975). Diese haben sich aber im engeren Diskurs um Theorien der Sozialen Arbeit bisher kaum durchgesetzt.
Die Vorstellung, wissenschaftliches Wissen – und demzufolge auch Theoriewissen – könnte Handlungsanleitungen für die Soziale Arbeit bieten, ist also durchaus verbreitet. Allerdings ist diese Vorstellung dort, wo es um „Theorien der Sozialen Arbeit im engeren Sinn“ (Füssenhäuser/Thiersch 2015, 1743) geht, in der Regel nicht zu finden. Diese zielen stattdessen auf etwas Anderes, und zwar
„auf die Klärung des Status der Sozialen Arbeit, ihres Gegenstandsund Aufgabenbereichs und ihrer gesellschaftlichen Funktion, ihrer geschichtlichen Selbstvergewisserung und ihrer Positionierung im Kontext anderer Disziplinen und der Anforderungen der Praxis“ (Füssenhäuser/Thiersch 2015, 1743).
Es wird deutlich: Der Abstraktionsgrad, mit dem Theorien der Sozialen Arbeit ansetzen, ist ziemlich hoch. Zu klären sind hier offenbar eher Fragen von recht allgemeinem Interesse, wo es um ein angemessenes Verständnis von Sozialer Arbeit geht. Somit wäre es zugleich ein Missverständnis davon auszugehen, man könnte in Theorien der Sozialen Arbeit Anweisungen finden, die sich in ganz konkreten, und damit hoch besonderen Situationen der Praxis wie Rezepte anwenden ließen. Auch wäre es ein Missverständnis, wenn man davon ausginge, dass Theorien der Sozialen Arbeit die konkrete, besondere Praxis in allen ihren Facetten und spezifisch lokalen Bedingungen überhaupt ganz exakt widerspiegeln, oder gar vorhersagen könnten. Stattdessen geht es in Theorien der Sozialen Arbeit eben genau darum, das Allgemeingültige (und nicht das Besondere) an „der Sozialen Arbeit“ begreifbar zu machen. Es geht ihnen – anders gesagt – darum, die Komplexität und Vielfältigkeit möglicher Beobachtungen zu Sozialer Arbeit weitestgehend zu reduzieren. Im Ergebnis zielen die Theorien damit auf weniger genaue, dafür aber breiter verallgemeinerbare Aussagen zur Sozialen Arbeit. Damit entfernen sie sich zugleich systematisch von möglichst exakten Technologien für Einzelfallprobleme, und interessieren sich stattdessen für „Soziale Arbeit als Ganzes“ (Borrmann 2016). In Anlehnung an den von C. Wright Mills (1959) geprägten Begriff der „Grand Theories“ haben wir Theorien der Sozialen Arbeit daher an anderer Stelle auch schon als „Großtheorien“ bezeichnet (Sandermann/Neumann i.E.; kritisch auch schon Winkler 2005, 19).
Es liegt somit keineswegs an schlichtem Unvermögen, wenn Theorien der Sozialen Arbeit keine Technologien liefern. Zum einen lässt sich mit guten Gründen behaupten, dass Theorien insgesamt und jenseits der in diesem Buch besprochenen Theorien wenig taugen für die Ableitungen von Technologien und Rezepten (Knorr-Cetina 2007). Viel entscheidender ist für die vorliegende Einführung jedoch, im Auge zu behalten, dass Theorien der Sozialen Arbeit solche Technologien eben gar nicht bieten wollen. Das heißt auch, dass jede Theorie, die im Rahmen des vorliegenden Buches dargestellt wird, am Ende vor allem möglichst verallgemeinerbare Aussagen zur Sozialen Arbeit bietet, und sich aus diesem Grund als Material für eine Suche nach möglichst exakten Rezepten für konkrete Einzelsituationen denkbar schlecht eignet.

Wir wollen das noch einmal auf unser anfängliches Beispiel aus der Schulstation übertragen. Sucht man in einer Theorie der Sozialen Arbeit nach Rezepten oder eindeutigen Hinweisen dazu, wie die Schulsozialarbeiterin X mit dem Schulverweigerer Y in der Schulstation Z verfahren soll, findet man hier höchstwahrscheinlich: Nichts. Stattdessen ist es schon wahrscheinlicher, dass man hier auf Antworten zur Frage stößt, ob Schulstationen eigentlich als Teil der Sozialen Arbeit zu verstehen sind, und falls ja oder nein, inwiefern und warum das so gesehen werden kann. Was die konkrete Rolle von Schulsozialarbeiterinnen im Umgang mit schuldevianten jungen Menschen angeht, könnte es indessen schon wieder schwieriger werden. Denn es ist wahrscheinlich, dass die Theorie der Sozialen Arbeit, in die man hineinliest, nur an äußerst wenigen oder sogar gar keinen Stellen Beispiele aus dem Bereich der Schulsozialarbeit nutzt, weil Schulsozialarbeit im Lichte dieser Theorie eben nur ein Teilgebiet dessen ist, wozu allgemeine Aussagen getroffen werden: Soziale Arbeit.
Heißt das nun aber im Umkehrschluss nicht doch, dass Theorien der Sozialen Arbeit letztlich völlig wertlos sind für jemanden, der sich für praktisches Handeln in der Sozialen Arbeit interessiert? Handlungssituationen kommen doch immer als konkrete und damit per se als einzelfallbezogene, und nicht als allgemeine Probleme daher. Was bringen dann Theorien, die sich scheinbar nicht für konkrete Lösungen, sondern nur für Allgemeines interessieren?
Diese Fragen sind durchaus berechtigt, und interessanterweise werden sie auch von WissenschaftlerInnen immer wieder gestellt. Das Gegenmodell, das gegen solche „Großtheorien“ ins Spiel gebracht wird, sind sog. „Middle Range Theories“, welche in ihrem Begriff auf den amerikanischen Soziologen Robert K. Merton (1968) zurückgehen.

Unter Middle Range Theories, im Deutschen meistens benannt als Theorien mittlerer Reichweite, versteht man Theorien, die bewusst ein nur mittleres Maß an Abstraktion anstreben und somit relativ nah an einer Beschreibung von empirischen Beobachtungen bleiben. Die Vorteile dieser Theorien mittlerer Reichweite bilden zugleich ihre Nachteile. Durch ihr höheres Maß an Konkretheit taugen sie einerseits für eine detailliertere Abbildung der beobachteten Zustände sowie für weitergehende Ableitungen von Prognosen und Technologien für den erforschten Bereich. Andererseits macht sie das weniger übertragbar auf andere als die konkret von ihnen erklärten Zustände.
Читать дальше