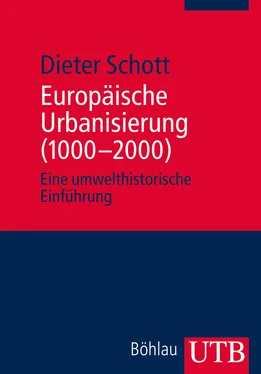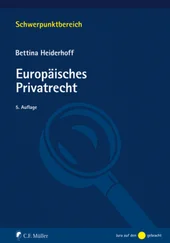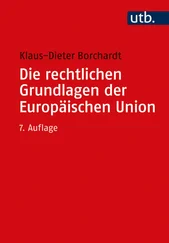Dieter Schott - Europäische Urbanisierung (1000-2000)
Здесь есть возможность читать онлайн «Dieter Schott - Europäische Urbanisierung (1000-2000)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Europäische Urbanisierung (1000-2000)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Europäische Urbanisierung (1000-2000): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Europäische Urbanisierung (1000-2000)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Herausbildung einer vielgestaltigen Städtelandschaft seit dem Hochmittelalter war ein fundamentaler Prozess der europäischen Geschichte. In dieser Einführung werden die wesentlichen Voraussetzungen, Erscheinungsformen und Folgen der Urbanisierung dargestellt. Zentral ist dabei die Frage nach den Umweltbeziehungen der Städte. Der Prozess der Urbanisierung in seinen umwelthistorischen Zusammenhängen wird hier am Beispiel führender Städte Europas nördlich der Alpen erläutert.
Europäische Urbanisierung (1000-2000) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Europäische Urbanisierung (1000-2000)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Für Flandern und die Niederlande, eine der im Spätmittelalter am stärksten urbanisierten Regionen Europas nördlich der Alpen, zeigt Richard Unger, dass angesichts der nach der Pest zunächst deutlich zurückgegangenen Bevölkerung die Getreideversorgung weitgehend aus der Region erfolgen konnte.36 Gleichwohl wurde die bereits vor 1350 in Ansätzen etablierte Fernversorgung mit Getreide nicht aufgegeben. Schon vor der Pest kamen substanzielle Getreidelieferungen aus der Altmark an der Elbe über [<<77] Hamburg in die flandrischen Städte.37 Als gegen Ende des 15. Jahrhunderts klassische Versorgungsregionen für Flandern und die Niederlande, etwa die Normandie, wegen wieder wachsender Bevölkerung nur geringere Überschüsse für die Bedarfsgebiete Flanderns zur Verfügung hatten, setzte in größerem Maße der Getreidefernhandel nach Flandern wieder ein: Bezugsquellen waren zum einen Süddeutschland im Einzugsbereich schiffbarer Flüsse, zum anderen Getreideanbaugebiete mit Wasseranschluss im Einzugsgebiet der Ostsee. Dass der flämische Getreidemarkt so weit reichte, zeigt ein nachweisbarer Gleichklang in der Fluktuation der Getreidepreise zwischen den großen Getreidemärkten in Frankfurt, Straßburg, Rostock und den südenglischen und den niederländischen Städten, wobei in den Niederlanden die Preisausschläge stets am höchsten waren. Unger interpretiert diese Preismuster als Anzeichen einer regen Spekulation mit Getreide in den niederländischen Städten, wobei die Spekulation auch vielfältige Maßnahmen der Städte zur Regulierung des Getreidehandels provozierte. Andererseits akzeptierten Stadtregierungen die Notwendigkeit hoher Getreidepreise, denn dadurch strömte auch in Mangeljahren ausreichend Nachschub in die Niederlande. Ein weiteres Motiv für Entwicklung eines Getreidefernhandels, obwohl die weitere Region die Versorgung hätte eigentlich sichern können, waren die Handelsinteressen: Flandern baute in erheblichem Umfang Handelsbeziehungen in die Ostsee hinein auf. Dort traten zunehmend an die Stelle der Hanse flandrische Schiffe, die Waren etwa aus dem Mittelmeerraum in die Ostsee brachten; diese benötigten auch eine Rückfracht, z. B. Getreide. Das „Getreidehinterland“ von Flandern und den Niederlanden war also im Spätmittelalter in der Masse immer noch einigermaßen regional begrenzt, aber die Konturen eines international integrierten Getreidemarkts zeichneten sich bereits im späten 15. Jahrhundert ab; im 17. Jahrhundert sollte der Getreideimport aus der Ostsee nicht nur für die Niederlande, sondern auch für Westeuropa, vorübergehend auch für Südeuropa in größerem Umfang dann sehr wichtig werden.38
Jenseits der hochgradig verstädterten Landschaften versorgten sich jedoch die meisten europäischen Städte aus einem weiter gezogenen Umland; für Köln (40.000 Einwohner im späten 15. Jahrhundert), das über ein sehr fruchtbares Umland links des Rheins verfügte, reichte ein Gebiet von 1800 qkm zur Versorgung mit Getreide, während Nürnberg (28.000 Einwohner Ende 15. Jahrhundert) mit wesentlich schlechteren Böden im nahen Umland ein Getreideversorgungsgebiet von rund 5000 km² [<<78] benötigte.39 Im Spätmittelalter setzte an vielen Orten auch schon die planmäßige Bevorratung von Getreide seitens der städtischen Obrigkeit, der Bau von Kornspeichern und Magazinen ein. Neben gewissen Anfängen im 14. Jahrhundert wurden besonders seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als die Bevölkerung wieder deutlich wuchs, Kornspeicher errichtet, die dann in Mangeljahren zum Ausgleich, vor allem zur Versorgung der ärmeren Stadtbevölkerung, dienten. In Hungerkrisen war die städtische Bevölkerung in der Regel „erheblich besser gestellt als die Landbewohner.“40
4.4 Die Fleischversorgung der Stadt
Fleisch war nicht die Hauptquelle der Ernährung mittelalterlicher Stadtbewohner, aber der Konsum war durchaus nennenswert. Als Folge der Pest erhöhte sich auch in der breiten Stadtbevölkerung dank steigender Reallöhne der Fleischkonsum beträchtlich und erreichte im 15. und frühen 16. Jahrhundert ein Niveau, das erst im späten 19. Jahrhundert wieder erreicht wurde. Man kann von einem Fleischverbrauch von rund 50 kg pro Kopf und Jahr in deutschen Städten ausgehen, in mediterranen Städten lag dieser Wert üblicherweise deutlich niedriger. Köln benötigte 8000 Stück Schlachtvieh pro Jahr.41
Mittelalterliche Städte waren selbst Orte der Fleischproduktion: Die Zahl städtischer Viehhirten, die das Vieh der Bürger auf die Weiden außerhalb der Stadt führten, aber auch Angaben über städtisches Vieh, das von Raubrittern geraubt wurde, lassen auf erhebliche Bestände an Vieh in und unmittelbar um die Stadt schließen.42 Städtische Obrigkeiten waren bestrebt, die Fleischversorgung auf einem gewissen Niveau zu st [<<80] abilisieren. So zwang der Frankfurter Rat etwa die örtlichen Bäcker, Schweine mit der Kleie, den Schalen der Körner, die beim Mahlen anfallen und die die Bäcker von den Müllern zusammen mit dem Mehl erhielten, zu füttern. Damit sollte verhindert werden, dass die Bäcker die Kleie mit dem Mehl zu (minderwertigem) Brot verbackten. Die aus dieser Mast hervorgehenden Schweine durften nur an Mitbürger und nicht an die Metzger verkauft werden. Das Recht jeden Bürgers auf eigene Schlachtung wurde von den Räten verteidigt, teilweise durften die Metzger zu Zeiten, wenn die Bürger ihre „Bürgerschlacht“ wahrnahmen, in Frankfurt meist im Oktober um den Gallustag (16. Oktober), selbst nicht als Aufkäufer auf den Viehmärkten auftreten.43 Städtische Metzger und Viehhändler erhielten regelmäßig Kredite seitens der Stadt, um Vieh auswärts aufkaufen und dem städtischen Markt zuführen zu können.44
Diese lokalen Bestände deckten den Fleischbedarf größerer Städte aber in keiner Weise. Regionale Viehbestände spielten von daher eine wichtige Rolle zur Deckung städtischen Bedarfs; so standen jede Woche Hunderte von Rindern aus Viehzuchtgebieten des Burgund und der Franche-Comte auf dem berühmten Viehmarkt in Sennsheim im Elsass zum Verkauf, wo sich zahlreiche Städte des Oberrhein-Gebiets versorgten.45 Darüber hinaus entwickelte sich, vor allem seit dem späten 15. Jahrhundert, ein System europaweiter Arbeitsteilung: Dünner besiedelte Gebiete an der Peripherie Europas spezialisierten sich auf Viehzucht und versorgten die verstädterten Regionen Nordwest- und Südeuropas, in deren Nähe wegen der transportwirtschaftlichen Zwänge der Getreideanbau dominieren musste, mit Fleisch. Vorrangig gehandelt wurden Ochsen, die auf langen Viehtrieben aus den Aufzuchtgebieten in die Absatzgebiete getrieben wurden. Im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert hatten noch Ochsen aus Ungarn den Fernhandel mit Vieh dominiert; von dort wurden diese regelmäßig nach Venedig, aber auch nach Frankfurt und Aachen getrieben. Als ab etwa 1460/70 wegen des Bevölkerungsdrucks im dichter besiedelten Mittel- und Westeuropa verstärkt wieder Viehweiden in Ackerland umgewandelt wurden, formierte sich ein dauerhaftes System, in dem sich neben Ungarn auch andere Lieferregionen etablierten. So kamen aus Dänemark seit den 1480er-Jahren regelmäßig über 10.000 Rinder über die Elbe, wurden dann weiter auf den Marschen in der Nähe der Nordsee gemästet und dann schließlich auf die Märkte in Küstennähe, aber auch in [<<80] die südlichen Niederlande und bis Mitteldeutschland getrieben. Mitte des 16. Jahrhunderts erreichte dieser Strom fast 50.000 Tiere pro Jahr.46 War der Absatz dänischer Rinder vor allem auf den norddeutsch-niederländischen Bereich beschränkt, so fanden ungarische Rinder, die ab 1470 wieder verstärkt auf dem Markt auftauchten, den Weg in Städte südlich des Mains, aber auch nach Venedig und Norditalien. In den frühen 1570er-Jahren wurden rund 100.000 Tiere jährlich aus Ungarn exportiert. Eine dritte internationale Fleischquelle war Polen: Von dort kamen zwischen 20.000 – 40.000 Tiere pro Jahr; sie wurden aus Masuren über Posen nach Leipzig und Dresden getrieben, um Absatzmärkte in Norddeutschland und Böhmen zu erreichen. Erst im späten 16. Jahrhundert, nachdem Polen die Ukraine erobert hatte und eine andere, auf den ukrainischen Steppen heimische und zähere Rinderart exportiert wurde, stieg der polnische Ochsenexport deutlich an und eroberte sich größere Marktanteile. Städte versuchten häufig, ihre Bezugsquellen zu diversifizieren, um nicht ausschließlich von einem Liefergebiet abhängig zu sein; so wurde Frankfurt etwa vorwiegend aus Ungarn versorgt, zugleich erhielt man aber bis ins 18. Jahrhundert substanzielle Lieferungen auch aus dem Norden, aus Polen und Dänemark.47
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Europäische Urbanisierung (1000-2000)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Europäische Urbanisierung (1000-2000)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Europäische Urbanisierung (1000-2000)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.