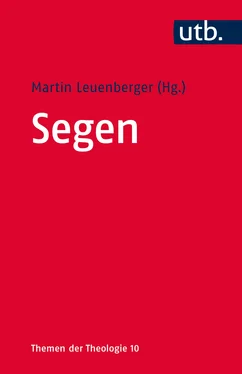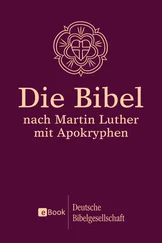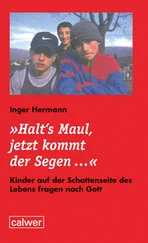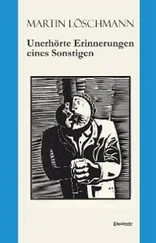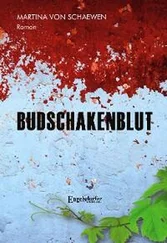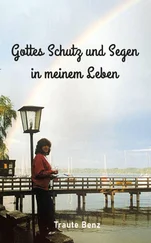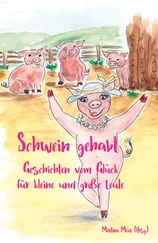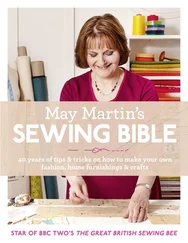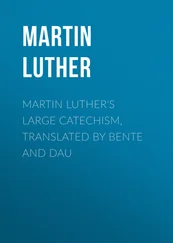Martin Leuenberger - Segen
Здесь есть возможность читать онлайн «Martin Leuenberger - Segen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Segen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Segen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Segen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der vorliegende Band geht unterschiedlichen Segensvorstellungen in religionswissenschaftlicher, biblisch-historischer, judaistischer, kirchengeschichtlicher sowie systematisch- und praktisch-theologischer Perspektive nach.
So bietet er einen interdisziplinären Einblick in den gegenwärtigen Forschungsstand, der Theologie, Kirche und Gesellschaft zur Beschäftigung mit dem lebensweltlich ebenso grundlegenden wie attraktiven Thema einladen will.
Segen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Segen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die reformatorische Neubewertung des Segens wird an Luther aufgezeigt: Er akzentuiert »exegetisch, liturgisch und frömmigkeitspraktisch den Segen als gute Gabe Gottes« (S. 152), wobei er unterscheidet: »Während der leibliche oder irdische Segen die lebensweltlichen Dimensionen entfaltet[.], zielt[.] der geistliche oder himmlische Segen auf das menschliche Heil und ewige Leben« (S. 153); beiderlei Segen bleibt indes an Christus als benedictor : »Segner« und als Segensgabe rückgebunden. Entsprechend interpretiert Luther sowohl den gottesdienstlichen Schlusssegen, für den er letztlich den – trinitarisch ausgedeuteten – aaronitischen Segen favorisiert, als auch die lebenspraktischen Segensvollzüge. Ergänzend kommt ein Seitenblick auf die vorsehungstheologische Segenskonzeption Calvins hinzu.
Den weitgespannten Bogen rundet ein Ausblick auf die kirchlichen und theologischen Weiterentwicklungen bis in die Gegenwart ab, der markante Positionen und instruktive Beispiele herausgreift.
Die systematisch-theologischen Überlegungen von Hartmut Rosenau setzen bei der Beobachtung ein, dass Seg(n)en ein ursprünglicher, aber bleibender Ausdruck von Religion ist. Dies zieht |20|Überlegungen zum Religionsbegriff, insbesondere in seinen Auswirkungen auf und Beeinflussungen durch Seg(n)en nach sich, in deren Folge sich Seg(n)en als Querschnittthema bedenken lässt. Auf die gegenwärtigen Herausforderungen kann dabei eine vermittelnde, ›sapientiale‹ Perspektive am angemessensten reagieren.
Im Anschluss an Cicero bezeichnet Religion einerseits kultische, rituelle und liturgische Vollzüge, die eine Verhältnisbestimmung von Göttlichem und Weltlichem vornehmen. Dies trifft in markanter Weise auch für das Segnen zu, das sich von alltäglichen Bitten und Wünschen abhebt und phänomenologisch sowohl mit Beten und (sakramentalem) Feiern als auch mit Magie und Zauber verwandt erscheint. Wichtig ist dabei der performative Charakter, der die Differenzierung von realistischer und idealistischer Deutung unterläuft und sich epistemologisch wie existentiell »für jemanden« ereignet (S. 168). Andererseits kann Religion seit Cicero auch die Rückbezogenheit auf Gott ausdrücken, wie sie etwa Schleiermacher oder Bultmann prägnant reformuliert haben.
Seg(n)en nimmt – mit Tillich formuliert – einen universalen Wirklichkeitshorizont in den Blick, wovon sich das Beten unterscheidet. Denn der Segen vollzieht sich in einem umfassenden Seins- und Sinnzusammenhang, den man theologisch als Schöpfungsordnung bestimmen kann; deren Bedingungen bleiben letztlich unverfügbar und lassen sich mit dem reformatorischen sola gratia ebenso korrelieren wie mit dem alttestamentlichen Geistverständnis.
Anders als Magie und Zauber ist Seg(n)en stets auf (unverfügbares) Gutes und Lebensförderliches ausgerichtet, worin sich die »passivische Konstitution der menschlichen Existenz« spiegelt (S. 172). Wenn Seg(n)en entsprechend ein interpersonales Geschehen ist, erscheint das Segnen von Dingen theologisch problematisch. In der entwickelten Perspektive wird auch deutlich, dass Segen sich empirisch weder verifizieren noch falsifizieren lässt, sondern sich vielmehr als Modus des sich Verstehens darstellt.
Im Unterschied zum sakramental vermittelten eschatischen Heil spendet Segen präeschatisches Wohlergehen, was weitreichende Konsequenzen nach sich zieht: Letztlich erscheint Segen mithin phänomengerecht als synergistisches, Heil hingegen als monergistisches |21|Geschehen, sodass gegenüber christologischen Segensinterpretationen Vorsicht geboten ist. Der präeschatische Charakter des Seg(n)ens gewinnt in der das »Vorletzte« betonenden Postmoderne eminent an Bedeutung und lässt sich angemessen in einer ›sapientialen‹ Perspektive erschließen, die sowohl interkulturell anschlussfähig ist als auch die biblisch-theologischen Eigenarten zu würdigen vermag.
Ulrike Wagner-Rau setzt in ihrem praktisch-theologischen Beitrag gegenüber der lange dominierenden Geringschätzung mit einer »Neubewertung des Segens« ein ( S. 187[dort kursiv]), die sich aus der Eigenart des Segnens als ästhetisches und deutungsoffenes »Ritual der Zuwendung« aufdrängt ( S. 187[dort kursiv]). Ihm eignet eine wirklichkeitsverändernde Kraft, insofern es »die Erfahrung von Wirklichkeit verwandelt« (S. 189).
Der Vollzug des von Gott gespendeten Segens erfolgt wort- und gestenhaft; dabei lassen sich sprachlich Bitte und jussivisches Versprechen unterscheiden, oft begleitet durch vielfältige körperliche Gesten oder Berührungen, was im zeitgenössischen Kontext durchaus ambivalent erfahren wird.
Die gemeinsame Basis der vielfältigen Segensvollzüge gründet in deren Charakter als Übergangsritual ( rite de passage ), das an gewöhnlichen oder außergewöhnlichen ›Schwellen‹ des Lebens haftet: Zunächst sind die vielfältigen alltäglichen ›Segensvollzüge‹ in den Blick zu rücken, die heute oft (nur noch) implizit erfolgen.
Demgegenüber werden die Segnungen in den gottesdienstlichen Übergangssituationen symbolisch und sprachlich explizit ausgestaltet, wobei namentlich dem (individuell unterschiedlich gedeuteten) Entlassungssegen besonderes Gewicht beigemessen wird.
Dies gilt – zumal aus der Sicht ›passiver‹ Kirchenmitglieder – in noch gesteigertem Maße für die Kasualien, in denen der Segensempfang an biographischen Übergängen von grundlegender Bedeutung ist, was inzwischen auch in der Kasualtheorie intensiv reflektiert wird. An der komplexen Verbindung von Taufe und Segen lässt sich dies besonders instruktiv nachvollziehen, wobei eine lange gängige theologische Kritik am Segen zu kurz greift angesichts differenzierter Wahrnehmungen des Verhältnisses von Taufe und Segen |22|auch vonseiten theologischer Laien. Vergleichbares trifft auch für Segensvollzüge bei der Konfirmation, Trauung und Bestattung zu.
In der heutigen Wissensgesellschaft gewinnt der Segen seit einiger Zeit auch im Bildungskontext an Bedeutung und auch hier wiederum gerade für Personen in schwierigen Lebensverhältnissen. Schließlich spielt der Segen in der Seelsorge (besonders an Kranken) traditionell und mit vollem Recht eine herausragende Rolle, verdichtet doch der Segen hier die individuelle Zuwendung in herausragender Weise.
Eine pastoralpsychologische Perspektive vermag die ausgeführte Bedeutung des Segens in vielfältigen Lebensfeldern integrativ mit (früh)biographischen Konstitutionsprozessen zu verbinden und theologisch so fruchtbar zu machen, dass im Segen ein »Beziehungsraum« zwischen Gott und den Menschen eröffnet wird, der »unzerstörbar ist« (S. 207) und der die destruktiven Lebenserfahrungen zwar nicht vertreibt, aber in einen weiteren Horizont aufzuheben vermag.
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Sekundärliteratur
Frettlöh 2005: Frettlöh Magdalene L.: Theologie des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen, Gütersloh 2005 5.
Häusl/Ostmeyer 2009: Häusl, Maria/Ostmeyer, Karl-Heinrich: Art. Segen und Fluch, in: Frank Crüsemann u.a. (Hgg.): Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel, Gütersloh 2009, 515–518.
Hartenstein 2013: Hartenstein, Friedhelm: Ein zorniger und gewalttätiger Gott? Zorn Gottes, »Rachepsalmen« und »Opferung Isaaks« – neuere Forschungen, VF 58 (2013), 110–127.
Homolka 2004: Homolka, Walter: Segen und Segnen nach jüdischem Glaubensverständnis, JCR 476 (2004) ( http://www.jcrelations.net/de/?id=2376).
Janowski 2014: Janowski, Bernd: Ein Gott, der straft und tötet? Zwölf Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments, 2., durchges. und um einen Literaturnachtrag erw. Aufl., Neukirchen-Vluyn 2014.
Kluge 2012: Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearb. von Elmar Seebold, Berlin 2012 25.
|23|Kluger 2011: Kluger, Florian: Benediktionen. Studien zu kirchlichen Segensfeiern (Studien zur Pastoralliturgie 31), Regensburg 2011.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Segen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Segen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Segen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.