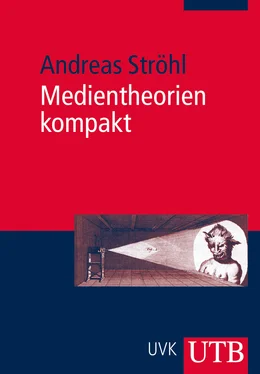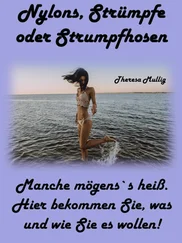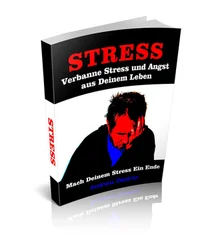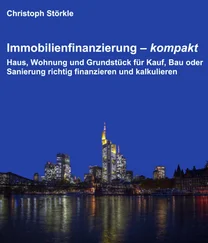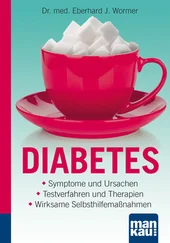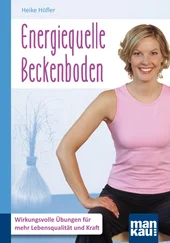Noch zögerlich in den 1930er Jahren auf beiden Seiten des Atlantiks, aber deutlicher schon in den späten 1950er Jahren und massiv um die Jahrtausendwende entstehen immer wieder Programme von Medienwissenschaften genau dann, wenn wir Medienübergänge, also den massiven Durchbruch eines oder mehrerer neuer technischen Medien zu beobachten haben. Der Übergang Stummfilm/Radio/Tonfilm ab Ende der 1920er Jahre prägt in den USA den Begriff; der Übergang Radio/Fernsehen in den 1950er Jahren generiert die ersten Entwürfe von Medienwissenschaft; mit dem dritten, dem Übergang Fernsehen/ Computer/Internet in den 1990er Jahren erleben wir die Inflation von Medienwissenschaftskonzepten, vor denen wir heute stehen. (Hagen 1988, 88)
In den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts ereignet sich eine weitere, vierte Zäsur, der medial turn . Medienwissenschaften und vor allem Medientheorien rücken nun zur modischen Leitwissenschaft auf. Die mediale Bedingtheit unserer Wahrnehmung gerät in den Mittelpunkt zahlreicher Theorien und Wissenschaften, bis hin zu den von den Geisteswissenschaften zuvor weitgehend unbehelligten Naturwissenschaften. Wenn es nun Schallplatten gibt, die sprachliche Texte wiedergeben können, wird plötzlich klar, dass auch die Schrift ein Code ist, der nicht ohne Einfluss auf das mit seiner Hilfe und in ihm inhaltlich Formulierte bleiben kann, dass auch die Schrift und das Buch nur Medien sind, Medien, die sich zufällig vor der Schallplatte und dem Radio etabliert haben. Woher »wissen wir eigentlich«, fragt beispielsweise Vilém Flusser, dass die »großen Schriftsteller (inklusive dem Autor der Heiligen Schrift) nicht lieber auf Tonband gesprochen oder gefilmt hätten?« (Flusser 1992c, 7) Der Geist als Gegenstand der Geisteswissenschaften wird von Friedrich Kittler (→ S. 207) infrage gestellt – zugunsten einer Fokussierung auf Codes, Kanäle und Medientechniken. Plötzlich erschüttert erstens ein im Grunde lange schon bekannter Umstand die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben und Kunst geschaffen wird: dass nämlich unser Denken vom Code, in dem es stattfindet, abhängt, und unsere Wahrnehmung von medialen Prägungen. Zweitens gelingt erst zu diesem Zeitpunkt, um die [18]Mitte des 20. Jahrhunderts, der unvoreingenommene Blick auf die Medien an sich , das heißt losgelöst von den von ihnen transportierten Inhalten. Rückblickend erscheint dies verwunderlich. Denn
wenn wir uns in der öffentlichen wie der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit vor allem auf den Inhalt von Kommunikationen konzentrieren, gleicht das dem hypothetischen Versuch, die Bedeutung des Automobils zu verstehen, indem man ignoriert, daß es ein neues Transportmittel gibt, und sich statt dessen auf eine detaillierte Untersuchung der Namen und Gesichter von Passagieren konzentriert (Meyrowitz 1990, 56).
Erst die aus dieser Erkenntnis entstehende Umorientierung markiert den Beginn einer Medientheorie im engeren, heutigen Sinn.
Heute schließlich haben, fünftens, die Alltäglichkeit der Nutzung immer leistungsfähigerer Gadgets, die in immer mehr Bereiche des Lebens eindringen, sowie die Allgegenwart des Internets zu einer Relativierung der großen, sinnstiftenden Medientheoriegebäude der 80er- und 90er-Jahre mitsamt ihrer apokalyptischen oder utopischen Prophezeiungen geführt.
Nochmals die hier vorgeschlagenen Zäsuren, welche uns helfen sollen, die Geschichte von Medientheorien übersichtlich zu strukturieren:
1 von den Anfängen der Mediennutzung bis zu den großen Epen, Schriftreligionen und zur klassischen griechischen Philosophie (um die Zeitenwende)
2 bis zu Buchdruck, Reformation und Alphabetisierung (16.–18. Jahrhundert)
3 bis zu den technischen Bildern und den elektrischen Medientechniken (19.–20. Jahrhundert)
4 bis zum medial turn und dem Aufstieg der Medientheorien zu Leitwissenschaften (1970er/-80er Jahre)
5 Relativierung der Großtheorien; das Internet als dominantes Verbundmedium (seit den 1990er Jahren)
Was sind Medien?
Schon an der Frage, was überhaupt ein Medium sei, zerschellt der Traum von einer einheitlichen Wissenschaft oder Theorie von den Medien. Wie das Aristoteles-Zitat oben zeigt, stellte man sich in der Antike und in der Folge der aristotelisch und platonisch beeinflussten Lehren in Europa (einschließlich des Katholizismus) unter »Medien« zunächst physische Stoffe wie Luft oder Wasser vor. 1675 ging Isaac Newton noch von einem ätherischen Stoff aus, der die Bewegung des Lichts und damit das Sehen ermögliche. Dieser Stoff galt ihm als Medium.
[19]Parallel dazu waren Medien aber immer auch Sendboten des göttlichen Willens. Der Götterbote Hermes ebenso wie der Erzengel Gabriel, der Prophet Mohammed oder Jesus Christus: Sie alle überbringen göttliche Nachrichten. 3 Für Katholiken übernimmt die Jungfrau Maria allerlei Fürbitten, die offenbar einer medialen Vermittlung bedürfen. Von Anbeginn an hat unsere Vorstellung vom Medium also auch religiöse Züge: Das Heilige, die Wahrheit selbst zu sehen, ist uns unmöglich oder verboten. Mittler sind nötig. Das können Engel, Propheten oder Priester sein – oder eben Schriften oder andere Datenspeicher.
Dieser Tradition entstammt auch der Sprachgebrauch vom Medium als dem besonders begabten Empfänger übersinnlicher Information. Bis ins frühe 20. Jahrhundert wird unter einem Medium vor allem ein Mensch verstanden, der dank besonderer Begabung, durch Trance, Hypnose, Drogen, Nahtoderfahrungen, Hysterie oder andere ekstatische Begleitumstände in der Lage ist, mitzuteilen, was anderen Menschen nicht offenbar wird: verborgenes, geheimes Wissen, die Zukunft etc. Als Franz Anton Mesmer Ende des 18. Jahrhunderts diese Formen von Volksglauben, gestützt durch die gleichzeitige Erforschung der Elektrizität und die Entdeckung der »tierischen Elektrizität« durch Luigi Galvani, vorgeblich naturwissenschaftlich fundiert, als er Formen von Hypnose als »animalischen Magnetismus« gesellschaftlich akzeptabel und salonfähig zu machen versucht, werden seine Versuchspersonen ganz selbstverständlich als »Medien« bezeichnet.
Ein Indiz dafür, dass der Begriff des Mediums im Sinne von Durchlässigkeit für etwas verwendet worden ist, findet sich in Georg W. F. Hegels Wissenschaft der Logik von 1812 – fast beiläufig wird da erwähnt, dass so, wie das Wasser im Körperlichen die vermittelnde Funktion eines Mediums hat, im Bereich des Geistigen die Zeichen bzw. die Sprache diese mediale Funktion übernehmen […]. Das Medium ist ein Tor zur Welt des Symbolischen (Hartmann 2010, 273).
Ab 1870 fotografiert der Arzt Jean Martin Charcot in der berühmten Nervenheilanstalt Salpêtrière in Paris Hysterikerinnen. Seine Modelle, wie die durch die Sessions und Fotos berühmt gewordene Augustine, waren Patientinnen und Darstellerinnen zugleich. 4 Vor allem aber verkörperten sie etwas Unheimliches, scheinbar ihnen selbst Unzugängliches: Sie sind Medien, die etwas transportieren und vermitteln . Die Fotografie selbst als »Medium« zu bezeichnen, wäre damals aber noch niemandem eingefallen. Und noch als der Parapsychologe Albert von Schrenck-Notzing 1929 [20]Fotos von »Materialisationsphänomenen« (z. T. in Anwesenheit von Thomas Mann) macht und ausstellt, wird keineswegs die Fotografie selbst als »Medium« bezeichnet, sondern vielmehr immer noch die fotografierten Personen, die diese Phänomene des sogenannten »physikalischen Medionismus« hervorbringen.
Doch dann, etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts, setzt sich allmählich die Bedeutung von »Medium« durch, die wir heute zuallererst mit dem Begriff verbinden: ein technisches Kommunikationsmittel, stets im Zusammenhang mit seinen kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingtheiten und Bedingungen gedacht.
Die Wiederbelebung und Umprägung des alten Begriffs vom »Medium« haben wir dann, es muss gesagt werden, der Werbewirtschaft zu verdanken:
Читать дальше