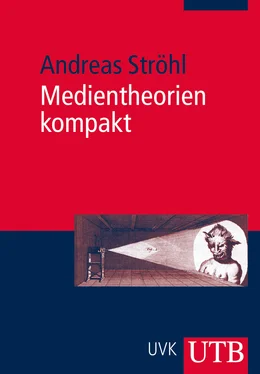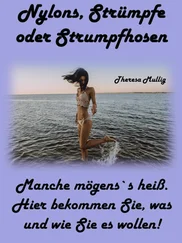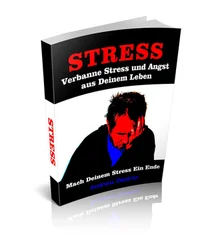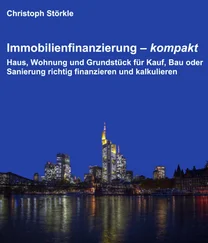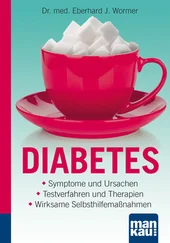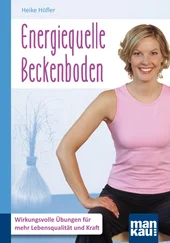Die mediale Wende
Der Mensch als Medientier
Medientheorien in der Postmoderne und Gegenwart
– Das Komplott der Simulakra: Jean Baudrillard
– Rasender Stillstand: Paul Virilio - der Krieg, die Beschleunigung, das Verschwinden
– Der Geist singt nicht mehr im Signifikantenstadel: Friedrich Kittler und das technische Apriori
[9] … und jetzt?
Das Erbe der Gründerväter und der Versuch, Abschied zu nehmen
Nach dem Abschied vom Abschied von den Medientheorien
Was also sind Medien?
Literaturverzeichnis
Zitierte Filme
Zitierte Musik
Personenregister
Abbildungsverzeichnis
Einführung[10][11]
Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.
(2. Mose 33.20)
Gott war für die Autoren des Alten Testaments gewaltig, überwältigend und unzugänglich. So unerträglich stellten sie ihn sich vor, dass ein gewöhnlicher Sterblicher seinen Anblick nicht überleben würde. Und doch wurde diesem Gott unterstellt, er wolle mit seinen Geschöpfen, zumindest mit einigen von ihnen, kommunizieren.
Das hatte zwei Konsequenzen: Um mit seinem auserwählten Volk sprechen zu können, brauchte Gott erstens einen Mittelsmann: Moses. Nur Moses ist autorisiert. Der göttliche Autor, der Schöpfergott, hat allein ihm die Fähigkeit verliehen, seinen Anblick zu ertragen, ihn sehen und hören zu können, und dann dem Volk wie ein Dolmetscher seine jenseitigen Nachrichten zu überbringen. Selbst er, der Allmächtige, ist auf den Mittler angewiesen, auf das Medium Moses. Nur durch dessen Vermittlung können die Israeliten das Göttliche überhaupt wahrnehmen. Ohne das Medium wäre ihr Bund mit dem neuen Gott nicht möglich; Kommunikation könnte ohne Medium gar nicht stattfinden.
Zugleich zeigt sich schon hier die Zweischneidigkeit jeder medialen Vermittlung: Es gibt keinen direkten Zugang zur Quelle, zur Wahrheit. Alles, was die Israeliten von Gott wahrnehmen, ist das, was Moses über ihn sagt. Das Medium schiebt sich zwischen die Wahrnehmenden und die wahrgenommene Sache. Nicht die Sache wird eigentlich sichtbar, sondern – und auch dies nur bei konzentriertem Hinsehen – das Medium. Aber ohne das Medium gäbe es diese Wahrnehmung überhaupt nicht. 1
Zweitens aber befanden sich die Autoren dieser Erzählung in einer mediengeschichtlich beispiellosen Situation: Sie schrieben. Und zwar schrieben sie, anstatt zu modellieren oder zu malen. Die Schrift steht am Beginn des Monotheismus, der mit einer magischen Weltvorstellung aufräumen sollte, mit der Vorstellung, ein Götzenbild oder eine Ikone symbolisiere nicht nur eine Gottheit, sondern sei diese selbst. Die sogenannten Schriftreligionen sind Aufklärungsbewegungen. Geschrieben wurden sie vor allem gegen etwas, gegen die Anbetung von Bildern.
[12]Wie wird dieser Vorgang in der Bibel selbst dargestellt? Gottes Finger schreibt den Grundtext, die zehn Gebote, auf Gesetzestafeln und übergibt sie Moses, der die Tafeln vom Berg Sinai herunterbringt. Da sieht Moses unten die Israeliten ums Goldene Kalb tanzen. Vor Wut und Empörung zerschmettert er den Urtext. Doch dessen Autor zeigt Verständnis. Moses geht ein zweites Mal auf den Berg. Diesmal schreibt der Prophet selbst die Worte auf, die ihm der Autor diktiert. Dann überbringt er seinem reuigen Volk die zweite Auflage der zerstörten Erstausgabe: Die Schrift an sich also ist wertlos; sie ist eine Kulturtechnik, weiter nichts. Heilig ist der Inhalt des Textes, nicht aber das ihn bedeutende Zeichen, welches bloß auf den Inhalt verweist. Die Israeliten gehen in diesem Moment, in dem sie den Inhalt von den Zeichen seiner Wiedergabe trennen, einen gewaltigen zivilisatorischen Schritt, einen Schritt, der unsere Kulturen und unser Bewusstsein bis heute prägt.
Die Kapitel 31 bis 34 des 2. Buch Mose enthalten im Grunde alles, was zur Begründung einer Theorie des Medialen notwendig ist. Ebenso wie andere große archaische Erzählungen ist die Bibel voll von solchen Motiven. Ist nicht der Mittelsmann Moses eine Präfiguration, eine Vorwegnahme von Gottes menschgewordenem Sohn, der zwischen diesem und den Menschen vermitteln soll? Sind die Engel nicht Boten, Kuriere und göttliche Nachrichtentechniker? Das Alte Testament ist nur ein willkürlich gewähltes Beispiel unter vielen. Ebenso gut hätten wir unsere Expedition in die Medientheorie auch mit irgendeinem anderen Text beginnen können, mit der Ilias zum Beispiel oder dem Mahābhārata. Aber was ist eigentlich ein Text und:
Wozu braucht man Medientheorie?
Moses muss zwischen dem Auserwählten Volk und seinem Gott vermitteln, denn dessen bloßer Anblick würde die Israeliten töten. Die Wahrheit an sich ist als solche entweder gar nicht wahrnehmbar für die menschlichen Sinne oder so gewaltig, dass sie dem Menschen zum Verhängnis würde. Mediale Vermittlung ist deshalb eine existentielle Notwendigkeit. Dieses Motiv des Alten Testaments steht in der Ideengeschichte der Menschheit nicht allein da. In seinem berühmten Höhlengleichnis (→ S. 36) beschreibt der griechische Philosoph Platon im 4. Jahrhundert vor Christus, wie der Bewohner einer Höhle »nachdem er an das Sonnenlicht gekommen, die Augen voll Blendung haben und also gar nichts von den Dingen sehen können« würde. In Friedrich Schillers Gedicht Das verschleierte Bild zu Sais (1795) weigert sich »ein Jüngling, den des Wissens heißer Durst[13] nach Sais in Ägypten trieb«, das Verbot der direkten Teilhabe an der Wahrheit zu akzeptieren:
»Was ists,
Das hinter diesem Schleier sich verbirgt?«
»Die Wahrheit«, ist die Antwort. – »Wie?« ruft jener,
»Nach Wahrheit streb ich ja allein, und diese
Gerade ist es, die man mir verhüllt?«
Daraufhin enthüllt er das Bild der Wahrheit, welches den Sterblichen aus gutem Grund unzugänglich ist, und vegetiert schließlich infolgedessen in geistiger Umnachtung »besinnungslos und bleich« dahin. Auch hier ist uns die reine Wahrheit selbst unzugänglich. »Kein sterblicher Mensch hat meinen Schleier aufgehoben« (Schiller 1962, 507), warnt sie uns bei Schiller höchstpersönlich.
Ein vom Vorgang seiner Vermittlung abgetrennter, also nicht medial gedachter Inhalt ist, um weiter mit Schiller zu sprechen, »nimmermehr erfreulich«. Früh schon in der Kulturgeschichte der Menschheit hat sich ein Gefühl dafür entwickelt, dass die Wahrnehmung des Menschen nicht gleichzusetzen ist mit der ihn umgebenden Wirklichkeit, dass er der Wahrheit nicht unmittelbar teilhaftig werden kann. Das ist sehr weitgehend Konsens in der Geschichte der Philosophie. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Grunddilemma umzugehen. Einer zufolge ist eine mittelbare Erkenntnis der Welt möglich. Dieser Denkweg versteht Mediation, Medien, Medialität als Voraussetzung der Möglichkeit von Wahrnehmung und Erkenntnis. Ein anderer Ansatz verneint diese Möglichkeit jedoch zur Gänze. Die Welt ist dann bloße Illusion, reines Scheingebilde. Dieses Verständnis der Welt führt zu keiner fruchtbaren Theorie der Erkenntnis, der Kommunikation oder der Wahrnehmung. Doch ganz egal, welche von beiden Reaktionen die richtige ist: In keinem Fall ist die Welt einfach so, wie sie sich für uns scheinbar darstellt. Das Wissen um diesen Umstand ist so fundamental, so essentiell, dass sich durchaus argumentieren ließe, dass es eben diese Erkenntnis von der Unmöglichkeit einer unmittelbaren Erkenntnis, von einer nicht-medialen Wahrnehmung ist, die das Menschsein eigentlich ausmacht und definiert. Der Mensch ist demnach dasjenige Wesen, das weiß, dass das von ihm Wahrgenommene nicht einfach die Wirklichkeit ist.
Noch ein dritter Ansatz soll hier vorab Erwähnung finden. Es ist der des (radikalen) Konstruktivismus (→ S. 125), einer Theorie, die den Medien nicht die Rolle als Mittler einer unabhängig von ihnen bestehenden Wirklichkeit zuschreibt. Der (stets mediale) Wahrnehmungsvorgang selbst ist es[14] hingegen, der nach Meinung radikaler Konstruktivisten das Wahrgenommene erst erzeugt und so die Welt eigentlich erschafft, die wir wahrzunehmen glauben.
Читать дальше