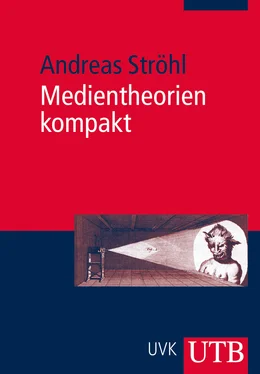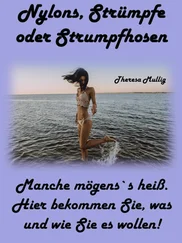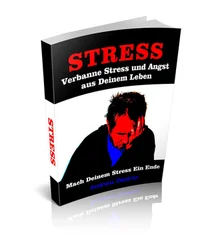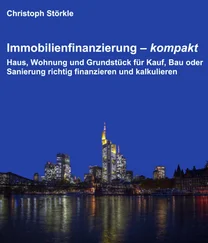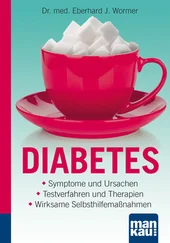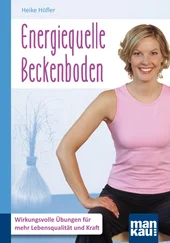Schon dieser sehr flüchtige Blick auf die Bedeutung von Medien und auf ihre Rolle in unserer Wahrnehmung der Welt zeigt, dass es sich lohnt, ihre Funktion und Wirkungsweise einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Genau dies haben sich Medientheorien zur Aufgabe gemacht. Medientheorien sind notwendig, sobald man sich bewusst macht, dass in der Kommunikation zwischen einem Ich und einem Du ein Drittes steht – eben das Medium. Die Klärung von Funktionen und Eigenschaften des Medialen wird unumgänglich, sobald ich verstehe, dass meine gefühlte Teilhabe an der mich umgebenden Wirklichkeit nicht so direkt und unkompliziert abläuft, wie es mir erscheint, solange ich meine Wahrnehmungsweisen nicht infrage stelle.
Fassen wir also zusammen: Medien vermitteln zwischen mir und der Welt und zwischen mir und anderen Menschen. Ohne sie könnte ich weder Menschen noch die Welt erkennen. Zugleich beeinflussen und prägen Medien diese Wahrnehmung, welche sie selbst ermöglichen. Sie sind nie neutral oder frei von Haltungen und Perspektiven, von Filterungen, Wichtungen und Wertungen. Nach Meinung etwa der erwähnten konstruktivistischen Theoretiker stellen sie sogar die Wirklichkeit selbst überhaupt erst her. Und schließlich können Medien Daten nicht nur übertragen und vermitteln, sondern auch speichern – einige über kürzere Zeiträume (z. B. Schallwellen), andere über längere Zeiträume (z. B. die Pyramiden). Was unsere Wahrnehmung und Erkenntnis so grundlegend bestimmt wie Medien es tun, das bedarf einer näheren Untersuchung und einer theoretischen Reflexion.
Im selben Moment, in dem sich das Zeichen von seiner Bedeutung löst, in dem also die Skulptur eines Kalbs nicht mehr Gott selbst ist und ein Baum und das Wort »Baum« nicht mehr ein und dasselbe sind, entsteht ein Bewusstsein für die Zeichenhaftigkeit der Sprache. Um allgemeiner auch für nonverbale Zeichensysteme (wie z. B. das System der Verkehrszeichen, für Musik oder für die Körpersprache) Aussagen treffen zu können, sprechen wir künftig nicht von »Sprache«, sondern vom »Code«. Ein Code ist ein System von Zeichen. Eine konkrete, zusammenhängende und abgrenzbare Anordnung von Zeichen eines Codes (z. B. das Alte Testament, das Goldene Kalb, die Verkehrszeichen einer Stadt, eine Symphonie oder eine Pantomime) ist ein Text .
Komplizierter wird die Sache in dem Moment, in dem der Begriff »Medium« hinzukommt. Denn die Zeichen sind nur ein Teil dessen, was da vermittelnd zwischen uns und die Welt tritt. Und selbst dieser einfache [15]Satz ist medientheoretisch unsicher. Denn es gibt mit den bereits erwähnten radikalen Konstruktivisten auch sehr ernstzunehmende Medientheoretiker, die die Welt (und auch uns selbst) eher als das Produkt eben dieser Zeichen verstehen. Aber zurück zum Begriff des »Mediums«. Die Codes (z. B. die Schrift), die Datenträger (z. B. das Buch), die Kulturtechnik (z. B. das Lesen), die zur Übertragung oder Speicherung von Daten verwendete Technik (z. B. der Buchdruck), die Kanäle, durch die diese Daten transportiert werden (z. B. Verlage und Buchhandel), die technischen (z. B. die Druckerpresse) und selbst die gesellschaftlichen Apparate und Institutionen (z. B. die Schulen oder Bibliotheken), ja sogar das Geld, die Wahrheit oder die Liebe – all dies ist schon irgendwann einmal in irgendeiner Theorie der Medien als »Medium« bezeichnet worden. Und auch in der Geschichte von Moses und den Zehn Geboten würden verschiedene Medientheoretiker unterschiedliche Medien erkennen – die einen sähen in Moses den Mittler oder Mediator, das Medium also, andere in den Steintafeln, wieder andere in der Schrift, in der verwendeten Sprache oder in der Institution des Gesetzes selbst.
Der Begriff »Medium« ist geradezu bizarr schillernd, widersprüchlich und unscharf, fast schon beliebig. Wie sich zeigen wird, ist dies allerdings nicht ohne Grund so. Und dass dies in den Kulturwissenschaften kein Sonderfall ist, zeigt schon ein Hinweis auf die Spannweite der Bedeutungen von Begriffen wie »Kunst« oder »Kultur«. Auf den Versuch einer allgemeingültigen Definition des Begriffs »Medium« (und erst recht auf den Versuch einer Definition von »Theorie«) 2 wird hier deshalb zunächst verzichtet. Stattdessen werden verschiedene Medienbegriffe ins Visier genommen.
Seit wann gibt es Medientheorien?
In den ersten Medientheorien, die aus heutiger Sicht als solche gelten, etwa bei Platon (→ S. 32), taucht der Begriff »Medium« selbst gar nicht auf. Die mythischen Erzählungen, die irgendwann einmal in Schriftform gegossen wurden, wie etwa die Bibel oder die Ilias , besitzen aber durchaus medientheoretisches Potenzial, wie die eingangs nacherzählte Episode von Moses und den Gesetzestafeln zeigen sollte. Dass darin Fragen von Autorschaft und Erzählstrategien, von Mündlichkeit und Schriftlichkeit verhandelt werden, deutet darauf hin, dass medientheoretische Fragestellungen auch damals, vor 3.000 oder 5.000 Jahren, als ganz existentiell und wesentlich in ihrer Bedeutung betrachtet wurden. Was darin verhandelt [16]wird, trägt heute die Bezeichnungen »Medium«, »Kulturtechnik« oder »Kommunikationsstruktur«. Heutige Medientheorien und moderne oder postmoderne Medienphilosophie beziehen sich folglich immer auf eine Philosophiegeschichte, in der viele ihrer Grundfragen schon gestellt sind. Es sind besonders die ungelösten Probleme aus der Geschichte der Erkenntnistheorie, die heute im Gewand dieser Theorien wiederkehren.
Doch auch der Begriff des »Mediums« ist schon uralt. Begriffsgeschichten sind zwar immer fragwürdig, weil sich Bedeutungen nicht sinnvoll von dem kulturellen Zusammenhang trennen lassen, der ihnen erst Sinn verleiht. Und dieser unterliegt häufigen Wandlungen. Legt man aber Wert darauf, eine Geburtsstunde für die heutige Bedeutung des Begriffs »Medium« festzulegen, so ließe sich diese wohl am sinnvollsten bei Aristoteles ansetzen. Im siebten Hauptstück des zweiten Buchs von De animus schreibt er:
Democritus ist hier unrichtig, indem er meynt, daß wir, wenn das Medium, (durch das wir sehen,) ein Vacuum wäre, weit deutlicher sehen würden, ja, daß wir selbst eine Ameise im Himmel, (durch das Auge,) unterscheiden würden. Denn dieß ist ganz unmöglich. Weil das Sehen nur dadurch geschieht, daß das Sinnorgan, (von Außen,) leidet. (Mithin von Etwas äußerem afficirt wird.) Daß es von der Farbe (dem gefärbten Gegenstande,) der gesehen wird, (unmittelbar) afficirt werde, ist gar nicht möglich. (Weil dann der Gegenstand uns zu nahe, und mithin, eben deswegen, für uns nicht sichtbar wäre.) Es bleibt daher nichts übrig, als, daß er durch ein Medium afficirt werde. Folglich ist ein solches Zwischending, (ein Medium,) nothwendig. Wenn es aber zu einem Vacuum würde, würde nicht nur nichts deutlich, sondern vielmehr gar nichts gesehen werden. (Aristoteles 1794, 132)
Schon bei Aristoteles, dem Urvater abendländischen Denkens, findet sich also die Überlegung, dass wir ohne Vermittlung eines »Zwischendings«, eines Mediums, nichts wahrnehmen könnten. Die gewählte Aristoteles-Übersetzung stammt aus der Zeit der Französischen Revolution, weil sich mit diesem Beginn der Neuzeit im engeren Sinne auch unser modernes Verständnis von Medien ausformt. Medien und ihre Funktionen hat es immer gegeben. Doch erst mit dem Aufkommen des Buchdrucks, mit der Reformation und der darauffolgenden Alphabetisierung weiter Bevölkerungsteile entsteht ein Bewusstsein für das Massenmedium als solches. In der Wahrnehmung von Medien ist dies die zweite Zäsur. Die erste Zäsur war die Erfindung der Schrift selbst, das Aufkommen der Schriftreligionen Judentum, Christentum und Islam sowie die ersten Reflexionen über die Schrift und das Mediale bei Aristoteles, Sokrates und Platon.
In diesem Zeitraum zwischen der flächendeckenden Verbreitung des ersten technisch hergestellten Massenmediums Buch und der für dessen Rezeption erforderlichen Kulturtechnik des Lesens im Europa des 16. und [17]17. Jahrhunderts, einerseits, und dem Aufkommen der ersten technischen Bilder (der Fotografie und dem Film) und der ersten elektrischen Medientechniken (Telegrafie und Radio) im 19. und 20. Jahrhundert, andererseits, beginnt sich eine andere Vorstellung vom Medium zu formen. Medien scheinen nun ein Eigenleben anzunehmen. Obwohl auch die ersten explizit als »Medientheorie« bezeichneten Thesen genau zu dieser dritten Zäsur im frühen 20. Jahrhundert formuliert werden, gab es zuvor im weitesten Sinne schon eine moderne Medientheorie avant la lettre , eine, die sich ihrer selbst nur noch nicht bewusst war. In dieser Zeit bildet sich nun etwas heraus, was sich aus heutiger Sicht »Medienwissenschaft« nennen ließe:
Читать дальше