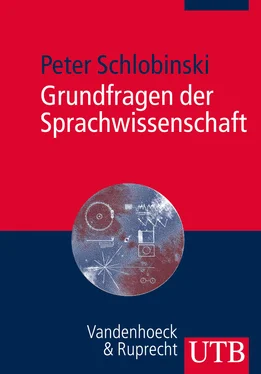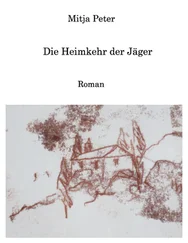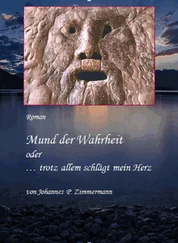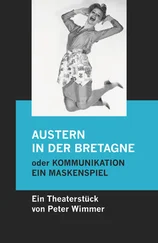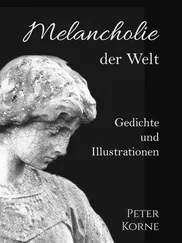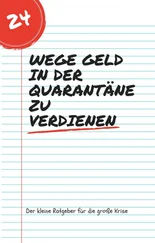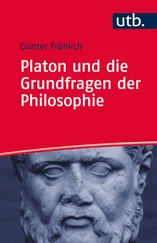Peter Schlobinski - Grundfragen der Sprachwissenschaft
Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Schlobinski - Grundfragen der Sprachwissenschaft» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Grundfragen der Sprachwissenschaft
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Grundfragen der Sprachwissenschaft: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Grundfragen der Sprachwissenschaft»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dem Autor gelingt der Spagat zwischen fachlicher Angemessenheit und Allgemeinverständlichkeit. So können auch Leser mit keinen oder geringen Vorkenntnissen die Welt der Sprachen entdecken.
Grundfragen der Sprachwissenschaft — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Grundfragen der Sprachwissenschaft», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das ›Prinzip des unmittelbaren Erlebens‹ (IEP) leuchtet intuitiv ein, dennoch hatte ich gesagt, dass ich es in dieser Form bezweifle. Das, was ich stark bezweifle, hängt mit dem Begriff ›Erklärung‹ zusammen. Everett argumentiert, das IEP sei die Ursache für Nicht-Rekursivität, und er führt dies an weiteren Beispielen aus. Das zugrunde liegende Argumentationsschema setzt stillschweigend voraus, dass es normalerweise Sprachen mit Rekursivität gibt und dass das Pirahã von der Norm abweicht und für dieses Abweichen eine Begründung zu finden sei. Dies ist ein uns im Alltag vertrautes Denkschema: Solange der Computer läuft, fragen wir nicht nach der Ursache, warum er läuft, treten aber Fehlfunktionen auf, dann fragen wir uns, was passiert ist, warum der Computer nicht mehr funktionsfähig ist. Aber können wir eine Ursache eindeutig festlegen? Ist es plausibel, im Hinblick auf das komplexe Phänomen Sprache einen Grund (IEP) für ein Phänomen (Nicht-Rekursivität) festzulegen? Nein, zu behaupten, das IEP erkläre Nicht-Rekursivität, ist eine sehr einfache und reduktionistische Sicht auf die (sprachliche) Welt. Lebensumstände, Kultur haben sicherlich einen Einfluss auf sprachliche Strukturen, aber sie wirken nicht monokausal, sondern sind in sehr komplexen Zusammenhängen zu sehen.
6 Wie gehen Sprachwissenschaftler vor?
Die Sprachwissenschaft ist eine Erfahrungswissenschaft. »An konkreten Sprechereignissen macht der Sprachforscher seine grundlegenden Beobachtungen und fixiert ihr Ergebnis in Erstsätzen der Wissenschaft«, so hat es Karl Bühler (1982: 15) treffend formuliert. Doch wie beobachten wir den Untersuchungsgegenstand ›Sprache‹?
Als kompetente Sprachteilnehmer können wir auf unsere eigene Sprachkompetenz zurückgreifen, man nennt dies die Methode der Introspektion. Und mit dieser Methode kann man eine Menge an interessanten Sprachdaten gewinnen und sie beurteilen. Es gibt aber auch Probleme mit dieser Methode. Sie ist natürlich völlig ungeeignet, wenn man Sprachdaten einer unbekannten Sprache erheben will. Wie schwierig in diesem Fall das Gewinnen von Sprachdaten sein kann, zeigen Untersuchungen zu Indianersprachen oder Aboriginee-Sprachen in Australien. In Australien mit seinen zahlreichen Ureinwohnersprachen ist es zunächst vonseiten des Staates nicht erlaubt, in die Gebiete der Ureinwohner einzudringen. Doch auch mit Erlaubnis ist der Zugang zu fremden Kulturen schwierig, wenn mit der Außenperspektive des Fremden in die Kulturen eingedrungen wird. Welche Schwierigkeiten sich bei der Feldforschung ergeben können, findet sich anekdotisch in einem äußerst lesenswerten Buch von Robert M. W. Dixon, der zahlreiche Arbeiten zum Dyirbal, einer nordostaustralischen Sprache, verfasst hat. Auf der Suche nach Informanten zum Dyirbal berichtet Dixon folgende Geschichte:
Then the old military gentleman cupped his hands to his mouth, put them three inches from Tommy’s ear, and bellowed, »He wants your language.«
»Oh, yes», said Tommy, »that good language. Jirrbal. They speak him all way back to Ravenshoe. All way down to Tully that language.«
»Would you mind if I asked you some?« I enquired.
»Do you know any language?« my translator shouted.
»No more«, replied Tommy, »my brother, he’s the one knows all that language. He know all words for animal, and bird. They never learn me all that. My brother the one all right.«
»Where could I find your brother then?« brought no response.
Again, Tommy’s neighbour come to my aid, whipping out each word like a cannon shot.
»Where. Is. Your. Brother?«
»Oh, my brother«, said Tommy – appearing surprised that we didn’t already know – »He dead. He died ten years ago.« (Dixon 1984: 47–48)
Zum Glück stellen sich solche Probleme kaum, wenn wir das Deutsche untersuchen. Können wir uns aber auf unsere Kompetenz bzgl. unserer eigenen Sprache immer verlassen? Weiß der Linguist bei seiner Muttersprache, was ein grammatisch korrekter Satz ist und was nicht? In einer Anmerkung berichtet Wolfgang Schindler, dass der von ihm diskutierte Hörbeleg dann hat er wirklich das Ziel verfehlt halt – im Gegensatz zu dann hat er halt wirklich das Ziel verfehlt – auf einer Fachtagung von einem bekannten Kollegen mit der Bemerkung kommentiert wurde, »dass manche Leute eben auch mal falsch sprächen« (Schindler 1995: 55, Anm. 2). Schindler bemerkt hierzu: »Der Leser möge beurteilen, ob hier ein Verstoß gegen eine Syntaxregel wie ›Platziere Abtönungspartikeln nur im Mittelfeld‹ vorliegt oder ob gesprochensprachlich bestimmte Abtönungspartikeln ohne Regelverstoß ›nachgeliefert‹ werden können« (ebd.). Hinter der nicht selten vorkommenden Einschätzung, dass das, was von der (welcher?) Norm abweicht, Performanz-, Sprechfehler seien, verbirgt sich ein doppelter Kompetenzbegriff. Zum einen werden ein idealisierter Sprecher und eine idealisierte Sprache zugrunde gelegt, das Reale und Empirische über die Performanz als »Abfalleimer« (Ballmer 1976: 27) der ›idealen Sprache‹ gegenübergestellt, zum anderen wird der kompetente Wissenschaftler dem Alltagssprecher und sprachwissenschaftlichen Laien qua Profession übergeordnet.
Um sicherzustellen, dass die Sprache in ihrer Breite und hinsichtlich bestimmter Phänomene erfasst werden kann, gibt es verschiedene Techniken der Sprachdatenerhebung (Interviews, Tests, teilnehmende Beobachtung usw.), mit denen Sprachkorpora für die Analyse aufgebaut werden können. In den letzten zehn Jahren hat die so genannte Korpuslinguistik, bei der Sprachkorpora systematisch analysiert werden, eine immer stärkere Bedeutung erfahren. Entscheidend ist, dass neben der Kompetenz des Sprachwissenschaftlers und seiner Expertise die Kenntnisse des Sprechers und sein Sprachgebrauch über die Sprachdatenerhebung in die Analyse einfließen und somit die Qualität der Analyse erhöhen.
Es gibt in der Sprachwissenschaft spezielle Erhebungstechniken und eine (und nur eine) davon ist die rasche und anonyme Datenerhebung, die aus zweierlei Gründen von William Labov (1966) in seiner berühmten Kaufhausstudie entwickelt wurde: 1. um möglichst natürliche Sprachdaten zu erheben und 2. um in kürzester Zeit eine große Anzahl von Daten zu gewinnen. Labov hält rasche und anonyme Beobachtungen »für die wichtigste Methode in einem linguistischen Forschungsprogramm, das die von gewöhnlichen Leuten bei ihren alltäglichen Verrichtungen benutzte Sprache zu ihrem wichtigsten Gegenstand macht« (Labov 1980: 48).
William Labov (*4.12.1927 in Rutherford, New Jersey)
William Labov, 1927 in Rutherford geboren, studierte in Harvard und arbeitete zunächst als Chemiker, bevor er sich der Linguistik zuwandte. Seine MA-Arbeit aus dem Jahre 1963, in der er sich mit dem Dialektwandel auf Martha’s Vineyard beschäftigte, wurde ebenso berühmt wie seine Dissertation (1963) zum Englischen in New York City. Er lehrte zunächst an der Columbia University (1964–1970) und anschließend an der University of Pennsylvania.
Verfolgt Labov in seinen ersten Arbeiten dialektologische Fragestellungen, folgt zwischen 1965 und 1968 ein großes Projekt zum Black Englisch, in dem auch pragmatische Aspekte des Sprachgebrauchs verfolgt werden. Die moderne Soziolinguistik und die sog. Variationslinguistik sind wesentlich durch die Arbeiten von Labov geprägt. Immer geht es ihm um sprachliche Variation und Alltagssprache, um Sprache im sozialen Kontext. »In den letzten Jahren hat sich eine linguistische Forschungsrichtung entwickelt«, so beginnt Labov seinen Aufsatz Das Studium der Sprache im sozialen Kontext, »die sich auf den Sprachgebrauch innerhalb der Sprachgemeinschaft konzentriert, wobei das Ziel eine Sprachtheorie ist, die es vermag, diese Gegebenheiten zu erklären. Diese Forschungsrichtung hat man zuweilen als ›Soziolinguistik‹ bezeichnet, obgleich das ein etwas irreführender Gebrauch eines merkwürdig redundanten Begriffs ist. Sprache ist eine Form sozialen Verhaltens« (Labov 1972: 123). Und: »Dieser Aufsatz wird das Studium der Sprachstruktur und Sprachentwicklung innerhalb des sozialen Kontextes der Sprachgemeinschaft behandeln. […] Wenn nicht die Notwendigkeit bestünde, diese Untersuchung gegen das Studium der Sprache außerhalb des sozialen Kontextes abzusetzen, würde ich es vorziehen zu sagen, daß es sich bei ihr ganz einfach um Sprachwissenschaft handelt« (ebd., S. 124).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Grundfragen der Sprachwissenschaft»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Grundfragen der Sprachwissenschaft» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Grundfragen der Sprachwissenschaft» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.