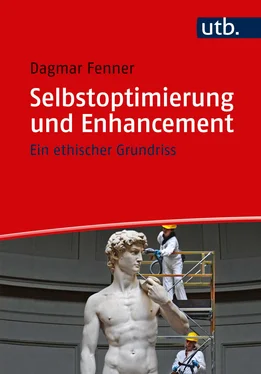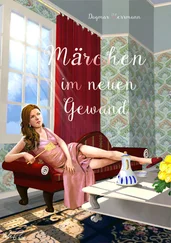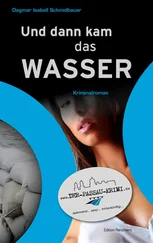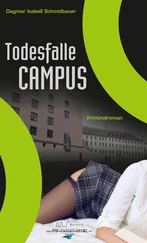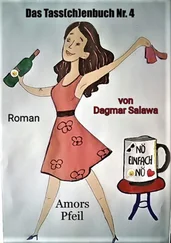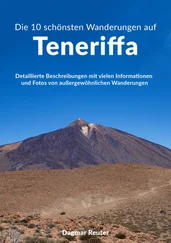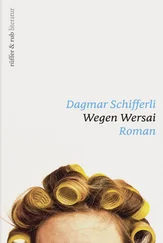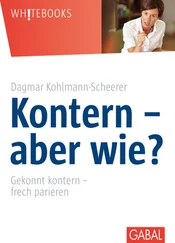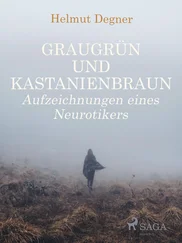1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 Zur Rechtfertigung einer solidarisch zu finanzierenden Therapie bietet sich etwa der handlungsreflexive Ansatzan, wie er von Alan Gewirth und Klaus Steigleder vorgelegt wurde. Den methodischen Ausgangspunkt dieser Moraltheorie bildet die Reflexion auf die notwendigen Bedingungen menschlicher Handlungsfähigkeit, ohne die sich ethische Fragen nach dem richtigen Handeln überhaupt nicht stellen würden (vgl. dazu Fenner 2007, 116ff.). Zu den grundlegendsten Voraussetzungen für freiwilliges und zielgerichtetes menschliches Handeln gehören Freiheitund „Elementargüter“ wie Leben, physischeund psychische Integrität(vgl. Steigleder, 158f.). Als ethisch geboten lassen sich auf diese Weise zum einen medizinische Maßnahmen ausweisen, die das Überleben und die Intaktheit grundlegender physischer und psychischer Funktionen gewährleisten: Während lebensbedrohliche, Lebensfunktionen mindernde oder schmerzhafte Krankheiten klarerweise die physische Integrität beeinträchtigen, gefährden psychische Störungen wie Ängste oder Depressionen die psychische Integrität der Handlungssubjekte. Zum andern kann durch die gleichen Krankheiten sowohl die Handlungs freiheitFreiheit aufgrund von Einschränkungen der körperlichen Bewegungsmöglichkeiten als auch die WillensfreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive) oder Selbstbestimmung infolge verzerrter psychischer Funktionen des Wahrnehmens, Fühlens und Urteilens eingeschränkt werden (Kap. 2.3). Vor dem Hintergrund individuell sehr unterschiedlicher Lebensziele und -konzepte können sich zwar dieselben Krankheiten sehr unterschiedlich auf die Handlungsfähigkeit verschiedener Personen auswirken. So schränkt eine Mehlstauballergie einen Bäcker, nicht aber das Vorstandsmitglied einer Bank ein, und Probleme mit der Handsehnenscheide bedeuten für einen Berufsmusiker eine viel stärkere Beeinträchtigung als für einen Gesprächspsychotherapeuten (vgl. Bobbert, 430). Gemäß Norman DanielsDaniels, Norman Konzept des „normal functioning“ sollen Krankheiten aber unabhängig von solchen divergierenden Auswirkungen aufgrund unterschiedlicher Talente behandelt werden, damit allen Menschen ein normales Chancenspektrumzukommt: Gemeint ist die Gesamtheit aller Lebenspläne, die vernünftige Personen in einer bestimmten Gesellschaft zur jeweiligen Zeit wählen und von denen jedes Handlungssubjekt den zu seinen individuellen Fähigkeiten am besten passenden realisieren können soll (vgl. DanielsDaniels, Norman, 33f.). Letztlich ist die durch eine medizinische Grundversorgung zu schützende allgemeine „Handlungsfähigkeit“ also in der jeweiligen Gesellschaft zu konkretisieren, weil z.B. eine Dyslogie nur in einer litteralen Gesellschaft eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeutet (vgl. dazu BuchananBuchanan, Alan, 122f.). Die ethische Legitimität des Enhancements zu prüfen ist Aufgabe der kommenden Kapitel.
1.4 Wichtige Unterscheidungen und Positionen von Biokonservativen bis Transhumanisten
1.4.1 Elementare Differenzierungen von Verbesserungs-Handlungen
Kompensatorische – progrediente Verbesserungen
Für eine differenzierte Beurteilung der Selbstoptimierung sind neben der äußeren Abgrenzung gegenüber therapeutischen Maßnahmen noch einige Binnendifferenzierungen erforderlich. Das wichtigste begriffliche Gegensatzpaar ist dasjenige von „kompensatorischen“, d.h. „ausgleichenden“, und „progredienten“ oder „progressiven“ Verbesserungen (vgl. NagelNagel, Saskia u.a., 32/GesangGesang, Bernward, 70/FinkFink, Helmut, 15): Kompensatorisches EnhancementEnhancementkompensatorisches meint Verbesserungen menschlicher Eigenschaften oder Fähigkeiten, die unterdurchschnittlich ausgeprägt sind und auf ein „normales“ oder durchschnittliches Niveau in einer Gesellschaft angehoben werden. Strenggenommen ist die Begriffsfügung „kompensatorisches Enhancement“ jedoch widersprüchlich, nachdem oben das „Enhancement“ als biomedizinische Verbesserung des menschlichen Organismus über ein bestimmtes Maß an Normalität oder normalem Funktionieren eines Menschen hinaus definiert wurde (Kap. 1.1). In einem engen oder eigentlichen Sinn wäre nur das in der Debatte zumeist im Zentrum stehende „progressive“ oder progrediente Enhancementüberhaupt ein „Enhancement“, weil es sich nur bei diesem um eine Steigerung über das Normalmaß hinaus handelt. Wird das Adjektiv „kompensatorisch“ statt mit dem Neologismus „Enhancement“ mit den allgemeineren Begriffen einer prozessual verstandenen „Verbesserung“ oder „Selbstoptimierung“ kombiniert, verschwindet zwar der begriffliche Widerspruch, aber die Grenze zur Therapie verwischt. Denn jede Therapie zur Behandlung von Krankheiten ist genau besehen nichts anderes als eine kompensatorische Verbesserung, weil durch die Heilung der Krankheit als einer Funktionsstörung ein speziestypisches Normalniveau erreicht werden soll. Das „kompensatorische Enhancement“ ließe sich jedoch als eine Zwischenstufe zwischen „Therapie“ und „progredientem Enhancement“ interpretieren, in der anders als bei der Therapie keine medizinische Indikation bzw. kein Krankheitswert vorliegt. Ein „kompensatorisches Enhancement“ oder eine „kompensatorische Selbstoptimierung“ wären somit Verbesserungen von Eigenschaften oder Fähigkeiten, die nach dem objektiven biostatischen Modell nicht krankhaft verändert sind, sich aber unterhalb des Durchschnitts bzw. der rein statistischen gesellschaftlichen „Normalität“ befinden (Kap. 1.3; 2.4). Ethisch relevant ist der Unterschied zwischen „kompensatorischem“ und „progredientem Enhancement“, weil „kompensatorische“ Verbesserungen nicht in gleicher Weise wie „progrediente“ mit Gerechtigkeitsproblemen und der Gefahr eines weiteren Auseinanderdriftens der Schere in der Gesellschaft verknüpft sind (vgl. unten).
Autonome – heteronome Verbesserungen
Eine weitere elementare Unterscheidung ist die zwischen einem „autonomen, dezentralen, individuellen“ und einem „heteronomen“ und in den meisten Fällen „zentralen, staatlichen“ Enhancement (vgl. GesangGesang, Bernward, 38f./BrockBrock, Dan 1998, 52ff.). In aktuellen Diskussionen über Selbstoptimierung und Enhancement wird ohne weitere Angaben stets von einem autonomen, freiwilligen EnhancementEnhancementautonomes, freiwilliges ausgegangen, bei dem ein freies, autonomes Wesen Urheber der Optimierungsmaßnahmen ist. Es ist also das Individuum selbst, das sich freiwillig für Veränderungen entscheidet, die es persönlich für Verbesserungen hält. Diese Form der Selbstoptimierung wird auch als „liberales Enhancement“ bezeichnet, weil im Liberalismus die individuelle Freiheit großgeschrieben wird (vgl. AgarAgar, Nicolas 2004, 5/GesangGesang, Bernward, 38). Beim heteronomen, staatlichen EnhancementEnhancementheteronomes, staatliches legen im Gegensatz dazu der Staat oder andere Menschen fest, was eine Verbesserung sein soll. Die Optimierungsziele werden den Einzelnen also von außen vorgegeben und eventuell sogar mit einem geeigneten Sanktionensystem durchgesetzt. Formen eines repressiven „heteronomen, staatlichen Enhancements“ finden sich real nur in totalitären Staaten, wo ein diktatorisches Regime auf der Grundlage demokratiefeindlicher politischer Programme fragwürdige „Verbesserungen“ durchzusetzen versucht wie in der Vergangenheit im nationalsozialistischen Deutschland mit seinem Eugenik-Programm oder in der Gegenwart im kommunistischen China mit einem noch im Aufbau befindlichen Social-Credit-System. Da ein solches diktatorisches heteronomes Enhancement mit den in liberalen Demokratien garantierten Freiheitsrechten unvereinbar ist, geht es in aktuellen Debatten fast ausschließlich um ein autonomes, freiwilliges Enhancement. Als gangbares Zwischenmodell zwischen einem radikalen marktliberalen und einem diktatorischen heteronomen Enhancement-Modell werden am Rande aber auch die demokratisch legitimierte Form eines Enhancementsozialdemokratisches sozialdemokratischen Enhancementsdiskutiert, bei dem zentral gesteuerte Maßnahmen zur Förderung von menschlichen Grundgütern und -fähigkeiten oder zur Vermeidung großer Nachteile für Individuum oder Gesellschaft auf demokratische Weise beschlossen werden (vgl. BrockBrock, Dan 1998, 53/GloverGlover, Jonathan, 51). Letztlich kommt ein bürgerliberaler Staat mit einer sozialen Marktwirtschaft zumindest um eine gesellschaftliche Rahmenordnung mit Restriktionen für ein marktliberales Enhancement nicht herum, um eine weitere Verschärfung gesellschaftlicher Ungleichheit zu vermeiden (vgl. GesangGesang, Bernward, 52f./BuchananBuchanan, Alan u.a., 339f.). Die Bürger könnten dann aber unter den staatlich erlaubten oder sogar finanziell unterstützten Hilfsmitteln immer noch frei auswählen oder darauf verzichten.
Читать дальше