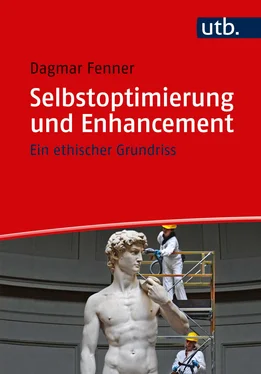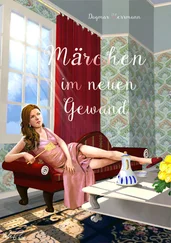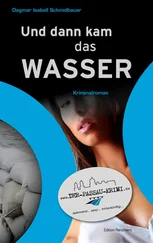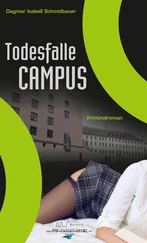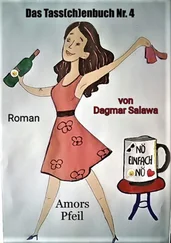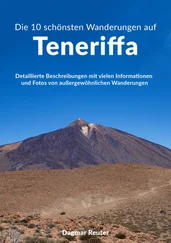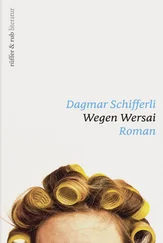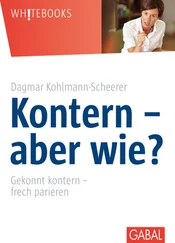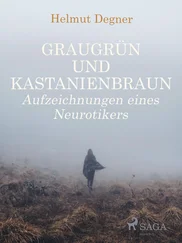3) Notwendigkeit einer Ambivalenztoleranz
Klare Einordnungen der Selbstoptimierung in oppositionelle Kategorien wie „positiver Ansporn“ oder „Selbstausbeutung“, „Freiheitszuwachs“ oder „sozialer Druck“, „Weg zum Glück“ oder „Wahn“ werden der Komplexität der Thematik nicht gerecht und behindern die gesellschaftliche Debatte. Bei multifaktoriellen und vielschichtigen kulturellen Entwicklungsprozessen ist es nicht leicht auseinanderzuhalten, was „von innen“ von den Menschen selbst oder „von außen“ von der Gesellschaft kommt, deren Teil die Menschen sind. Individuelle Autonomie und gesellschaftliche Orientierungsmuster und Wertstandards schließen einander in demokratischen Gesellschaften keineswegs kategorisch aus. Optimierungsbemühungen führen nicht zwingend zu Selbstausbeutung und Erschöpfung, sondern viele Menschen haben Spaß an den neuen Möglichkeiten der Weiterentwicklung, der erhöhten Selbstkontrolle und Selbstverantwortung und dem besseren Erreichen ihrer Ziele (vgl. Balandis u.a., 134; 148/KingKing, Vera u.a., 292). Selbstoptimierungnegative AspekteSchwerlich ist schon das typisch menschliche Bestreben problematisch, sich selbst zu verändern und das Beste aus sich und seinem Leben zu machen. Nur unangemessene, unerreichbare Perfektionsideale und ein übersteigerter PerfektionismusPerfektionismus/perfektionistisch und Kontrollzwang führen zu Selbstüberforderung und Minderwertigkeitsgefühlen. Weder ein erfolgszuversichtliches, strukturiertes und effektives Handeln und lebenslanges Lernen zum ständigen Effizienz-/ LeistungssteigerungErwerb neuer Kompetenzen noch auch erhöhte Selbstverantwortung, Eigeninitiative und Selbstorganisation sind einem guten Leben abträglich, sondern begünstigen es im Gegenteil. Verwerflich sind nur die sich darauf abstützenden, maßlos gesteigerten und unerfüllbaren beruflichen oder gesellschaftlichen Anforderungen an die Einzelnen. Werden auch unverantwortete, sozial oder natürlich bedingte Kosten und Risiken dem Einzelnen angelastet, so werden die Ansprüche an die individuelle Selbstverantwortung deutlich überzogen und die „Pflicht zum Glück“ wird „asozial“ (vgl. SchmidSchmid, Wilhelm 2012, 7ff./GugutzerGugutzer, Robert, 2). Es braucht eine gelassene und sachlich-nüchterne Einstellung, um diese grundlegende und hochgradige Ambivalenz der Selbstoptimierung erst einmal wahrnehmen zu können (vgl. Balandis u.a., 148). Ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatten sollten dann jedoch die zukunftsgerichteten Fragen rücken, welche Aspekte des Selbstoptimierungstrends sich positiv oder negativ auf das individuelle oder gesellschaftliche Leben auswirken und mit welchen Regulierungsmaßnahmen sich seine Weiterentwicklung gezielt beeinflussen lässt. Die Anwendungskontexte und verschiedenen Formen von Selbstoptimierung sind allerdings so vielfältig, dass pauschale Urteile wenig sinnvoll sind und sorgfältige Einzelfallanalysen durchgeführt werden müssen (vgl. AchAch, Johann 2016, 141).
1.3 Wunscherfüllende Medizin und die Abgrenzung von Therapie und Enhancement
Zum Zwecke der Selbstoptimierung werden immer stärker auch die ständig erweiterten und präziseren Verbesserungsmöglichkeiten der Medizin nachgefragt. Parallel zum Selbstoptimierungstrend wird infolgedessen auch ein Gestaltwandel im traditionellen Grundverständnis der Medizin hin zu einer wunscherfüllenden MedizinMedizinwunscherfüllende/kurative diagnostiziert (vgl. KettnerKettner, Matthias, 81f./Junker u.a., 66f.): Während die traditionelle Medizin wesentlich kurativ war und der Heilung und Prävention von Krankheiten diente, werden medizinische Verfahren in der modernen Medizin zunehmend zur Erfüllung individueller Wünsche nach Vitalität, Lifestyle, Lebensplanung, Verschönerung des Körpers und Optimierung der normalen Funktionsfähigkeiten eingesetzt. Traditionell war die Medizin am Krankheitsbegriff orientiert und konzentrierte sich auf die Pathogenese als Entstehung von Krankheiten, wohingegen Gesundheit negativ als Abwesenheit von Krankheit definiert wurde. Im Gegensatz dazu wendet sich die wunscherfüllende MedizinMedizinwunscherfüllende/kurative der Gesundheit als einer positiven und beliebig steigerbaren komplexen „soziobiologischen Qualität“ zu und kümmert sich um die Salutogenese, d.h. die Entstehung und Erhaltung von Gesundheit (vgl. KettnerKettner, Matthias, 86). Zu diesen tiefgreifenden Strukturveränderungen gehört auch ein grundlegender Wandel im Rollenverständnis und in der wechselseitigen Beziehung von Arzt und Patient: An die Stelle des zu behandelnden Patienten als einem bedürftigen, kranken oder krankheitsgefährdeten Menschen in der kurativen Medizin tritt im Rahmen der wunscherfüllenden Medizin ein gesunder und autonomer Klient oder Kunde, der eine von ihm gewünschte individualisierte Dienstleistung nachfragt. In seiner traditionellen Rolle beurteilt der Arzt mit objektivem Blick und nach etablierten Kriterien die Indikation, d.h. die Behandlungsbedürftigkeit des Patienten und übernimmt die Verantwortung für die allenfalls einzuleitende angemessene Therapie. Im neuen wunschorientierten Modell wird das Angebot hingegen nicht durch den Arzt mit seinem medizinischen Wissen und Können gesteuert, sondern letztlich durch die Nachfrage der Klienten (vgl. ebd., 87). Im Verlauf des Paradigmenwechsels in der Medizin gewinnt somit die Patientenautonomie gegenüber dem ärztlichen Paternalismus an Bedeutung, und es kommt zu einer Deregulierung und Kommerzialisierung des Gesundheitssystems. Aufgrund der dabei vorwiegend zum Einsatz kommenden biomedizinischen Methoden ist die wunscherfüllende Medizin zu einem großen Teil Enhancement-MedizinMedizinEnhancement-. Zur wunscherfüllenden Medizin zählen außerdem noch die gegen die „Schulmedizin“ gerichtete „Komplementär“- oder „Alternativmedizin“ mit einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff und die von den Kunden selbst zu zahlenden, medizinisch sinnvollen, aber nicht notwendigen „individualvertraglichen Gesundheitsleistungen (IGeL)“ (vgl. KettnerKettner, Matthias, 84ff./Junker u.a., 64f.).
Da die geschilderten medizinischen Strukturveränderungen in komplexe kulturelle Prozesse wie politische Programme zur Förderung medizinischer Forschung und Entwicklung, soziale Gesundheitssysteme und gesellschaftliche Hintergrundannahmen von Gesundheit und Krankheit eingebettet sind, bedarf es öffentlicher ethischer Diskurse über den Wandel im Grundverständnis der Medizin. Denn im Wettbewerb um Mitglieder geraten beispielsweise die Krankenkassen zunehmend unter Druck, über die kurativen Maßnahmen hinaus entsprechend der Wünsche der Kunden auch alternative und medizinisch nicht indizierte Leistungen anzubieten. Indem Ärzte von heilenden Versorgern zu medizinischen Dienstleistern und Helfern individueller Wunscherfüllung mit ganz neuen Einkommensmöglichkeiten werden und die Kunden die gewünschten Gesundheitsleistungen selbst zahlen, droht Gesundheit zu einem Konsumgut im freien Wettbewerb der kapitalistischen MarktwirtschaftGesundheitssystem, marktliberales (Präferenz-Effizienz-Modell) zu werden. Entgegen weit verbreiteter impliziter Unterstellungen ist der neue medizinische Leitbegriff einer präferenzorientierten Dienstleistungkeineswegs „wertneutral“, sondern muss kritisch reflektiert werden (vgl. MaioMaio, Giovanni 2006, 340). Befürchtet wird von Skeptikern eine problematische Verschiebung im ärztlichen Ethos von der traditionellen altruistischen „Humanität des Arztes“ zur „Egozentrik des ‚Patienten‘“ (Eberbach, 13). Ärzte und Kliniken könnten sich statt an Werten wie Gemeinwohl und Volksgesundheit bzw. an einem allgemeinmenschlichen Recht auf Gesundheit immer mehr an ökonomischen Eigeninteressen orientieren. Abzulehnen ist klarerweise ein radikalliberales Modell mit einer totalen Kommerzialisierung medizinischer Leistungen und der Einebnung des Unterschieds zwischen medizinisch indizierten und wunschmedizinischen Behandlungen, weil eine marktförmige Verteilung leicht zu einer „Fehlallokation“ der Gesundheitsleistungen führt (vgl. KettnerKettner, Matthias, 88/Kap. 3.1, Argument 2): Während zahlungskräftige Kunden ihre Luxusbedürfnisse befriedigen können, bleiben berechtigte Ansprüche auf eine medizinische Grundversorgung möglicherweise unerfüllt. Im vorliegenden Kapitel soll es aber erst einmal nur um eine deskriptive Unterscheidung von „Enhancement“ und „Therapie“ gehen, die für eine definitorische Bestimmung des „Enhancements“ unverzichtbar ist (vgl. SynofzikSynofzik, Matthias 2006, 37/Kap. 1.1). Die Möglichkeit einer solchen trennscharfen Unterscheidung wird vielfach bestritten, weil schon die Begriffe „Krankheit“ und „Gesundheit“ höchst unterschiedlich gebraucht werden. Es ist also erst einmal mittels einer Analyse der wichtigsten Krankheits- und Gesundheitsmodellezu klären, ob das Enhancement überhaupt eine eigene, klar abgrenzbare Klasse von Handlungen bezeichnet, die im Kontrast zur ethisch unkontroversen Krankheitsbehandlung einen abgesonderten ethischen Problembereich darstellt.
Читать дальше