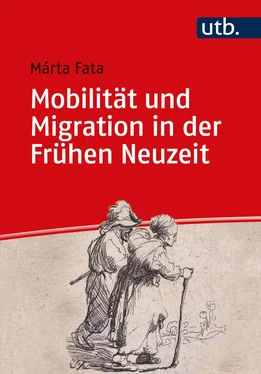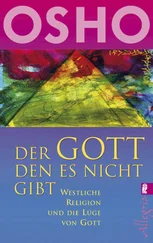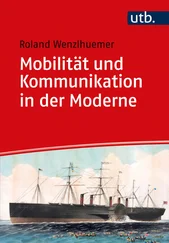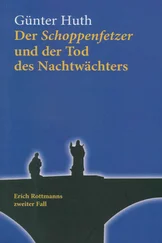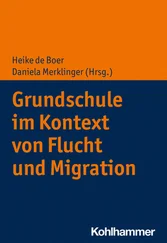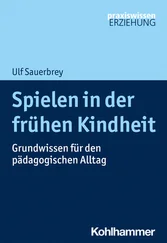Marta Fata - Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit
Здесь есть возможность читать онлайн «Marta Fata - Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mit seinem Vorgehen löste Firmian diplomatische Querelen im Reich aus. Die ersten Vertriebenen, die zur Schicht des besitzlosen Gesindes gehörten, hatten ihre Heimat innerhalb einer Woche am 24. November 1731 bei Kälte und Schnee zu verlassen, und weil der Fürstenstaat mit Bayern im Vorfeld keine Gespräche über den Durchzug der Vertriebenen geführt hatte, mussten diese an der Grenze wochenlang warten. Auch war man nirgendwo auf ihren Empfang vorbereitet, sodass sie zunächst ziellos in Süddeutschland umherirrten. Bauern und Handwerker, denen wiederum eine Frist von bis zu drei Monaten eingeräumt wurde, konnten dagegen aufgrund des Einladungspatentes des preußischen Königs vom 2. Februar 1732 bereits in 16 geordneten Zügen direkt nach Preußisch-Litauen auswandern. Damit rettete Friedrich Wilhelm I. nicht nur die Emigranten vor dem Abgrund, sondern zugleich auch das Reich vor einer politischen Krise.
Die Salzburger Emigranten zogen unter Jubel durch die protestantischen Städte und Gebiete in ihre neue Heimat, „worinnen Milch und Honig der Evangelischen Wahrheit fliesset“ – so der Untertitel des 1733 in Augsburg mit den bildlichen Darstellungen von Bäck erschienenen Buches. Die Vertriebenen wurden unterwegs von einer Welle der Hilfsbereitschaft getragen. Sie galten als Vorbilder für Glaubensfestigkeit, weshalb ihr Schicksal auch propagandistisch in zahlreichen Schriften, Flugblättern, Liedern und bildlichen Darstellungen benutzt wurde, um die Stimme gegen die Vertreibung aus religiösen Gründen zu erheben.
Allerdings war die aufgrund religiöser Solidarität geleistete Hilfe für die Salzburger nicht mit einer allgemeinen Bereitschaft der protestantischen Fürsten gleichzusetzen, die vertriebenen Glaubensgenossen aufzunehmen. Besonders aufschlussreich ist die unterschiedliche Haltung von Brandenburg-Preußen und Württemberg. Der württembergische Herzog Eberhard Ludwig zeigte sich gegenüber den Vertriebenen restriktiv. Es wurde zwar bei der herzoglichen Regierung eine Deputation eigens für die Vertriebenen eingerichtet und die Beamten wurden angehalten, ihnen den Durchzug zu erleichtern. Doch dauerhaft aufgenommen werden sollten nur jene wenigen Migranten, bei denen ein besonderer ökonomischer Nutzen zu erwarten oder spezifische handwerkliche Fertigkeiten vorhanden waren. Andere sollten dazu bewogen werden, weiterzuziehen und das Land zu verlassen. Dagegen erklärte sich der preußische König bereit, die Mehrheit der Vertriebenen aufzunehmen, um seine unter Arbeitskräftemangel leidenden Gebiete in Preußisch-Litauen voranzubringen. Nicht die Solidarität mit den eigenen Glaubensgenossen, sondern eigene, ökonomische Anliegen standen in beiden Fällen an erster Stelle: in Württemberg der Blick auf die begrenzten eigenen Ressourcen, die keine Aufnahme von Einwanderergruppen ermöglichten, in Preußen die Unterbevölkerung des Landes, die eine solche Aufnahme erforderten.
Durch gewisse Ähnlichkeiten der hier skizzierten aktuellen und historischen Migrationsereignisse drängt sich die folgende Frage regelrecht auf: Welchen Mehrwert besitzen historische Untersuchungen über Wanderungsbewegungen? Migration gehört zum Wesen des menschlichen Lebens oder wie Klaus J. Bade, der Begründer der Historischen Migrationsforschung in Deutschland, formulierte: „Migration ist ein Konstituens der Conditio humana wie Geburt, Vermehrung, Krankheit und Tod. Die Geschichte der Wanderungen ist so alt wie die Menschheitsgeschichte; denn der Homo sapiens hat sich als Homo migrans über die Welt ausgebreitet.“[2] Historische Darstellungen rufen somit in Erinnerung, dass Menschen seit jeher aus den unterschiedlichsten Gründen freiwillig oder unfreiwillig wanderten.
„Trotz dieser Tatsache wird nach wie vor am Mythos der Sesshaftigkeit der (Welt-)Bevölkerung festgehalten“, schreibt Sylvia Hahn in ihrem Beitrag über die allgemein verbreitete Ansicht, dass es in der Vergangenheit noch nie so viele Wanderungsbewegungen gab wie heute.[3] Die Ursache für dieses Bild sieht Hahn historisch begründet: Denn im 19. Jahrhundert, als die großen Massenauswanderungen und die durch die Industrialisierung und Urbanisierung hervorgerufenen Wanderungen breite Bevölkerungsschichten verunsicherten, wurde Sesshaftigkeit zu den „wichtigsten socialen und wirtschaftlichen Tugenden“[4] erhoben. Nicht anders verhielt es sich in der Frühen Neuzeit, insbesondere zur Zeit der regen Binnenwanderungen und beginnenden Massenauswanderungen im 17. und 18. Jahrhundert, als die Policeyordnungen die Sesshaftigkeit zur Norm erhoben haben. Sesshaftigkeit wurde immer mehr zu einer positiven gesellschaftlichen Errungenschaft, während Mobilität als eine negative, ja in vielen Fällen sogar deviante Verhaltensweise galt. In der heutigen Angst vor Migrationen steckt auch diese, in der kollektiven Erinnerung verankerte historische Bewertung. Untersuchungen über historische Wanderungsbewegungen können helfen, diese Angst zu nehmen, damit aktuelle Herausforderungen mit der erforderlichen Nüchternheit betrachtet werden.
Innerhalb der Geschichtswissenschaft setzt sich die Historische Migrationsforschung als eine noch immer wachsende Teildisziplin zur Aufgabe, räumliche Bevölkerungsbewegungen in der Geschichte zu erfassen, zu beschreiben und zu erklären. Jochen Oltmer hat diese Aufgabe in elf Punkten konkretisiert.[5] Die historisch ausgerichtete Migrationsforschung fragt demnach
1.
nach den Hintergründen und Bedingungen von Migrationsentscheidungen,
2.
den Mustern räumlicher Bewegungen zwischen Herkunfts- und Zielgebieten im Kontext der Wechselbeziehungen zwischen den beiden Räumen,
3.
den Netzwerken und Organisationen von Migrationen,
4.
den Erwartungen und Erfahrungen von Migranten,
5.
den Dimensionen, Formen und Folgen von Migrationen,
6.
den Lebensverhältnissen und Lebensverläufen von Migranten,
7.
der Identitätsbildung im Prozess von Migration und Integration,
8.
den Bemühungen und Einflussmöglichkeiten von Obrigkeiten, Staaten und Institutionen um Migration und Integration,
9.
der Wissensproduktion über Migration,
10.
der Genese von Migration als Medienereignis und
11.
den Rückwirkungen der Abwanderung auf Menschen und Strukturen in den Ausgangsräumen.
Eine besondere Herausforderung von migrationshistorischen Darstellungen lautet, diese Fragen in dem jeweiligen zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext zu beantworten. Zur Zeit der Salzburger Exulanten bedeutete dieser Kontext: Ständegesellschaft, ein vormoderner Staat, nicht vorhandene Rechtsgleichheit, fehlende universelle Menschen- und Freiheitsrechte; heute bedeutet er: Rechtsgleichheit, Menschenrechte und starke, im Sinne einer Staatsverfassung wirkende staatliche Institutionen.
Zu diesem Buch
Im Mittelpunkt dieser Einführung steht die Untersuchung von Wanderungsbewegungen in der Zeit zwischen 1500 und 1800 mit dem geografischen Schwerpunkt des Territoriums des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation mit seinen benachbarten Gebieten. Dieser Zugang erscheint aus zwei Gründen sinnvoll: Erstens waren die Reichsterritorien in der Frühen Neuzeit durch zahlreiche dynastische, politische und ökonomische Verflechtungen sowie kulturelle Netzwerke mit ihren Nachbarn eng verbunden, die vielfältige und mehrere Jahrhunderte lang währende migratorische Beziehungen hervorbrachten. Das Alte Reich bildete zudem einen in alle Richtungen offenen Migrationsraum. Dort waren Wanderungsbewegungen Teil der europäischen und gerade in der Frühen Neuzeit allmählich globale Ausmaße annehmenden Migrationen, auch wenn die einzelnen Regionen unterschiedlich stark in diese Migrationsprozesse eingebunden waren. Zweitens erscheint die geografische Begrenzung auch deshalb sinnvoll, weil einzelne europäische Großregionen aufgrund ihrer unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialstrukturen signifikante Unterschiede in ihren Migrationsbewegungen aufweisen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.