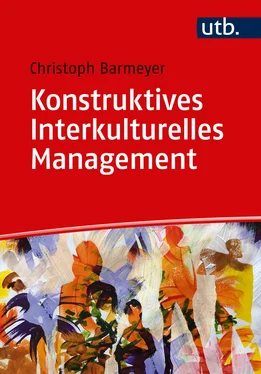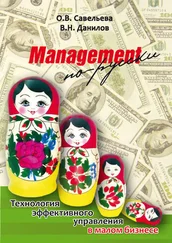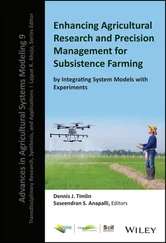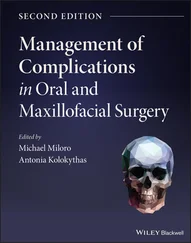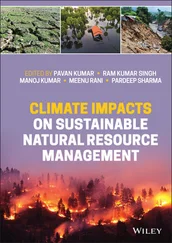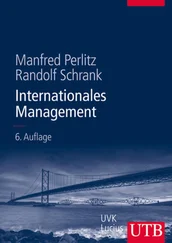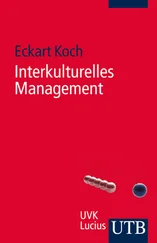Christoph Barmeyer - Konstruktives Interkulturelles Management
Здесь есть возможность читать онлайн «Christoph Barmeyer - Konstruktives Interkulturelles Management» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Konstruktives Interkulturelles Management
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Konstruktives Interkulturelles Management: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Konstruktives Interkulturelles Management»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Konstruktives Interkulturelles Management — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Konstruktives Interkulturelles Management», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Meinen Mitarbeitern am Lehrstuhl, die die Hoch- und Tiefphasen dieses Buches geduldig und konstruktiv begleiteten und kritisch das Manuskript durchgearbeitet oder zu den Kapiteln beigetragen haben, möchte ich herzlich danken: Ulrike Buchheit, Bruno Gandlgruber, Sina Großkopf, Andreas Landes, Sybille Maier, Martina Maletzky, Sebastian Öttl und Stephanie Smolik ebenso wie den studentischen Hilfskräften Susanne Dierl, Jenny Eberhardt, Theresa Hümmer, Constanze Rath, Lena Schindler, Maria Wilhelm und Sabine Wiesmüller, die mich bei Recherchen tatkräftig unterstützt haben. Auch einige Masterstudierende haben direkt oder indirekt an dem Buch mitgewirkt: Anas Alhashmi, Rebecca Gramlich, Friederike Hacke, Tatjana Horch, Philipp Krug, Madita Mielenhausen und Carina Stumpf. Günter Presting und Johanna Mohrmann vom Verlag Vandenhoeck & Ruprecht danke ich für ihre Geduld und die durchgehend angenehme und professionelle Zusammenarbeit. Verena Simon danke ich für ihre Reaktivität und die professionelle Endredaktion des Buchs. Allen weiteren Personen, die ich hätte erwähnen müssen, es aber nicht getan habe – sie mögen mir dies verzeihen! – sei herzlich gedankt.
Internationalisierung von Organisationen als Kontext der Interkulturalität
Makrokontext: Internationalisierung und Globalisierung
Der Kontext jeglicher Interkultureller Managementforschung ist das Phänomen, das mit Internationalisierung und Globalisierung bezeichnet wird: das Zusammenrücken verschiedener Kontinente und Länder, das Miteinanderumgehen von Personen unterschiedlicher Herkunft, die bewusste Nutzung der gesamten Welt als politisches, gesellschaftliches und wirtschaftliches Tätigkeitsfeld. Dass diese Internationalisierung und Globalisierung ein Ergebnis der technologischen Entwicklung von der Mobilität bis hin zur Kommunikation ist, liegt auf der Hand. Beide Begriffe, die sich auch synonym verwenden lassen, verweisen auf die Gleichzeitigkeit von Passivität und Aktivität ( Tab. 2):
–Passivität betrifft die Verwischung von Grenzen, denen Akteure weltweit ausgesetzt sind. So tragen der Anstieg internationaler Migration oder die Möglichkeiten der kommunikativen Erreichbarkeit von Menschen untereinander zur Internationalisierung ihrer Kontexte bei.
–Aktivität hingegen betrifft die gezielte Verwischung von Grenzen, die durch Akteure absichtsvoll betrieben wird. Immer mehr Organisationen weiten ihre ökonomischen Aktivitäten (Unternehmen) und nicht-ökonomischen Aktivitäten (Non-Profit-Organisationen) auf immer weitere Regionen der Welt aus.
| Beispiel Passivität: Zuwanderung | Beispiel Aktivität: Export |
| »Deutschland schrumpft, heißt es in allen Prognosen. In Wahrheit aber nimmt die Bevölkerung in den letzten Jahren zu. Der Grund: Nicht die Zahl der Geburten, wohl aber die Zahl der Zuwanderer entwickelt sich im Saldo positiv: plus 430.000 Menschen im Jahr 2013, plus 500.000 Menschen 2014.« (Handelsblatt, 4. August 2014) | »Nichts scheint die hiesige Exportindustrie stoppen zu können. 2014 haben deutsche Unternehmen so viele Waren in alle Welt geliefert wie nie zuvor. Wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte, setzten die Firmen Produkte im Wert von 1,13 Billionen Euro im Ausland ab – ein Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahr.« (Handelsblatt, 10. Februar 2015) |
Tab. 2: Beispiele zu Passivität und Aktivität von Internationalisierung und Globalisierung
In der Konsequenz intensivieren sich mit Internationalisierung und Globalisierung grenzüberschreitende Kontakte, soziokulturelle Diversität in Gesellschaften und soziokulturelle Diversität innerhalb von Organisationen: »Immer wieder bestätigt auch der triviale Kern, der sich im Inneren des Begriffs verbirgt: die Welt wird zusehends ›kleiner‹ und Entferntes wird immer stärker miteinander verknüpft. Zugleich wird sie ›größer‹, weil wir noch niemals weitere Horizonte überschauen konnten« (Osterhammel/Petersson 2012, 8). Der Kontakt zwischen Nationen und ihren Gesellschaften intensiviert sich kontinuierlich durch komplexe Transfer- und Diffusionsprozesse sowie durch Migration. Die Nationen reagieren darauf, indem sie aktiv mitgestalten – etwa durch die Einrichtung von Regeln und Institutionen, die auf einer dem Nationalstaat übergeordneten Ebene angesiedelt sind, der Supranationalisierung (Sorge 2009, 10).
Die Forschung zu Internationalisierung und Globalisierung befasst sich mit internationalen Verflechtungen, und zwar häufig in kritischer Weise mit deren politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Ursachen und Effekten. Hierzu gehört vor allem die Kritik an globalen Machtstrukturen, ausgelöst, entwickelt und aufrechterhalten durch bestimmte Nationalstaaten oder durch multinationale Unternehmen, die zu gesellschaftlicher Ungleichheit und ökonomischen Asymmetrien beitragen: »Globale Verflechtungen werden von Staaten, Firmen, Gruppen, Individuen aufgebaut, erhalten, umgeformt und zerstört. Sie sind Gegenstand von Interessenkonflikten und Politik. Sie produzieren Gewinner und Verlierer – gleiches gilt allerdings auch für die Zerstörung globaler Strukturen« (Osterhammel/Petersson 2012, 112). Es kommen Dynamiken der Entnationalisierung oder Denationalisierung in Gang, die zu Macht- und Bedeutungsverlust von Nationalstaaten führen können, wie es etwa der Soziologe Ulrich Beck betont: »Globalisierung ermöglicht, was vielleicht im Kapitalismus latent immer galt, aber im Stadium einer sozialstaatlich-demokratischen Bändigung verdeckt blieb: dass die Unternehmen, insbesondere die global agierenden, nicht nur eine Schlüsselrolle in der Gestaltung der Wirtschaft, sondern der Gesellschaft insgesamt innehaben […]. Die global agierende Wirtschaft untergräbt die Grundlagen der Nationalökonomie und der Nationalstaaten« (Beck 1997, 14).
Globalisierung ist dabei kein neues Phänomen – in der Vergangenheit trug bereits der europäische Kolonialismus Züge der Globalisierung –, sondern hat durch die Modernisierung ein neues Ausmaß angenommen: »Globalisierung hängt mit Modernisierung eng zusammen. Strukturbildende Fernverpflichtungen gab es schon in vormoderner Zeit. Aber erst die kulturelle Kreativität der europäischen Moderne – Stichworte wären Rationalität, Organisationen, Industrie, Kommunikationstechnologie – ermöglichte Verflechtungen von neuartiger Reichweite und Intensität. Umgekehrt spielte sich die Entfaltung der europäischen Modernen von Anfang an in einem globalen Rahmen ab. Asien, China und die islamische Welt, später die beiden Amerikas, Afrika und die Südsee – sie alle lieferten Bezugspunkte für den Selbstentwurf Europas als einer universalen Zivilisation« (Osterhammel/Petersson 2012, 112).
Eine zentrale Forschungsfrage der Internationalisierung betrifft »Konvergenz versus Divergenz«: Nähern sich die Wege, wie internationale Organisationen und ihre Akteure mit kultureller Vielfalt umgehen, durch Diffusions- und Transferprozesse einander an (Konvergenz), oder bilden sich kulturspezifisch unterschiedliche Wege der Bewältigung kultureller Vielfalt heraus (Divergenz)? Die Konvergenzthese geht von einer Angleichung kultureller und institutioneller Merkmale aus und besagt, dass Organisationen und Management rationale Muster zur Lösung betrieblicher Probleme aufweisen und dass das Streben nach Effizienz keinen Spielraum für unterschiedliche kulturelle Lösungen zulässt. Die Divergenzthese dagegen unterstellt eine Zunahme kultureller und institutioneller Merkmale; deshalb müssen Organisationen und Management den nationalen kulturellen Gegebenheiten Rechnung tragen, um erfolgreich zu sein ( Tab. 3). Seit Jahrzehnten findet diese Diskussion statt (Albert 1991; Whitley 1999; D’Iribarne 2001; Kieser/Walgenbach 2010; Adler 2008; Sorge 2009; Barmeyer/Öttl 2011; Scholz 2014a). So herrschte lange Zeit in der Managementlehre und Organisationsforschung die Annahme, Managementmodelle und -praktiken seien universell, was sich in den Debatten zwischen den Positionen Culture Free (Hickson/McMillan 1981; Maurice/Sorge 2000) und Culture Bound (Hofstede 1980; D’Iribarne 1989) niederschlug.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Konstruktives Interkulturelles Management»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Konstruktives Interkulturelles Management» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Konstruktives Interkulturelles Management» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.