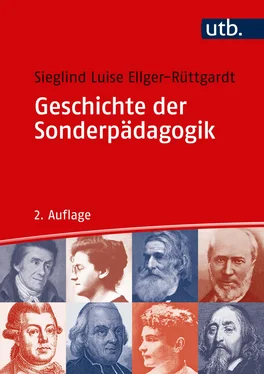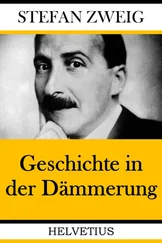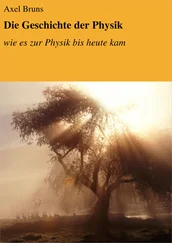Das zweite Beispiel: Im Januar 1997 schrieb mir eine Frankfurter Sonderschullehrerin einen Brief und bat mich um fachlichen Rat hinsichtlich der Bewertung der geschichtlichen Vergangenheit des Namenspatrons ihrer Schule, des ehemaligen Frankfurter Stadtschulrats August Henze. Auch Henze war aufgrund seiner NS-Vergangenheit in die Kritik geraten. Ausgelöst wurde diesmal der Vorgang vom Landesverband des Verbandes Deutscher Sonderschulen in Hessen, der sich im Februar 1996 an das Kollegium der August-Henze-Schule gewandt hatte und darin u. a. schrieb:
„Über Gustav Lesemann und August Henze hörte man – wenn überhaupt – lange Zeit nur Positives. Seit die Geschichte des Hilfsschulwesens etwas näher und kritischer erforscht wird, erfährt das strahlende Bild deutlich braune Flecken […] Allerdings steht Lesemann mit seiner vehementen Unterstützung des NS-Eugenik-Programms im VdHD [Verband der Hilfsschulen Deutschlands, gegründet 1898; E.-R.] nicht alleine. Sein Freund und langjähriger Weggefährte August Henze hat sich ebenso unmißverständlich und schon vor 1933 für die Zwangssterilisierung der ‚Minderwertigen‘ und ‚Schwachsinnigen‘ ausgesprochen.“ (Vds-Landesverband Hessen 1996)
Die seit 1996 heftig geführte Debatte endete schließlich im Februar 1998 mit der Aufhebung des Namens August Henze für die Sprachheilschule in Frankfurt a. M.
historisches Interesse
Immer, wenn in der Gegenwart etwas fragwürdig, brüchig wird, stellt sich die Frage nach dem Warum, Woher – und damit nach Geschichte. Nicht zufällig nimmt seit dem Fall der Mauer jene Zahl von Büchern zu, die sich mit der deutschen Frage und damit der deutschen Geschichte befassen. Ein neu erwachendes historisches Interesse ist auch in der Heil- und Sonderpädagogik seit einiger Zeit erkennbar, und dieses wird verständlich vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verunsicherung des Selbstverständnisses der deutschen Heil-, Sonder- oder Behindertenpädagogik.
Selbstverständnis Sonderpädagogik
Einstmals mit tonangebend in der Welt und damit Vorbild für viele andere Länder, befindet sich diese Spezialdisziplin der Pädagogik seit den 70er Jahren in einer zunehmenden Identitätskrise. Sie muss sich damit auseinandersetzen, dass in einer Vielzahl westlicher demokratischer Staaten das sozialpolitische und pädagogische Hilfe- und Fördersystem für Menschen mit Behinderung eine andere Richtung eingeschlagen hat als in Deutschland. Weg von der „Besonderung“ und Separierung hin zur „Normalisierung“ der Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderungen – so lässt sich diese Richtung schlagwortartig beschreiben.
Das Ziel ist stets überall identisch, nämlich ein Höchstmaß an gesellschaftlicher Eingliederung zu erreichen – unterschiedlich sind allerdings die Wege dorthin: Während man in Deutschland, dem deutschsprachigen Raum und in Holland in der Vergangenheit auf ein hochspezialisiertes System von Sondereinrichtungen setzte, ging man in den skandinavischen und angelsächsischen, später auch den romanischen Ländern mehr und mehr den Weg der stärkeren Einbeziehung sonderpädagogischer Förderung in das allgemeine Schulwesen, bekannt unter dem Stichwort der Integration bzw. der Inklusion.
historische Hypothek
Als besondere Belastung erweist sich für die deutsche Diskussion, dass das System der „Behindertenhilfe“ und seine Akteure im „Dritten Reich“ in großen Teilen versagt haben, dass es eine jüngste historische Epoche in Deutschland gegeben hat, in der – entgegen allen traditionellen humanistischen Ansprüchen – Menschen mit Behinderungen in ihrer Existenz bedroht waren. Diese Hypothek war lange Zeit verdrängt – nicht zuletzt auch in der DDR. Und somit wirft die wiedergewonnene deutsche Einheit auch in der „Behindertenpädagogik“ die Frage nach der Geschichte neu auf. Gerade im Hinblick auf eine Neuformulierung behindertenpädagogischen Selbstverständnisses wird man nicht daran vorbeikommen, sich auch kritisch mit jenem deutschen Teilstaat auseinanderzusetzen, der von seinem Anspruch her als ein Anwalt von Menschen mit Schädigungen – so der Terminus – auftrat.
Geschichtliches Interesse in der Sonderpädagogik ist auch nicht verstehbar ohne eine Berücksichtigung des Wandels des Selbstverständnisses von Geschichte allgemein und von Erziehungsgeschichte im Besonderen. Geschichte ist nicht mehr wie zur Zeit des Historismus im 19. Jahrhundert vorrangig eine Geschichte der Haupt- und Staatsaktionen (also politische Geschichte, Geschichte der großen Männer), sondern sie versteht sich zunehmend als kritische Sozialwissenschaft und damit als ein Instrument der Aufklärung und Deutung von Vergangenheit und Gegenwart.
„In Wahrheit hat es der Historiker nicht mit der Vergangenheit zu tun, sondern immer nur mit ihrer Interpretation […] Es gibt keine Wirklichkeit ohne ihre Repräsentation […] Historiker sind Anthropologen des Vergangenen. Sie versuchen, jenen Menschen, die in den Texten der Vergangenheit zu uns sprechen, eine Stimme zu verleihen und sie zu verstehen.“ ( Baberowski 2005, 22)
Selbstverständnis Geschichte
Geschichte wird also nicht mehr als „objektive“ Wissenschaft verstanden, die erzählt, wie es „wirklich“ war. Mit Blick auf Foucaults historischen Ansatz schreibt U. Brieler, dass historische Praxis nichts anderes sein kann „als Interpretation in und an der Gegenwart unter einer aktuellen Fragestellung“ (1998, 280).Geschichte, so allgemeiner Konsens, ist stets standortgebunden und nimmt ihren Ausgang von relevanten Fragen der Gegenwart. Daraus folgt, dass jede historische Forschung ihr erkenntnisleitendes Interesse offenlegen muss. Eine um Aufklärung bemühte Geschichtsschreibung ist unvereinbar mit den Positionen einer dogmatischen materialistischen Geschichtsauffassung, aber ebenso mit einer vermeintlich wertfreien, narrativen (erzählenden) Ideengeschichte. Gefragt ist vielmehr eine pluralistische, kritische Geschichtsschreibung, die unterschiedliche methodische Zugangsweisen integriert und die daher Momente von Kultur- und Alltags-, von Sozial-, Institutionen- und Ideengeschichte als prinzipiell gleichberechtigt anerkennt ( Eibach/Lottes 2002; Tenorth 2008). Geschichtliches Verständnis soll schließlich dazu beitragen, den professionellen Pädagogen eine Orientierung in der Gegenwart zu ermöglichen:
„Geschichte der Pädagogik, das ist […] immer auch der Versuch, an der Erziehungswirklichkeit der Vergangenheit Herkunft und Möglichkeiten der Pädagogik in der Gegenwart zu analysieren und den professionellen Pädagogen eine Tradition zu eröffnen, in der er eine zukunftsfähige berufliche Identität gewinnen kann.“ (Tenorth 2008, 7)
Der Sinn von Geschichte – so können wir zusammenfassen – zielt auf das handlungsfähige Subjekt, das seine Identität in Gegenwart und Zukunft durch die Begegnung mit dem Vergangenen erfährt. Die Beschäftigung mit der Geschichte nimmt stets ihren Ausgang von Problemen der Gegenwart, sie hilft, gegenwärtige Phänomene besser zu verstehen, und sie eröffnet Perspektiven für gesellschaftliches Handeln ( Ellger-Rüttgardt 2010; 2016).

Wenn wir in der Gegenwart von Sonderpädagogik sprechen, dann verstehen wir darunter einen Oberbegriff für die verschiedenen sonderpädagogischen Einzeldisziplinen. Es wird deutlich werden, dass dieses Verständnis bereits Ergebnis eines historischen Prozesses ist, denn am Anfang der Entwicklung vor mehr als 250 Jahren gab es zunächst nur eine Pädagogik der Taubstummen, der Blinden und später auch der „Geistesschwachen“, aber keine ordnende, übergreifende Begrifflichkeit – diese erfolgte zum ersten Mal im 19. Jahrhundert mit dem zweibändigen Werk „Die Heilpädagogik“ von Heinrich Marianus Deinhardt, dessen erster Band 1861erschien und der sich schwerpunktmäßig der „Idiotie“ und den „Idiotenanstalten“ widmete, gleichwohl aber das Gesamtgebiet der Heilpädagogik im Auge hatte. „Heilpädagogik“ als Oberbegriff wird wenig später von dem Taubstummen- und „Schwachsinnigenpädagogen“ Heinrich Ernst Stötzner in seiner Schrift „Altes und Neues aus dem Gebiete der Heilpädagogik“ von 1868 unter Berufung auf das Werk von Deinhardt aufgegriffen, indem er den Gegenstand dieses „neuen Zweiges der Pädagogik“ wie folgt umschreibt:
Читать дальше