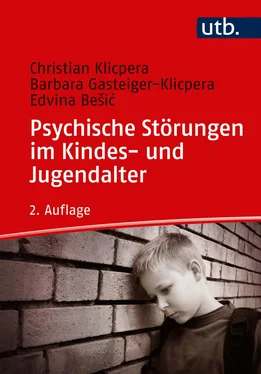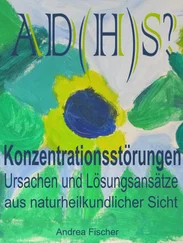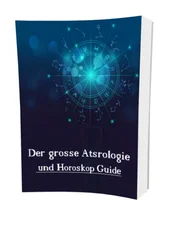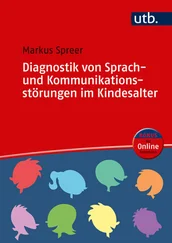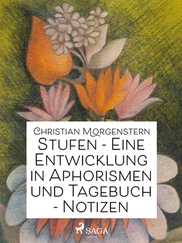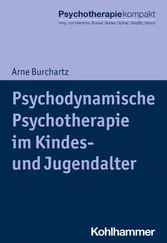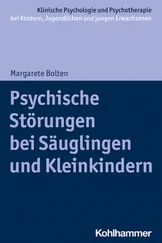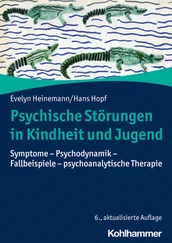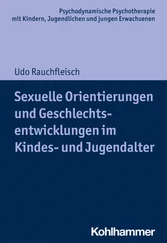19 2.11 Therapie
20 3 Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen
21 3.1 Diagnostische Kriterien
22 3.2 Symptomatik
23 3.3 Epidemiologie
24 3.4 Untergruppen
25 3.5 Komorbidität und Differenzialdiagnose
26 3.6 Verlauf
27 3.7 Ursachen
28 3.8 Behandlung und Prognose
29 4 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
30 4.1 Diagnostische Kriterien der PTBS (nach DSM-5)
31 4.2 Symptome der PTBS bei Kindern unter sechs Jahren
32 4.3 Häufigkeit
33 4.4 Verlauf
34 4.5 Komorbidität
35 4.6 Diagnostik
36 4.7 Behandlung
37 5 Depressive Störungen
38 5.1 Symptome der Depression bei Kindern und Jugendlichen
39 5.2 Klassifikation
40 5.3 Diagnostik und diagnostische Instrumente
41 5.4 Häufigkeit, Risikofaktoren
42 5.5 Komorbidität
43 5.6 Verlauf
44 5.7 Ursachen der Depression
45 5.8 Therapie der Depression
46 6 Suizide und Suizidversuche
47 6.1 Definition und Klassifikation
48 6.2 Epidemiologie
49 6.3 Klinisch-psychologische Störungen bei Suizid und Suizidversuchen
50 6.4 Ursachen
51 6.5 Prognose und Verlauf
52 6.6 Prävention
53 6.7 Therapie
54 7 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
55 7.1 Diagnostische Kriterien und Klassifikation
56 7.2 Prävalenz
57 7.3 Komorbidität
58 7.4 Symptomatik
59 7.5 Soziale Anpassungsschwierigkeiten hyperaktiver Kinder
60 7.6 Verlauf der Hyperaktivität
61 7.7 Die Frage nach den zugrunde liegenden Mechanismen
62 7.8 Ursachen der Hyperaktivität
63 7.9 Interventionen
64 8 Störungen des Sozialverhaltens (dissoziale Störungen)
65 8.1 Definition
66 8.2 Diagnostik
67 8.3 Häufigkeit
68 8.4 Verlauf
69 8.5 Erklärungsansätze
70 8.6 Prävention und Intervention
71 9 Alkoholkonsumstörung
72 9.1 Definition
73 9.2 Epidemiologie
74 9.3 Klinisches Bild
75 9.4 Ätiologie und Genese
76 9.5 Untergruppen
77 9.6 Prävention
78 9.7 Verlauf und Prognose
79 9.8 Therapie
80 10 Störungen im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen
81 10.1 Definition
82 10.2 Auswirkungen des Drogengebrauchs: die häufigsten Substanzen
83 10.3 Prävalenz
84 10.4 Verlauf
85 10.5 Komorbidität
86 10.6 Ursachen
87 10.7 Therapie
88 11 Essstörungen im Kleinkindalter
89 11.1 Häufigkeit von Ernährungsstörungen
90 11.2 Behandlung
91 11.3 Nichtorganische Gedeihstörung (NOFTT/„Non-Organic Failure to Thrive“)
92 12 Essstörungen im Jugendalter
93 12.1 Anorexia nervosa
94 12.2 Bulimia nervosa
95 12.3 Binge-Eating-Störung (BES)
96 13 Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexueller Missbrauch
97 13.1 Definition
98 13.2 Epidemiologie
99 13.3 Kindesvernachlässigung
100 13.4 Körperliche Misshandlung
101 13.5 Sexueller Missbrauch
102 Fragenkatalog
103 Stichwortverzeichnis
1 Klassifikation psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter
In der Klinischen Psychologie ist in den letzten Jahrzehnten eine besondere Wertschätzung für die Klassifikation psychischer Störungen festzustellen. Dies gilt mindestens so sehr für die Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters wie für jene des Erwachsenenalters und wird darauf zurückgeführt, dass eine angemessene Klassifikation eine systematische Sammlung von Erfahrungen
– über die Genesevon Störungen,
– über den Verlaufvon Störungen,
– über Einflussfaktorenauf den Verlauf sowie
– über den Erfolg von therapeutischen Interventionenbei bestimmten Störungen
ermöglicht. Zudem wurde deutlich, dass die allgemeine Verbreitung eines einheitlichen Klassifikationssystems die Kommunikation wesentlich erleichtert, weil dadurch in komprimierter Form wichtige Informationen über die Art der Schwierigkeiten mitgeteilt werden können. Dies kommt nicht nur der wissenschaftlichen Kommunikation zugute, sondern verbessert auch Zuweisungsentscheidungen innerhalb des psychosozialen Versorgungsnetzes und spezifische Indikationsstellungen für Therapien. Somit können gesundheitspolitische Maßnahmen auf eine bessere Grundlage gestellt werden, indem etwa die Häufigkeit bestimmter psychischer Störungen besser untersucht und aufgrund der erworbenen Zahlen eine Bedarfsplanung für die psychosoziale Versorgungder Bevölkerung möglich wird. Schließlich wird daran die Hoffnung geknüpft, dass die Trennung der Klinischen Psychologie in verschiedene Schulen durch die vorrangige Orientierung an einzelnen Störungsbildern auf eine klare empirische Grundlage gestellt und damit zugunsten effektiver störungsspezifischer Interventionen überwunden werden kann.
1.1 Grundprinzipien bei der Identifizierung charakteristischer Formen von psychischen Störungen
Gegenüber der Auffassung, dass es lediglich eine ungeheure Mannigfaltigkeit psychischer Probleme gibt, dominierte bereits vor fünfzig Jahren die Überzeugung – wie Jaspers (1965) in seinem auch heute noch lesenswerten Überblick über die Geschichte der psychiatrischen Krankheitslehre feststellt –, dass es in der Psychiatrie – ähnlich wie in anderen Bereichen der Medizin – natürliche Krankheitseinheiten geben müsse. Dieser Auffassung folgend, wurden verschiedene Zugänge entwickelt, um verschiedene Formen psychischer Störungen zu definieren und voneinander abzugrenzen.
Eine erste Möglichkeit, die besondere Eigenart psychischer Probleme zu kennzeichnen, liegt darin, die im Vordergrund stehenden Beschwerdenals Ausgangspunkt der Abgrenzung heranzuziehen. Im Laufe der Entwicklung haben fast alle psychopathologischen Symptome als Krankheitseinheiten fungiert: Halluzinationen, Wahn, die Inhalte mancher Handlungen (z. B. Pyromanie, Kleptomanie). Auch wenn die Definition psychischer Probleme über ein im Vordergrund stehendes Symptom heute eher als unzureichend betrachtet wird, so gibt es in den gegenwärtigen Klassifikationssystemen doch weiterhin eine Reihe an Störungen, bei denen dies der Fall ist (etwa das Einnässen und Einkoten).
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, aus Symptomverkoppelungen die Einheit eines „Symptomenkomplexes“– ein Begriff, den bereits Jaspers (1965) zur Kennzeichnung dieser Form von Einheitsbildung eingeführt hat – zu konstruieren. Ausgangspunkt ist in diesem Fall entweder die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens, also die Identifizierung eines Musters, das auch mit statistischen Methoden nachvollziehbar sein müsste, oder die Bildung einer Einheit, die durch das Zusammenwirken mehrerer Gesichtspunkte zustande kommt, sich aber trotzdem – um mit Jaspers (1965) zu sprechen – durch die anschauliche Erfahrung gleichsam aufzwingt. Hierbei sollte ein innerer Zusammenhang zwischen den Symptomen bestimmend sein, indem diese gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen oder ein erklärbarer Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Dieses Vorgehen erfordert eine sorgsame klinische Beobachtung und Analyse. Während die klassische Psychopathologie dies in erster Linie durch eine prägnante Beschreibung psychischer Störungen anhand konkreter Fallbeispiele geleistet hat, steht heute das Bemühen um genaue Definitionen einzelner Merkmale sowie deren Ausprägungsgrad im Vordergrund, wodurch eine Replikation der Beobachtungen und eine statistische Analyse von Zusammenhängen zwischen den Einzelmerkmalen möglich wird.
Читать дальше