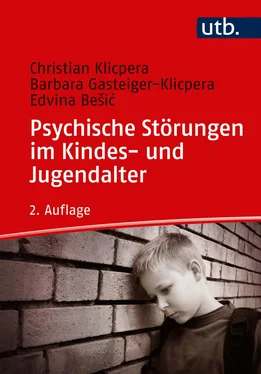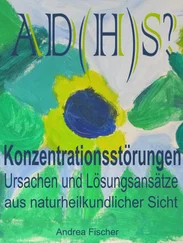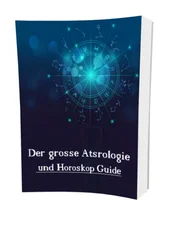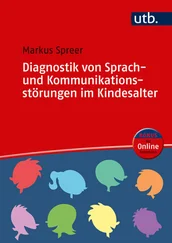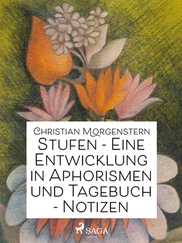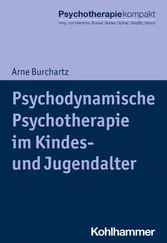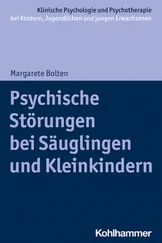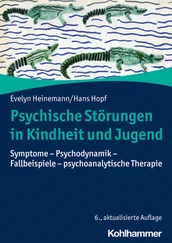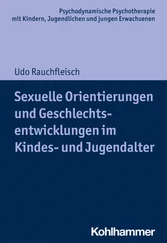Das derzeit gebräuchlichste Diagnosesystem ist das DSM-5. Es berücksichtigt die unterschiedlichen Dimensionen psychischer Krankheiten durch die Verwendung eines „hybriden“ Modells zur Diagnostik klinischer Störungen. Zudem stellt es auch die Bedeutung der subjektiven Belastung bei psychischen Schwierigkeiten, des kulturellen Hintergrunds, des Alters und Geschlechts der Personen in den Vordergrund.
Bei jeder Klassifikation ist auch die Kehrseite zu beachten, nämlich die Gefahr, dass mit der Zuschreibung einer Diagnose auch eine Etikettierung des Einzelnen erfolgt. Damit wird seine Persönlichkeit auf die Störung festgeschrieben und seine weiteren Möglichkeiten werden eingeschränkt. Mit bestimmten Etikettierungen, insbesondere bei psychischen Störungen, sind negative Assoziationen verbunden. Die Personen werden in einem ungünstigeren Licht gesehen und in einer weniger positiven Weise behandelt. Dieses Verhalten der anderen Menschen hat einerseits negative Auswirkungen auf die Anpassung des Etikettierten. Andererseits können mit einer Etikettierung auch positive Seiten verknüpft sein, nämlich die Bereitschaft von anderen, Hilfe und Unterstützung anzubieten, sowie ein Schutz der betroffenen Person.
Literatur
American Psychiatric Association (APA). (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) . Washington, DC.
American Psychiatric Association (APA). (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R) . Washington, DC. [Deutsche Überarbeitung: Wittchen, H.-U., Saß, H., Zaudig, M., & Koehler, K. (1991). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-III-R). 3. Aufl. Weinheim: Beltz.]
American Psychiatric Association (APA). (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Washington, DC.
American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5. Aufl). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Berberich, G., & Zaudig, M. (2015). Das alternative Modell für Persönlichkeitsstörungen in DSM-5. Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie , 9(3), 155–163.
Cooper, J. E., Kendell, R. E., Gurland, B. J., Sharpe, L., Copeland, J. R. M., & Simon, R. (1972). Psychiatric diagnosis in New York and London . London: Oxford University Press.
Dilling, H., Mombour, W., & Schmidt, M. H. (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen – ICD-10 . Bern: Huber Verlag.
Falkai, P., & Wittchen, H.-U. (Hrsg.). (2015). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5 (Deutsche Ausgabe) . Göttingen: Hogrefe.
Garfield, S. L. (1993). Methodological problems in clinical diagnosis. In P. B. Sutker & H. E. Adams (Hrsg.), Comprehensive handbook of psychopathology (2. Aufl.). New York: Plenum Press.
Jaspers, K. (1913/1965). Allgemeine Psychopathologie . Heidelberg: Springer.
Kendell, R. E. (1978). Die Diagnose in der Psychiatrie . Stuttgart: Enke.
Scheff, T. J. (1973). Das Etikett „Geisteskrankheit “. Frankfurt a. M.: S. Fischer.
Skodol, A. E. (2012). Personality disorders in DSM-5. Annual review of clinical psychology , 8, 317–344.
Fast jedes Kind durchlebt im Lauf seiner Entwicklung Phasen besonderer Angst, da Ängste bei Kindern relativ weit verbreitet sind. Die spezifische Art der Ängste hängt mit der Entwicklungsphase zusammen, in der sich die Kinder gerade befinden. Daher ist der Entwicklungshintergrund stets mitzubeachten, wenn man die Entstehung von Angst bei Kindern verstehen möchte. Am frühesten im Kindesalter tritt die Trennungsangst auf, die dadurch hervorgerufen wird, dass sich die Kinder um jene, die ihnen nahestehen, Sorgen machen und Angst haben, dass ihnen etwas zustoßen könnte. Im Kindesalter werden neben der Trennungsangst auch die generalisierte Angststörung, die Panikstörung und die Sozialphobie unterschieden. Relativ häufig werden zudem spezifische Phobien beobachtet.
Für die Definition ist es wichtig, Angst von Furcht und Phobie zu unterscheiden. Furcht bezieht sich immer auf ein konkretes Objekt und meint ein negatives Gefühl der Gefahr oder Bedrohung durch dieses Objekt. Personen haben also immer Furcht vor etwas. Angst hingegen ist ein allgemeines, grundlegendes Gefühl mit negativer Tönung. Angst ist ein oft unbestimmtes, aber überlebensnotwendiges Warnsignal in bedrohlichen Situationen. Schließlich ist eine Phobie eine intensive, überwältigende, aber übertriebene Furcht vor konkreten Objekten oder Situationen, z. B. vor Spinnen, Schlangen oder vor sozialen Situationen.
Angststörungen sind mit einer Prävalenz von über 10 % die häufigsten psychischen Störungen bei Kindern (Wagner et al., 2017; Ihle & Esser, 2002; Merikangas et al., 2010; Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler, & Angold, 2003). Sie neigen dazu zu persistieren und häufig entwickeln Kinder mit Angststörungen später auch andere klinische Schwierigkeiten. Es ist daher von großer Bedeutung zu differenzieren, ab wann die Angst klinisch auffällig ist und einer besonderen therapeutischen Intervention bedarf.
2.1 Die Rolle von Furcht und Angst in der Entwicklung von Kindern
Das Angsterleben von Kindern in verschiedenen Entwicklungsphasen spiegelt die Art und Weise ihrer Erfahrung und Vorstellung der Welt wider. Sehr früh, schon von Geburt an, lösen Schmerz sowie laute, rasch ansteigende Geräusche eine Disstress-Reaktionaus, die aus Schreien, Weinen, einer muskulären Anspannung und diffusen Bewegungen besteht. Negative Reaktionen auf visuelle Reize treten ein wenig später in der Entwicklung auf. Diese Reaktionen beziehen sich in erster Linie auf neue Reize, wobei v. a. fremde Personen Furcht auslösen. Die Entwicklung dieser Reaktionen erfolgt allmählich: Zuerst nimmt das Anlächeln ab, schließlich gewinnt ein Ausdruck der Besorgnisdie Oberhand. Von dieser Besorgnis lässt sich die Furchtreaktionim engeren Sinn abgrenzen, die durch intensivere Emotionalität, aber auch dadurch gekennzeichnet ist, dass nach einer solchen Reaktion kaum mehr ein Zugehen auf den Fremden erfolgt, während dies nach dem Ausdruck von Besorgnis noch möglich ist.
Etwa ab dem 6. bis 8. Lebensmonat löst eine Trennung von der Mutter bzw. der zentralen Bezugspersondes Kindes eine intensive emotionale Reaktion aus, die durch Weinen, Unruhe, Versuche, der Mutter zu folgen, und wiederholtes Rufen gekennzeichnet ist. Die Intensität dieser Reaktion ist von verschiedenen Faktoren abhängig: der Gegenwart anderer vertrauter Personen, der Fremdheit der Situation, dem Verhalten des Fremden etc. Sie nimmt in den Monaten nach ihrem ersten Auftreten zu, um etwa mit dem 18. Lebensmonat ihren Höhepunkt zu erreichen. Die Abnahme dieser Reaktion erfolgt nur langsam.
Von Beginn an bestehen große interindividuelle Unterschiededarin, wie wahrscheinlich es ist, dass durch eine kurze Abwesenheit der Mutter eine emotionale Reaktion beim Kleinkind hervorgerufen wird. Diese Unterschiede hängen einerseits von der Sicherheit der Bindung zwischen Mutter und Kind ab (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978), andererseits vom Stand der kognitiven Entwicklung der Kinder. Dieser Entwicklungsstand bedingt ein unterschiedliches Verständnis dafür, dass die Abwesenheit der Mutter nur vorübergehend ist. Für die Intensität der emotionalen Reaktionen lässt sich zudem bereits frühzeitig ein Einfluss des Temperaments der Kinder nachweisen.
Furcht ist in früher Kindheit oft auf aktuelle Ereignisse in der unmittelbaren Umgebung (z. B. spezielle Gegenstände, Geräusche oder die Angst, zu fallen) bezogen. Solche spezifischen Ängste sind bei Kindern häufig. Die Eltern können meist mehrere Gegenstände oder Situationen benennen, vor welchen ihre Kinder Angst haben (Jersild & Holmes, 1935; Lapouse & Monk, 1959). Kinder zeigen auch relativ häufig stärkere Angstreaktionen. Die meisten spezifischen Ängstesind jedoch nur von kurzer Dauer und geringer Intensität. Die Entstehung spezifischer Ängste vor relativ harmlosen Gegenständen steht möglicherweise in Zusammenhang mit der Tendenz von Kindern zu Anthropomorphismus. Das bedeutet, dass sie auch in unbelebten, sich bewegenden Gegenständen und Tieren Absichten und Gefühle sehen (Bauer, 1980). Es könnte sich darin auch eine Tendenz zu stärkerer Externalisation von inneren Erlebnissen ausdrücken.
Читать дальше