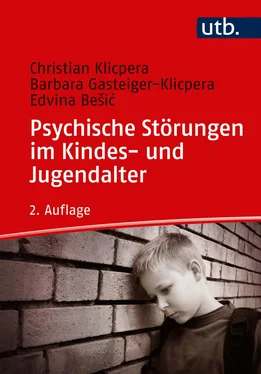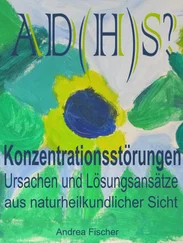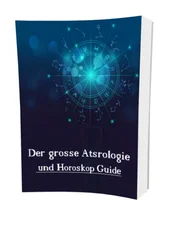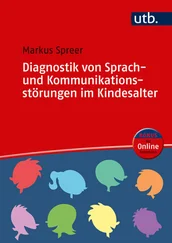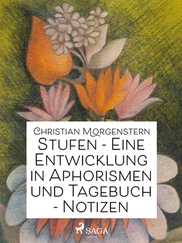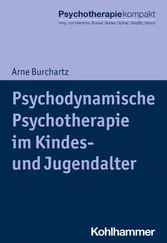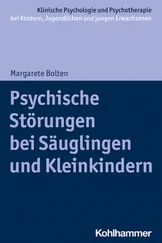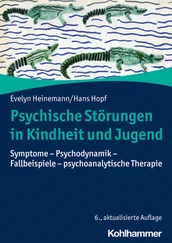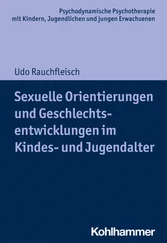Einige Ängste zeigen einen klaren Alterstrend. So werden Ängste vor Tieren kaum bei jüngeren Kindern angetroffen, nehmen aber dann deutlich zu und erreichen ihre größte Häufigkeit mit etwa drei Jahren. Nach Bowlby (1973) sind diese Ängste deshalb so häufig, weil Tiere verschiedene Merkmale aufweisen, die für Kinder beängstigend sind: Sie können sich rasch auf die Kinder zubewegen, nähern sich oft unerwartet und plötzlich. Zudem sind sie den Kindern relativ fremd und weisen auch bestimmte visuelle und taktile Merkmale auf – wie etwa windende Bewegungen oder eine pelzige Oberfläche –, die leicht Angst auslösen.
Etwas später, mit zirka vier Jahren, erreichen Ängste vor der Dunkelheitihr Maximum. Zu diesen Ängsten trägt bei, dass visuelle Reize in der Dunkelheit schwer interpretierbar sind, die Situation für die Kinder fremdartig wirkt und die Kinder dabei meist allein sind.
Mit dem Alter nehmen diese Ängste ab, es kommt stattdessen zur Angst vor Fantasiegestalten, vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein und Verlassenwerden. Die Ängste vor Geistern, Monstern und Fantasiegestalten werden manchmal als Ausdruck einer Verunsicherung durch den Tod und durch die Möglichkeit eines Verlustes vertrauter Personen und Gegenstände interpretiert (Bauer, 1980).
In der mittleren Kindheit ist auch eine Abnahme der Ängste um die persönliche Sicherheit sowie vor Tieren festzustellen. Mit dem Schuleintritt kommt es zu Ängsten, die auf die Schule bezogensind und im Zusammenhang mit sozialen Beziehungen stehen. Diese werden nach einem erstmaligen Anstieg im ersten Schuljahr schließlich v. a. im Alter von 9 bis 12 Jahren beobachtet. Auch Sorgen wegen Geldangelegenheiten und vage Ängste um die eigene Identität (etwa ob die Kinder adoptiert wurden) sind ab diesem Alter häufiger zu beobachten.
Bamber (1979) fasste Untersuchungen über Ängste in der Adoleszenz zusammen und stellte eine Persistenz der Ängste vor körperlichen Verletzungen, um persönliche Sicherheit sowie einen Anstieg der Ängste um Sozialkontaktefest. Eine Abnahme würde es hingegen bei den Ängsten vor Tieren, vor der Dunkelheit sowie vor Wasser und Feuer geben. Auch Angstträume würden seltener werden, ebenso die Angst vor Aggression.
Bezüglich der Entstehung von Ängsten bei Kindern gibt es verschiedene Auffassungen:
– Die psychoanalytische Theorie von Freud sah darin eine Externalisation innerer Konflikte; andere Akzente setzte dagegen Bowlby, der Angst im Zusammenhang mit Trennungserfahrungen interpretierte.
– In der Lerntheorie wurde die Konditionierung der Ängste betont.
– Die existenzialistische Tradition fokussierte auf die Verwurzelung der Ängste in der gesamten Lebenserfahrung des Menschen.
– Von anderen (z. B. Lang, 1979) wurde hervorgehoben, dass sich Ängste aus mehreren Reaktionskomponenten (physiologisch, kognitiv, emotional) zusammensetzen und sich klinisch bedeutsame Angst nur quantitativ von normaler Angst unterscheidet. Über die Reaktionskomponenten, v. a. physiologische Reaktionen, gibt es nur wenige Untersuchungen an Kindern.
Die Entwicklung ängstlichen Verhaltens bei Kindern wird durch die parallel auftretende Fähigkeit, diese emotionalen Reaktionen zu kontrollieren, modifiziert. Die Kinder sind über lange Zeit auf die Beziehung zu den Eltern angewiesen, um Sicherheit zu finden. In den ersten Wochen zeigen Kinder eine fast obligatorische Aufmerksamkeit gegenüber neuen Reizen, unabhängig von deren Gehalt, und sind dadurch wie gefangen. Bald jedoch können sie eine gewisse Kontrolle über die durch äußere Reize erzeugte Angst und Erregung ausüben, indem sie den Blick von diesen Reizen abwenden, den Kontakt unterbrechen und sich zurückziehen. Die sich entwickelnde Fähigkeit zur inneren Repräsentation von Erfahrungenund der Erwerb von Spracheermöglichen eine bessere Differenzierung zwischen harmlosen und potenziell gefahrvollen Reizen sowie eine bessere Kontrolle des Umgangs mit den Angst auslösenden Situationen.
2.2 Bedingungsgefüge bei Angststörungen
Angstzustände können sich auch bei Kindern entwickeln, die emotional stabil erscheinen, meist aber zeigen die betroffenen Kinder schon früh eine höhere Sensibilitätgegenüber Belastungen und eine auffallende Besorgtheit in neuen Situationen. Diese Sensibilität kann als Temperamentseigenschaft betrachtet werden; ihre wesentlichsten Merkmale sind einerseits eine erhöhte negative Affektivität, also eine größere Wahrscheinlichkeit des Ausdrucks negativer primärer Emotionen, und das Überwiegen von Hemmung, also ein geringeres Zugehen auf neue Reize (Lonigan & Phillips, 2001). Diese Prädisposition dürfte genetisch übertragen werden, wobei nach den bisherigen Ergebnissen die genetische Determinationfür depressive und Angststörungen gleich ist und die spezifische Richtung der Entwicklung eher von Umgebungsbedingungen abhängt. Der durch genetische Faktoren erklärte Varianzanteil dürfte etwa ein Drittel ausmachen. Angststörungen gehören nach den Ergebnissen von Zwillingsstudien zu jenen Störungen, bei denen ein relativ großer Anteil der interindividuellen Unterschiede durch die gemeinsamen familiären Bedingungen(„shared environmental variance“) erklärt wird. Dabei dürfte v. a. den psychischen Problemen der (depressiv-ängstlichen) Mütter eine große Bedeutung zukommen (Eley, 2001).
Neben der genetischen Veranlagung für Angst im Allgemeinen könnte es auch noch speziellere Anlagen geben, die für einzelne Angststörungen eine besondere Bedeutung haben. Dies wird etwa für die Panikstörung diskutiert, bei der eine besondere Sensibilität von Rezeptoren für Atemmangel dazu prädisponieren könnte, dass Panikattacken ausgelöst werden. Außerdem wird auch eine (genetisch bedingte) stärkere Empfindlichkeit für Ekelgefühle mit der Phobie vor körperlichen Verletzungen und Arztbesuchen (Injektionen etc.) in Zusammenhang gebracht (Muris & Merckelbach, 2001).
Die Prädisposition steht oft im Zusammenhang mit chronischen Belastungen seitens der Umgebung. Manchmal werden Angstzustände durch ein erschreckendes Ereignis ausgelöst (Spitalsaufenthalt, Tod eines Bekannten oder Verwandten), manchmal liegt eine Ansteckung durch die Ängste der Eltern vor, wobei die Unsicherheit, mit der die Eltern auf die Ängste der Kinder reagieren, ebenfalls von Bedeutung ist.
Rachman (1977) hat drei mögliche Ursachen von Angstreaktionen postuliert:
– direkte Konditionierungs- bzw. Koppelungserfahrungen der Betroffenen, bei denen ein früher nicht Angst auslösender Reiz durch Koppelung (klassische Konditionierung) mit einem unbedingt angstauslösenden Reiz dessen Eigenschaft, Angst auszulösen, übernimmt;
– indirekte oder stellvertretende Konditionierung, wobei die Koppelung nicht von dem Betroffenen selbst erfahren, sondern die Konditionierung über das Beobachtungslernen von einem Modell übernommen wird;
– die Übertragung von Angst durch Informationen, die eine Situation bzw. einen Gegenstand beängstigend erscheinen lassen.
Die Häufigkeit, mit der die verschiedenen Entstehungsmechanismen wirksam werden, ist von der Art des gefürchteten Objektsabhängig. Im Allgemeinen wird angenommen, dass selbst erfahrene Konditionierungen die stärksten Angstreaktionen zur Folge haben. Sehr groß dürfte jedoch der Unterschied zwischen der selbst erfahrenen Konditionierung und der Übertragung durch das Modell anderer nicht sein (Muris & Merckelbach, 2001).
2.2.1 Verzerrung der kognitiven Informationsverarbeitung als Ursache
Seit den 1980er-Jahren wurde zunächst bei Erwachsenen, dann auch bei Kindern der Anteil kognitiver Faktoren an der Angstentstehung und Persistenz hervorgehoben. Kinder mit Angststörungen leiden unter einer verzerrten Informationsverarbeitung, die speziell die beunruhigenden Situationen bzw. Reize betrifft. Die Situationen werden als besonders beängstigend wahrgenommen, da Angst auslösende kognitive Schemata für die Kinder leichter verfügbar sind. Die Aufmerksamkeit richtet sich selektiv auf die Aspekte der Situation, die durch diese Schemata angesprochen werden. Die fehlerhafte Informationsverarbeitung der Kinder wird auf drei Ebenen beschrieben: als Aufmerksamkeits-Bias, Interpretations-Bias und Memory-Bias. Die Kinder richten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf bedrohliche Reize, sie interpretieren Reize eher als beängstigend und erinnern sich auch besser an diese Reize. Dies führt zu einem verstärkenden Kreislauf. Es geschieht automatisch und kann nicht bewusst verhindert werden (Vasey & MacLeod, 2001; Hadwin, Garner, & Perez-Olivas, 2006).
Читать дальше