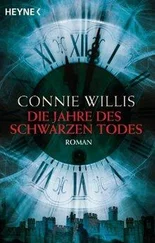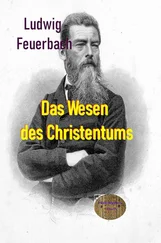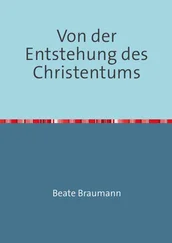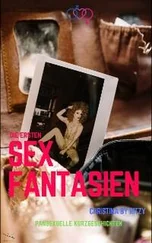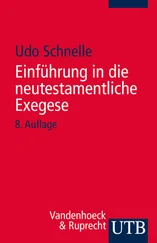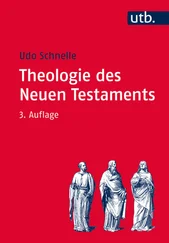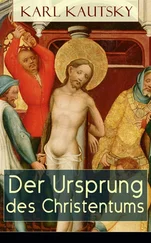Menschensohn
Eine zentrale Rolle in der Christologie der Jerusalemer Gemeinde spielte die Menschensohnvorstellung 158. Jüdische Grundtexte für die Menschensohnvorstellung sind Dan 7,9–14 und äthHen 46,1–48,7. Nach dieser Überlieferung wird der Menschensohn als ein präexistentes (äthHen 48,6), himmlisches Wesen beschrieben, „dessen Gestalt wie das Aussehen eines Menschen“ ist (äthHen 46,1). Er ist der Träger der Gerechtigkeit und der Erwählte Gottes (äthHen 46,3), auf ihm ruht die Weisheit Gottes und er erscheint als der endzeitliche Richter (äthHen 48,7; vgl. 47,1–3). Der Menschensohn ist nach äthHen 48,4f „eine Stütze und ein Stab für die Gerechten, ein Licht der Völker und die Hoffnung der Betrübten“. Seine himmlische Hoheit zeigt sich darin, dass alle Menschen, die das Festland bewohnen, „vor ihm niederfallen und ihn anbeten werden“ (äthHen 48,5). Wahrscheinlich bezog schon Jesus den Menschensohntitel auf sich 159, so dass es nicht verwundert, wenn die Jerusalemer Gemeinde diesen Titel aufnahm, um die besondere Bedeutung Jesu zu kennzeichnen. Sie dürfte Menschensohnlogien tradiert haben (vgl. Lk 7,31–34; 9,58; 12,8f.40; 17,24.26.30; Mk 2,10.28) und darüber hinaus die hinter Mk 8,31 stehende Urform des Logions vom leidenden Menschensohn entwickelt haben 160.
Weisheit und Präexistenz
Auch Weisheits- und Präexistenzspekulationen werden in der Jerusalemer Gemeinde bedeutsam gewesen sein. Mit der Menschensohnvorstellung waren sowohl der Präexistenzgedanke als auch die Weisheit verbunden und speziell Stephanus und die Hellenisten prägte offenbar weisheitliches Denken (vgl. Apg 6, 3.10). Neben dem Logos gehört die Weisheit zu den himmlischen Mittlergestalten (vgl. Prov 2,1–6; 8,22–31; Sap 6,12–11,1), die ihre Heimat in unmittelbarer Nähe zu Gott haben 161. Die Weisheit ist präexistent, Schöpfungsmittlerin und Gesandte Gottes; die Frommen bitten darum, dass Gott sie ihnen sende (vgl. Sap 9,9–11). In äthHen 42,1–2 findet sich die alte Anschauung, wonach die Weisheit auf Erden keinen Platz fand, wo sie wohnen konnte, und darum in den Himmel zurückkehrte. Dieses Motiv der abgelehnten Weisheit wurde schon sehr früh auf Jesus übertragen. Die Weisheit bezeugt, dass der Menschensohn kam und keine Heimat bei den Menschen fand (vgl. Lk 7,34f). Diesem Geschlecht bleibt nur das Gericht. Die Kinder der Weisheit hingegen, die dem Ruf des Täufers und des Menschensohnes gefolgt sind, bleiben vom Gericht verschont.
Nimmt man die ersten Jahre der Jerusalemer Gemeinde insgesamt in den Blick, zeigt sich eine überraschende Vielfalt und Kreativität. So ist die Zusammensetzung der Gemeinde sehr heterogen; neben die unmittelbaren Jünger Jesu und den weiteren Nachfolgekreis (mit vielen Frauen) aus Galiläa tritt die Familie Jesu, insbesondere seine Mutter Maria und sein Bruder Jakobus. Hinzu kommen die Jerusalemer Sympathisanten, die im Umfeld von Kreuzigung und Begräbnis für Jesus eintraten. Schließlich schlossen sich Juden aus Jerusalem und ganz Palästina, aber auch aus der hellenistischen Diaspora in einem erheblichen Maße der Gemeinde an. Es gab erste Ansätze zu einer neuen Kultur des Teilens und eine rasante theologische Entwicklung: Mit geistgewirkten Gottesdiensten, in denen Gebet und Akklamation im Mittelpunkt standen; mit der Ausprägung von Taufe und Herrenmahl als neuen Identitätsritualen; mit der Schaffung erster Texteinheiten; mit der Übertragung von zahlreichen Hoheitstiteln auf Jesus, der von Gott nicht verworfen, sondern erhöht wurde und nun sein endzeitliches Amt als Gesalbter, Herr, Sohn Gottes und Menschensohn wahrnimmt und bei der Parusie in Erscheinung treten wird.
42Dieser Befund spricht gegen die Behauptung von DENNIS E. SMITH, What do we really know about the Jerusalem Church?, in: Ron Cameron/Merrill P. Miller (Hg.), Redescribing Christian origins, (237–252) 243, „that the Jerusalem ‚church‘ as a power broker in Christian origins was a mythological construct from the outset … The actual ekklesia in Jerusalem, such as it was, most likely played a minor role in Christian origins.“
43Anders JAMES D. G. DUNN, Beginning from Jerusalem, 133–137; DIETRICH-ALEX KOCH, Geschichte des Urchristentums, 164–168, die sich ausschließlich auf Jerusalem konzentrieren und Galiläa außer acht lassen.
44Vgl. CARSTEN COLPE, Die erste urchristliche Generation, 62; anders GERD LÜDEMANN, Die ersten drei Jahre Christentum, 11, wonach „die Geschichte der Urgemeinde fast unbekannt bleibt“.
45Die Bemerkung in Apg 1,23 („und sie stellten zwei auf: Josef, genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus, und Matthias“) dürfte sich historisch auf zwei tatsächliche Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde beziehen (zu beachten ist besonders der erste, dreigliedrige Name!), auch wenn sich die notwendige Nachwahl lukanischer Ekklesiologie verdankt; vgl. dazu JÜRGEN ROLOFF, Apostelgeschichte, 34–36.
46Vgl. LUDGER SCHENKE, Die Urgemeinde, 22.
47Vgl. ROBERT JEWETT, Romans, 964. Auflistungen mit möglichen Mitgliedern der Jerusalemer Gemeinde finden sich bei RICHARD BAUCKHAM, Jesus and the Jerusalem Community, in: Oskar Skarsaune/Reidar Hvalvik (Hg.), Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries (s.u. 10.5), 55–95; JAMES D. G. DUNN, Beginning from Jerusalem, 178–180.
48RAINER RIESNER, Zwischen Tempel und Obergemach (s.o. 5), 78f, zählt zu den ‚Hinzugefügten‘ (vgl. Apg 2,41.47) auch Essener, die sich aus dem nahen Essener-Viertel der Gemeinde anschlossen.
49Vgl. JACOB KREMER, Weltweites Zeugnis für Christus in der Kraft des Geistes, in: Mission im Neuen Testament, hg. v. Karl Kertelge, QD 93, Freiburg 1982, 145–163.
50Vgl. JÜRGEN ROLOFF, Apostelgeschichte, 38.
51Vgl. CARSTEN COLPE, Die erste urchristliche Generation, 59: „Das ‚Judenchristentum‘ beginnt historisch zweifelsfrei mit den pneumatischen Erfahrungen nach Jesu Tod.“
52Vgl. dazu HEINZ-WOLFGANG KUHN, Enderwartung und gegenwärtiges Heil, SUNT 4, Göttingen 1966, 117–120; FRIEDRICH WILHELM HORN, Das Angeld des Geistes, 26–60.
53Vgl. JAMES D. G. DUNN, Beginning from Jerusalem, 206–212.
54Zum Zwölferkreis gehören die Brüderpaare Petrus (Mk 1,16; 3,16; Apg 1,13) und Andreas (Mk 1,16; 3,18; Apg 1,13); Jakobus (Mk 1,19; 3,17; Apg 1,13) und Johannes (Mk 1,19; 3,17; Apg 1,13), die Söhne des Zebedäus; ferner Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas (Zwilling), Jakobus, der Sohn des Alphäus, Simon, der Kananäer/Zelot; Judas Iskariot (Mk 3,18; Apg 1,13.16). Einzelgestalten sind: Thaddäus (Mk 3,18); Judas, der Sohn des Jakobus (Apg 1,13)/Bruder des Jakobus (Lk 6,16).
55Vgl. zur Begründung auch DIETRICH-ALEX KOCH, Geschichte des Urchristentums, 149–151.
56Vgl. dazu BÉDA RIGAUX, Die „Zwölf“ in Geschichte und Kerygma, in: Helmut Ristow/Karl Matthiae (Hg.), Der historische Jesus und der kerygmatische Christus, Berlin 1960, 468–486.
57Vgl. GERD LÜDEMANN, Die ersten drei Jahre Christentum, 112.
58Vgl. MONIKA LOHMEYER, Der Apostelbegriff, 133–141; zur Forschungsgeschichte vgl. a.a.O., 18–122 (dort auch Kritik an einer Ableitung aus dem ‚jüdischen Botenrecht‘).
59Vgl. zur Analyse der Verben MONIKA LOHMEYER, Der Apostelbegriff, 141–154.
60Vgl. Epiktet, Dissertationes I 24,6: Diogenes wurde als Kundschafter ausgesandt ( 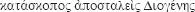 ); III 22,46: Epiktet antwortet auf die Frage, wie jemand ohne Haus, Heimat oder Sklaven ein glückliches Leben führen könne: „Siehe, Gott hat euch einen Mann gesandt, der euch in der Tat zeigen soll, dass es möglich ist“ (
); III 22,46: Epiktet antwortet auf die Frage, wie jemand ohne Haus, Heimat oder Sklaven ein glückliches Leben führen könne: „Siehe, Gott hat euch einen Mann gesandt, der euch in der Tat zeigen soll, dass es möglich ist“ ( 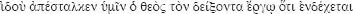 ); IV 8,31: „ich bin euch von Gott als Vorbild gesandt worden“ (
); IV 8,31: „ich bin euch von Gott als Vorbild gesandt worden“ ( 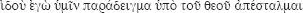 ); vgl. ferner: 22,23.56.69.
); vgl. ferner: 22,23.56.69.
Читать дальше
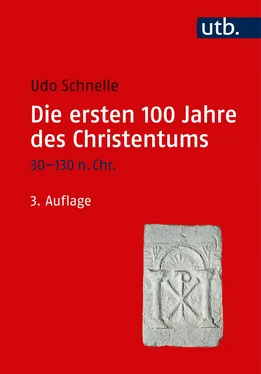
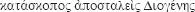 ); III 22,46: Epiktet antwortet auf die Frage, wie jemand ohne Haus, Heimat oder Sklaven ein glückliches Leben führen könne: „Siehe, Gott hat euch einen Mann gesandt, der euch in der Tat zeigen soll, dass es möglich ist“ (
); III 22,46: Epiktet antwortet auf die Frage, wie jemand ohne Haus, Heimat oder Sklaven ein glückliches Leben führen könne: „Siehe, Gott hat euch einen Mann gesandt, der euch in der Tat zeigen soll, dass es möglich ist“ ( 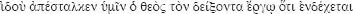 ); IV 8,31: „ich bin euch von Gott als Vorbild gesandt worden“ (
); IV 8,31: „ich bin euch von Gott als Vorbild gesandt worden“ ( 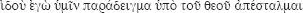 ); vgl. ferner: 22,23.56.69.
); vgl. ferner: 22,23.56.69.