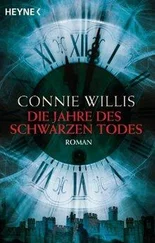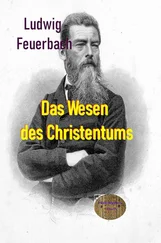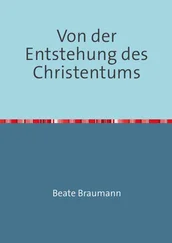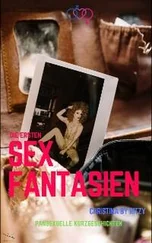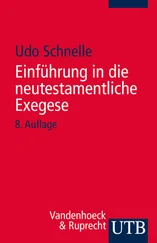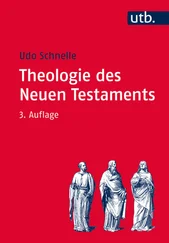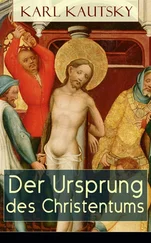Jesus Christus
Die zentrale Hoheitsbezeichnung  bzw.
bzw. 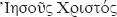 haftet bereits an den ältesten vorpaulinischen Bekenntnistraditionen (vgl. 1Kor 15,3b–5; 2Kor 5,14f) und thematisiert das gesamte Heilsgeschehen 154. Bei Paulus (und wahrscheinlich schon vor ihm) verbinden sich Aussagen über die Kreuzigung (1Kor 1,23; 2,2; Gal 3,1.13), den Tod (Röm 5,6.8; 14,15; 15,3; 1Kor 8,11; Gal 2,19.21), die Auferweckung (Röm 6,9; 8,11; 10,7; 1Kor 15,12–17.20.23), die Präexistenz (1Kor 10,4; 11,3a.b) und die irdische Existenz Jesu (Röm 9,5; 2Kor 5,16) mit
haftet bereits an den ältesten vorpaulinischen Bekenntnistraditionen (vgl. 1Kor 15,3b–5; 2Kor 5,14f) und thematisiert das gesamte Heilsgeschehen 154. Bei Paulus (und wahrscheinlich schon vor ihm) verbinden sich Aussagen über die Kreuzigung (1Kor 1,23; 2,2; Gal 3,1.13), den Tod (Röm 5,6.8; 14,15; 15,3; 1Kor 8,11; Gal 2,19.21), die Auferweckung (Röm 6,9; 8,11; 10,7; 1Kor 15,12–17.20.23), die Präexistenz (1Kor 10,4; 11,3a.b) und die irdische Existenz Jesu (Röm 9,5; 2Kor 5,16) mit  . Von der auf das gesamte Heilsgeschehen bezogenen Grundaussage verzweigen sich die
. Von der auf das gesamte Heilsgeschehen bezogenen Grundaussage verzweigen sich die  -Aussagen dann in vielfältige Bereiche. Auch in den Evangelien nimmt der Titelname
-Aussagen dann in vielfältige Bereiche. Auch in den Evangelien nimmt der Titelname 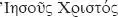 eine zentrale Stellung ein, wie z.B. Mk 1,1; 8,29; 14,61; Mt 16,16 deutlich zeigen. Der selbstverständliche Gebrauch von
eine zentrale Stellung ein, wie z.B. Mk 1,1; 8,29; 14,61; Mt 16,16 deutlich zeigen. Der selbstverständliche Gebrauch von  auch bei griechisch-römisch geprägten Gemeinden ist kein Zufall, denn die Adressaten konnten vor ihrem kulturgeschichtlichen Hintergrund
auch bei griechisch-römisch geprägten Gemeinden ist kein Zufall, denn die Adressaten konnten vor ihrem kulturgeschichtlichen Hintergrund  im Kontext antiker Salbungsriten rezipieren. Die im gesamten Mittelmeerraum verbreiteten Salbungsriten zeugen von einem gemeinantiken Sprachgebrauch, wonach gilt: „wer/was gesalbt ist, ist heilig, Gott nah, Gott übergeben“ 155. Sowohl Judenchristen als auch Christen aus griechischrömischer Tradition konnten
im Kontext antiker Salbungsriten rezipieren. Die im gesamten Mittelmeerraum verbreiteten Salbungsriten zeugen von einem gemeinantiken Sprachgebrauch, wonach gilt: „wer/was gesalbt ist, ist heilig, Gott nah, Gott übergeben“ 155. Sowohl Judenchristen als auch Christen aus griechischrömischer Tradition konnten  als Prädikat für die einzigartige Gottnähe und Heiligkeit Jesu verstehen, so dass
als Prädikat für die einzigartige Gottnähe und Heiligkeit Jesu verstehen, so dass  (bzw.
(bzw. 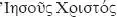 ) als Titelname zum idealen Missionsbegriff wurde.
) als Titelname zum idealen Missionsbegriff wurde.
Kyrios/Herr
Eine veränderte Perspektive verbindet sich mit dem  -Titel 156(vgl. Ps 110,1LXX), der bereits in der Jerusalemer Gemeinde eine zentrale Bedeutung hatte, wie 1Kor 16,22 zeigt (Maranatha/
-Titel 156(vgl. Ps 110,1LXX), der bereits in der Jerusalemer Gemeinde eine zentrale Bedeutung hatte, wie 1Kor 16,22 zeigt (Maranatha/  = „unser Herr, komm!“). Indem die Glaubenden Jesus als ‚Herrn‘ bezeichnen, unterstellen sie sich der Autorität des in der Gemeinde gegenwärtig Erhöhten.
= „unser Herr, komm!“). Indem die Glaubenden Jesus als ‚Herrn‘ bezeichnen, unterstellen sie sich der Autorität des in der Gemeinde gegenwärtig Erhöhten.  bringt Jesu einzigartige Würde und Funktion zum Ausdruck: Er wurde zur Rechten Gottes erhöht, hat Anteil an der Macht und Herrlichkeit Gottes und übt von dort seine Herrschaft aus. Der mit dem Kyrios-Titel verbundene Aspekt der Gegenwart des Erhöhten in der Gemeinde zeigt sich deutlich in der Akklamation und in der Abendmahlstradition als Haftpunkten der Überlieferung. Indem die Gemeinde akklamiert, erkennt sie Jesus als Kyrios an und bekennt sich zu ihm (vgl. 1Kor 12,3; Phil 2,6–11). Der Gott der Christen wirkt durch seinen Geist, so dass sie laut im Gottesdienst rufen (1Kor 12,3):
bringt Jesu einzigartige Würde und Funktion zum Ausdruck: Er wurde zur Rechten Gottes erhöht, hat Anteil an der Macht und Herrlichkeit Gottes und übt von dort seine Herrschaft aus. Der mit dem Kyrios-Titel verbundene Aspekt der Gegenwart des Erhöhten in der Gemeinde zeigt sich deutlich in der Akklamation und in der Abendmahlstradition als Haftpunkten der Überlieferung. Indem die Gemeinde akklamiert, erkennt sie Jesus als Kyrios an und bekennt sich zu ihm (vgl. 1Kor 12,3; Phil 2,6–11). Der Gott der Christen wirkt durch seinen Geist, so dass sie laut im Gottesdienst rufen (1Kor 12,3): 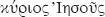 („Herr ist Jesus“), und nicht:
(„Herr ist Jesus“), und nicht: 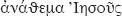 („Verflucht sei Jesus“). Gehäuft erscheint
(„Verflucht sei Jesus“). Gehäuft erscheint  in der Abendmahlsüberlieferung (vgl. 1Kor 11,20–23.26ff.32; 16,22). Die Gemeinde versammelt sich in der machtvollen Gegenwart des Erhöhten, dessen heilvolle, aber auch strafende Kräfte (vgl. 1Kor 11,30) in der Abendmahlsfeier wirken. Neben die liturgische Dimension des Kyrios-Titels tritt besonders bei Paulus eine ethische Komponente. Der Kyrios ist die entscheidende Instanz, von der aus alle Bereiche des täglichen Lebens bedacht werden (Röm 14,8: „Wenn wir leben, so leben wir dem Herrn, wenn wir sterben, so sterben wir dem Herrn. Wenn wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn“).
in der Abendmahlsüberlieferung (vgl. 1Kor 11,20–23.26ff.32; 16,22). Die Gemeinde versammelt sich in der machtvollen Gegenwart des Erhöhten, dessen heilvolle, aber auch strafende Kräfte (vgl. 1Kor 11,30) in der Abendmahlsfeier wirken. Neben die liturgische Dimension des Kyrios-Titels tritt besonders bei Paulus eine ethische Komponente. Der Kyrios ist die entscheidende Instanz, von der aus alle Bereiche des täglichen Lebens bedacht werden (Röm 14,8: „Wenn wir leben, so leben wir dem Herrn, wenn wir sterben, so sterben wir dem Herrn. Wenn wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn“).
Sohn Gottes
Der Titel 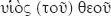 steht vor allem in traditionsgeschichtlicher Kontinuität zu Ps 2,7 (vgl. ferner 2Sam 7,11f.14) und verbindet sich mit verschiedenen christologischen Konzeptionen 157. Paulus übernahm ihn bereits aus der Tradition (vgl. 1Thess 1,9f; Röm 1,3b–4a), wobei die besondere Platzierung von
steht vor allem in traditionsgeschichtlicher Kontinuität zu Ps 2,7 (vgl. ferner 2Sam 7,11f.14) und verbindet sich mit verschiedenen christologischen Konzeptionen 157. Paulus übernahm ihn bereits aus der Tradition (vgl. 1Thess 1,9f; Röm 1,3b–4a), wobei die besondere Platzierung von  erkennen lässt, dass er diesem Titel eine hohe theologische Bedeutung zumaß. Der Sohnes-Titel bringt sowohl die enge Verbindung Jesu Christi mit dem Vater als auch seine Funktion als Heilsmittler zwischen Gott und den Menschen zum Ausdruck (vgl. 2Kor 1,19; Gal 1,16; 4,4.6; Röm 8,3). Bei Markus wird
erkennen lässt, dass er diesem Titel eine hohe theologische Bedeutung zumaß. Der Sohnes-Titel bringt sowohl die enge Verbindung Jesu Christi mit dem Vater als auch seine Funktion als Heilsmittler zwischen Gott und den Menschen zum Ausdruck (vgl. 2Kor 1,19; Gal 1,16; 4,4.6; Röm 8,3). Bei Markus wird 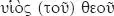 zum zentralen christologischen Titel, der gleichermaßen Jesu himmlische und irdische Würde umfasst (vgl. Mk 1,1.9–11; 9,2–8; 12,6; 14,61; 15,39). Auch Matthäus entfaltet eine ausgeprägte Sohn-Gottes-Christologie (vgl. Mt 1,22f.25; 3,17; 4,8–10), während bei Lukas der Titel keine zentrale Stellung einnimmt.
zum zentralen christologischen Titel, der gleichermaßen Jesu himmlische und irdische Würde umfasst (vgl. Mk 1,1.9–11; 9,2–8; 12,6; 14,61; 15,39). Auch Matthäus entfaltet eine ausgeprägte Sohn-Gottes-Christologie (vgl. Mt 1,22f.25; 3,17; 4,8–10), während bei Lukas der Titel keine zentrale Stellung einnimmt.
Sohn Davids
In der Jerusalemer Gemeinde spielte wahrscheinlich der Titel ‚Sohn Davids‘ (  ) eine besondere Rolle, denn der Messias galt als Nachkomme Davids (vgl. PsSal 17,21). Zentraler Text ist die alte Tradition Röm 1,3b–4a, wonach der irdische Jesus Sohn Davids war; Gott setzte ihn durch seinen schöpferischen Geist kraft der Auferstehung als Gottessohn ein und machte ihn so zur maßgeblichen Gestalt der Endzeit (vgl. 2Tim 2,8). In der Evangelienüberlieferung dominiert der Titel speziell bei Blindenheilungen (vgl. Mk 10,46–52; Mt 9,27; 12,23). Matthäus verleiht diesem Titel ein besonderes Gepräge. Zunächst wird Jesus als durch einen göttlichen Eingriff legitimierter Abkömmling der David-Dynastie und damit als Messias entsprechend den jüdischen Traditionen vorgestellt (Mt 1,1–17). Dann wirkt er als heilender Davidssohn in Israel, wird aber dennoch von den blinden Führern Israels nicht erkannt (vgl. Mt 9,27; 12,23; 21,14–16).
) eine besondere Rolle, denn der Messias galt als Nachkomme Davids (vgl. PsSal 17,21). Zentraler Text ist die alte Tradition Röm 1,3b–4a, wonach der irdische Jesus Sohn Davids war; Gott setzte ihn durch seinen schöpferischen Geist kraft der Auferstehung als Gottessohn ein und machte ihn so zur maßgeblichen Gestalt der Endzeit (vgl. 2Tim 2,8). In der Evangelienüberlieferung dominiert der Titel speziell bei Blindenheilungen (vgl. Mk 10,46–52; Mt 9,27; 12,23). Matthäus verleiht diesem Titel ein besonderes Gepräge. Zunächst wird Jesus als durch einen göttlichen Eingriff legitimierter Abkömmling der David-Dynastie und damit als Messias entsprechend den jüdischen Traditionen vorgestellt (Mt 1,1–17). Dann wirkt er als heilender Davidssohn in Israel, wird aber dennoch von den blinden Führern Israels nicht erkannt (vgl. Mt 9,27; 12,23; 21,14–16).
Читать дальше
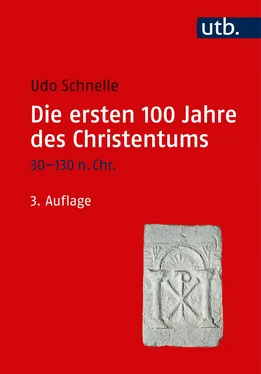
 bzw.
bzw. 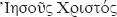 haftet bereits an den ältesten vorpaulinischen Bekenntnistraditionen (vgl. 1Kor 15,3b–5; 2Kor 5,14f) und thematisiert das gesamte Heilsgeschehen 154. Bei Paulus (und wahrscheinlich schon vor ihm) verbinden sich Aussagen über die Kreuzigung (1Kor 1,23; 2,2; Gal 3,1.13), den Tod (Röm 5,6.8; 14,15; 15,3; 1Kor 8,11; Gal 2,19.21), die Auferweckung (Röm 6,9; 8,11; 10,7; 1Kor 15,12–17.20.23), die Präexistenz (1Kor 10,4; 11,3a.b) und die irdische Existenz Jesu (Röm 9,5; 2Kor 5,16) mit
haftet bereits an den ältesten vorpaulinischen Bekenntnistraditionen (vgl. 1Kor 15,3b–5; 2Kor 5,14f) und thematisiert das gesamte Heilsgeschehen 154. Bei Paulus (und wahrscheinlich schon vor ihm) verbinden sich Aussagen über die Kreuzigung (1Kor 1,23; 2,2; Gal 3,1.13), den Tod (Röm 5,6.8; 14,15; 15,3; 1Kor 8,11; Gal 2,19.21), die Auferweckung (Röm 6,9; 8,11; 10,7; 1Kor 15,12–17.20.23), die Präexistenz (1Kor 10,4; 11,3a.b) und die irdische Existenz Jesu (Röm 9,5; 2Kor 5,16) mit  . Von der auf das gesamte Heilsgeschehen bezogenen Grundaussage verzweigen sich die
. Von der auf das gesamte Heilsgeschehen bezogenen Grundaussage verzweigen sich die  -Aussagen dann in vielfältige Bereiche. Auch in den Evangelien nimmt der Titelname
-Aussagen dann in vielfältige Bereiche. Auch in den Evangelien nimmt der Titelname 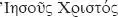 eine zentrale Stellung ein, wie z.B. Mk 1,1; 8,29; 14,61; Mt 16,16 deutlich zeigen. Der selbstverständliche Gebrauch von
eine zentrale Stellung ein, wie z.B. Mk 1,1; 8,29; 14,61; Mt 16,16 deutlich zeigen. Der selbstverständliche Gebrauch von  auch bei griechisch-römisch geprägten Gemeinden ist kein Zufall, denn die Adressaten konnten vor ihrem kulturgeschichtlichen Hintergrund
auch bei griechisch-römisch geprägten Gemeinden ist kein Zufall, denn die Adressaten konnten vor ihrem kulturgeschichtlichen Hintergrund  im Kontext antiker Salbungsriten rezipieren. Die im gesamten Mittelmeerraum verbreiteten Salbungsriten zeugen von einem gemeinantiken Sprachgebrauch, wonach gilt: „wer/was gesalbt ist, ist heilig, Gott nah, Gott übergeben“ 155. Sowohl Judenchristen als auch Christen aus griechischrömischer Tradition konnten
im Kontext antiker Salbungsriten rezipieren. Die im gesamten Mittelmeerraum verbreiteten Salbungsriten zeugen von einem gemeinantiken Sprachgebrauch, wonach gilt: „wer/was gesalbt ist, ist heilig, Gott nah, Gott übergeben“ 155. Sowohl Judenchristen als auch Christen aus griechischrömischer Tradition konnten  als Prädikat für die einzigartige Gottnähe und Heiligkeit Jesu verstehen, so dass
als Prädikat für die einzigartige Gottnähe und Heiligkeit Jesu verstehen, so dass  (bzw.
(bzw. 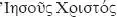 ) als Titelname zum idealen Missionsbegriff wurde.
) als Titelname zum idealen Missionsbegriff wurde. -Titel 156(vgl. Ps 110,1LXX), der bereits in der Jerusalemer Gemeinde eine zentrale Bedeutung hatte, wie 1Kor 16,22 zeigt (Maranatha/
-Titel 156(vgl. Ps 110,1LXX), der bereits in der Jerusalemer Gemeinde eine zentrale Bedeutung hatte, wie 1Kor 16,22 zeigt (Maranatha/  = „unser Herr, komm!“). Indem die Glaubenden Jesus als ‚Herrn‘ bezeichnen, unterstellen sie sich der Autorität des in der Gemeinde gegenwärtig Erhöhten.
= „unser Herr, komm!“). Indem die Glaubenden Jesus als ‚Herrn‘ bezeichnen, unterstellen sie sich der Autorität des in der Gemeinde gegenwärtig Erhöhten.  bringt Jesu einzigartige Würde und Funktion zum Ausdruck: Er wurde zur Rechten Gottes erhöht, hat Anteil an der Macht und Herrlichkeit Gottes und übt von dort seine Herrschaft aus. Der mit dem Kyrios-Titel verbundene Aspekt der Gegenwart des Erhöhten in der Gemeinde zeigt sich deutlich in der Akklamation und in der Abendmahlstradition als Haftpunkten der Überlieferung. Indem die Gemeinde akklamiert, erkennt sie Jesus als Kyrios an und bekennt sich zu ihm (vgl. 1Kor 12,3; Phil 2,6–11). Der Gott der Christen wirkt durch seinen Geist, so dass sie laut im Gottesdienst rufen (1Kor 12,3):
bringt Jesu einzigartige Würde und Funktion zum Ausdruck: Er wurde zur Rechten Gottes erhöht, hat Anteil an der Macht und Herrlichkeit Gottes und übt von dort seine Herrschaft aus. Der mit dem Kyrios-Titel verbundene Aspekt der Gegenwart des Erhöhten in der Gemeinde zeigt sich deutlich in der Akklamation und in der Abendmahlstradition als Haftpunkten der Überlieferung. Indem die Gemeinde akklamiert, erkennt sie Jesus als Kyrios an und bekennt sich zu ihm (vgl. 1Kor 12,3; Phil 2,6–11). Der Gott der Christen wirkt durch seinen Geist, so dass sie laut im Gottesdienst rufen (1Kor 12,3): 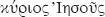 („Herr ist Jesus“), und nicht:
(„Herr ist Jesus“), und nicht: 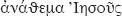 („Verflucht sei Jesus“). Gehäuft erscheint
(„Verflucht sei Jesus“). Gehäuft erscheint  in der Abendmahlsüberlieferung (vgl. 1Kor 11,20–23.26ff.32; 16,22). Die Gemeinde versammelt sich in der machtvollen Gegenwart des Erhöhten, dessen heilvolle, aber auch strafende Kräfte (vgl. 1Kor 11,30) in der Abendmahlsfeier wirken. Neben die liturgische Dimension des Kyrios-Titels tritt besonders bei Paulus eine ethische Komponente. Der Kyrios ist die entscheidende Instanz, von der aus alle Bereiche des täglichen Lebens bedacht werden (Röm 14,8: „Wenn wir leben, so leben wir dem Herrn, wenn wir sterben, so sterben wir dem Herrn. Wenn wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn“).
in der Abendmahlsüberlieferung (vgl. 1Kor 11,20–23.26ff.32; 16,22). Die Gemeinde versammelt sich in der machtvollen Gegenwart des Erhöhten, dessen heilvolle, aber auch strafende Kräfte (vgl. 1Kor 11,30) in der Abendmahlsfeier wirken. Neben die liturgische Dimension des Kyrios-Titels tritt besonders bei Paulus eine ethische Komponente. Der Kyrios ist die entscheidende Instanz, von der aus alle Bereiche des täglichen Lebens bedacht werden (Röm 14,8: „Wenn wir leben, so leben wir dem Herrn, wenn wir sterben, so sterben wir dem Herrn. Wenn wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn“).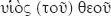 steht vor allem in traditionsgeschichtlicher Kontinuität zu Ps 2,7 (vgl. ferner 2Sam 7,11f.14) und verbindet sich mit verschiedenen christologischen Konzeptionen 157. Paulus übernahm ihn bereits aus der Tradition (vgl. 1Thess 1,9f; Röm 1,3b–4a), wobei die besondere Platzierung von
steht vor allem in traditionsgeschichtlicher Kontinuität zu Ps 2,7 (vgl. ferner 2Sam 7,11f.14) und verbindet sich mit verschiedenen christologischen Konzeptionen 157. Paulus übernahm ihn bereits aus der Tradition (vgl. 1Thess 1,9f; Röm 1,3b–4a), wobei die besondere Platzierung von  erkennen lässt, dass er diesem Titel eine hohe theologische Bedeutung zumaß. Der Sohnes-Titel bringt sowohl die enge Verbindung Jesu Christi mit dem Vater als auch seine Funktion als Heilsmittler zwischen Gott und den Menschen zum Ausdruck (vgl. 2Kor 1,19; Gal 1,16; 4,4.6; Röm 8,3). Bei Markus wird
erkennen lässt, dass er diesem Titel eine hohe theologische Bedeutung zumaß. Der Sohnes-Titel bringt sowohl die enge Verbindung Jesu Christi mit dem Vater als auch seine Funktion als Heilsmittler zwischen Gott und den Menschen zum Ausdruck (vgl. 2Kor 1,19; Gal 1,16; 4,4.6; Röm 8,3). Bei Markus wird 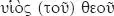 zum zentralen christologischen Titel, der gleichermaßen Jesu himmlische und irdische Würde umfasst (vgl. Mk 1,1.9–11; 9,2–8; 12,6; 14,61; 15,39). Auch Matthäus entfaltet eine ausgeprägte Sohn-Gottes-Christologie (vgl. Mt 1,22f.25; 3,17; 4,8–10), während bei Lukas der Titel keine zentrale Stellung einnimmt.
zum zentralen christologischen Titel, der gleichermaßen Jesu himmlische und irdische Würde umfasst (vgl. Mk 1,1.9–11; 9,2–8; 12,6; 14,61; 15,39). Auch Matthäus entfaltet eine ausgeprägte Sohn-Gottes-Christologie (vgl. Mt 1,22f.25; 3,17; 4,8–10), während bei Lukas der Titel keine zentrale Stellung einnimmt. ) eine besondere Rolle, denn der Messias galt als Nachkomme Davids (vgl. PsSal 17,21). Zentraler Text ist die alte Tradition Röm 1,3b–4a, wonach der irdische Jesus Sohn Davids war; Gott setzte ihn durch seinen schöpferischen Geist kraft der Auferstehung als Gottessohn ein und machte ihn so zur maßgeblichen Gestalt der Endzeit (vgl. 2Tim 2,8). In der Evangelienüberlieferung dominiert der Titel speziell bei Blindenheilungen (vgl. Mk 10,46–52; Mt 9,27; 12,23). Matthäus verleiht diesem Titel ein besonderes Gepräge. Zunächst wird Jesus als durch einen göttlichen Eingriff legitimierter Abkömmling der David-Dynastie und damit als Messias entsprechend den jüdischen Traditionen vorgestellt (Mt 1,1–17). Dann wirkt er als heilender Davidssohn in Israel, wird aber dennoch von den blinden Führern Israels nicht erkannt (vgl. Mt 9,27; 12,23; 21,14–16).
) eine besondere Rolle, denn der Messias galt als Nachkomme Davids (vgl. PsSal 17,21). Zentraler Text ist die alte Tradition Röm 1,3b–4a, wonach der irdische Jesus Sohn Davids war; Gott setzte ihn durch seinen schöpferischen Geist kraft der Auferstehung als Gottessohn ein und machte ihn so zur maßgeblichen Gestalt der Endzeit (vgl. 2Tim 2,8). In der Evangelienüberlieferung dominiert der Titel speziell bei Blindenheilungen (vgl. Mk 10,46–52; Mt 9,27; 12,23). Matthäus verleiht diesem Titel ein besonderes Gepräge. Zunächst wird Jesus als durch einen göttlichen Eingriff legitimierter Abkömmling der David-Dynastie und damit als Messias entsprechend den jüdischen Traditionen vorgestellt (Mt 1,1–17). Dann wirkt er als heilender Davidssohn in Israel, wird aber dennoch von den blinden Führern Israels nicht erkannt (vgl. Mt 9,27; 12,23; 21,14–16).