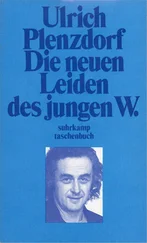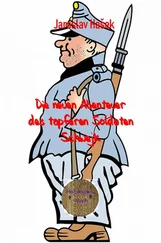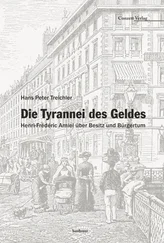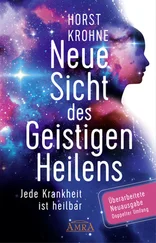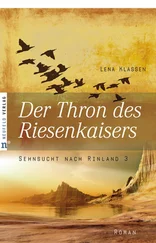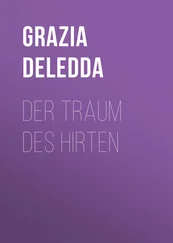Neue Theorien des Rechts
Здесь есть возможность читать онлайн «Neue Theorien des Rechts» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Neue Theorien des Rechts
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Neue Theorien des Rechts: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Neue Theorien des Rechts»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das vorliegende Lehrbuch gibt einen Überblick über moderne rechtstheoretische Fragestellungen. Diese werden vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen für das Recht vorgestellt. Die Autoren behandeln wichtigste Theorien im Kontext benachbarter Grundlagenfächer. Die Neuauflage ist um sechs Abschnitte erweitert worden und bezieht nun auch Post-Juridische Theorien, Neuen Rechtsempirismus, Ästhetische Theorien des Rechts sowie Medientheorien des Rechts mit ein. Einzelne Abschnitte wurden gänzlich neu verfassst.
Neue Theorien des Rechts — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Neue Theorien des Rechts», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
(4) Um den Verfassungscharakter globaler Ordnung mit der Notwendigkeit einer aktivbürgerlichen Legitimation zusammenzudenken, bietet sich schließlich die Idee einer grenzüberschreitenden verfassunggebenden Gewalt an. HabermasHabermas, Jürgen hat diese Figur zunächst in Arbeiten zur Europäischen Union ausprobiert, um sie schließlich auch für die Ebene der Weltverfassung vorzuschlagen.[83] Die verfassunggebende Gewalt in der EU und in den Vereinten Nationen lässt sich aber nicht nach dem kosmopolitischen Muster einer Weltrepublik vorstellen. Sie muss die staatliche Organisationsebene und deren Aufstufung zur supranationalen Ordnung berücksichtigen, so dass sie Aktivbürgerinnen in zweierlei Gestalt – als Bürgerinnen ihrer Nationalstaaten und als Bürgerinnen des überstaatlichen Gemeinwesens – ins Auge fasst[84]. Die verfassunggebende Gewalt ist dann »gespalten« in ihrer Ausübung, da die Bürger in Permanenz den staatlichen wie den suprastaatlichen Zusammenhang autorisieren. Das komplementäre Verhältnis von Völkerrecht und Weltbürgerrecht soll nicht mehr nach einer Seite aufgelöst werden.
Ingeborg MausMaus, Ingeborg hat in den Diskussionen über Recht jenseits des Nationalstaats eine demokratietheoretisch und rechtsstaatlich begründete, skeptische |27|Position bezogen. Während HabermasHabermas, Jürgen die Erweiterung des positiven Völkerrechts von der Friedenssicherung auf den Menschenrechtsschutz begrüßt, betont Maus dessen entformalisierteEntformalisierung und vielfach willkürliche Handhabung. Sie sieht in der Zunahme militärischer Interventionen auf der Basis von Menschenrechtsverletzungen einen Trend zur Umwandlung der Menschenrechte in »Ermächtigungsnormen internationaler Politik«, die vollständig aus ihrem demokratischen Interpretationszusammenhang herausgelöst werden[85]. Mit KantKant, Immanuel hält sie an einer friedensorientierten Demokratieförderung und einem strengen Interventionsverbot fest[86]. Dem Prinzip der Nichtintervention liegt ihr zufolge auch gegenüber autoritären Staaten ein Volkssouveränitätsargument zugrunde: der von einem Staatsvolk einzuschlagende Weg zur und seine Ausgestaltung der DemokratieDemokratie sei von diesem in autonomen Lernprozessen zurückzulegen; Nichtintervention sei eine notwendige Bedingung für das Gedeihen solcher Lernprozesse[87]. Weiterhin sei die Verrechtlichung von Interventionsbefugnissen mit dem unlösbaren Problem konfrontiert, unumstrittene Quantitäten der Menschenrechtsverletzung festzulegen. Im Falle außerordentlich gravierender Menschenrechtsverletzungen sieht sie daher nur die Möglichkeit des bewussten Rechtsbruchs: »Für das extreme Verbrechen des Völkermords existiert […] nur die extreme Möglichkeit der außerrechtlichen Intervention«[88]. Gegenüber Vorschlägen zur Verrechtlichung des militärischen Menschenrechtsschutzes besteht sie auf der Einführung prozeduraler Beschränkungen innerhalb der UN, die Interventionsbeschlüssen des Sicherheitsrates enge Fesseln anlegen sollen[89]. Der entscheidende Einwand gegen eine interventionistische Menschenrechtspolitik liegt in der, auf globaler Ebene fehlenden, demokratisch legitimierten Rechtsetzungsinstanz, die MausMaus, Ingeborg angesichts der Komplexität der Weltgesellschaft auch in anspruchsvollen Modellen kosmopolitischer Demokratie für unrealisierbar und auf friedlichem Weg unerreichbar hält.[90] Im ausdrücklichen Gegensatz zu supranationalen Modellen sieht MausMaus, Ingeborg auf globaler Ebene ausschließlich horizontale Beziehungen zwischen Staaten vor. Zwischenstaatliche vertragliche Vereinbarungen (über z.B. Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen) seien dort erforderlich, wo die gleichen Verhältnisse anzutreffen sind; zudem könne über die nationalstaatliche parlamentarische Kontrolle solcher Vertragsschlüsse dem Demokratieprinzip entsprochen werden[91].
|28|D. Literaturhinweise
Baxter, Hugh , Habermas: The Discourse Theory of Law and Democracy, Stanford 2011.
Baynes, Kenneth , Habermas, London 2016.
Brunkhorst, Hauke/Kreide, Regina/Lafont, Christina (Hrsg.), Habermas-Handbuch, Stuttgart 2009.
Eberl, Oliver (Hrsg.), Transnationalisierung der Volkssouveränität. Radikale Demokratie diesseits und jenseits des Staates (FS Ingeborg Maus), Stuttgart 2011.
Habermas, Jürgen , Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats [1992], 4. Aufl., mit einem neuen Nachwort, Frankfurt am Main 1994.
ders. , Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt am Main 1996.
ders. , Der gespaltene Westen, Frankfurt am Main 2004.
ders. , Zur Verfassung Europas. Ein Essay, Berlin 2011.
Maus, Ingeborg , Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluss an Kant [1992], Frankfurt am Main 1994.
dies. , Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie, Berlin 2011.
dies. , Menschenrechte, Demokratie und Frieden. Perspektiven globaler Organisation, Berlin 2015.
dies., Justiz als gesellschaftliches Über-Ich. Zur Position der Rechtsprechung in der Demokratie, Berlin 2018.
Niesen, Peter/Herborth, Benjamin (Hrsg.), Anarchie der kommunikativen Freiheit. Jürgen Habermas und die Theorie der internationalen Politik, Frankfurt am Main 2007.
Rosenfeld, Michael (Hrsg.), Habermas on Law and Democracy, Cardozo Law Review 17, 4–5, 1995, 767–1648.
von Schomberg, René/Baynes, Kenneth (Hrsg.), Discourse and Democracy: Essays on Habermas’s Between Facts and Norms, Albany 2002.
|29|Derrida und das Modell der Dekonstruktion
Thomas-Michael Seibert
DekonstruktionDas praktische Recht hat einen doppelten Boden. Jeder, der die Justiz anruft und ihre Mittel nutzen möchte, hat zwar eine Vorstellung, in welche Richtung sie wirken soll. Oft kommt aber etwas anderes heraus als gedacht, und nicht selten erschlägt die Justiz diejenige, die sie zu Hilfe ruft. Strafprozesse wegen Vergewaltigung sind ein Beispiel dafür, dass sich die Justiz gegen diejenige wenden kann, die ihre Macht und Hilfe benötigt hätte. Was das praktische Recht anrichtet, kann seit hundert Jahren mit den Methoden der Rechtssoziologie untersucht werden. Seitdem es eine Rechtssoziologie gibt, existiert ein semiotischer Verdacht, der dahin geht, was als Recht ausgegeben werde, sei in Wirklichkeit nur ein verbrämtes Modell der Gewalt. Wer sich seitdem für das Recht zwischen Erkenntnis, Macht und Gewalt interessiert, muss mit diesem Verdacht umgehen. Man kann ihn bezweifeln, besänftigen, manchmal sogar zerstreuen, aber man wird ihn nicht los[92]. Wer Spuren lesen kann, verharrt in beständigem Fragen und in Zweifeln. Ein Modell dafür bietet die DekonstruktionDekonstruktion. Dekonstruktion ist der Einsatz, den man wagen muss, wenn man Zweifel hat: nach dem Unausgesprochenen fragen, Gründe umkehren und jede Umkehr der Gründe wieder verdächtigen, denn es kann etwas anderes als Recht dahinter stecken. (Juridische) GerechtigkeitGerechtigkeit ist immer unterwegs. Sie verlangt nach Fragen.
A. Zur Vorstellung der Fragen
Der Philosoph der Fragen ist Jacques Derrida. Ganze Absätze seiner Texte bestehen aus Fragen und vergeblich sucht der Leser nach entsprechenden Antwortsätzen. Man muss sie erst noch selbst bilden. Derrida stammt aus Zwischenreichen, die Merkmale prägen: er war Jude, aber nicht religiös, Franzose, aber (Jahrgang 1930) aus Algerien mit der Folge, dass die französische Staatsbürgerschaft von Vichy-Frankreich 1942 aberkannt wurde, Philosoph, Leser klassischer Texte von Aristoteles und Plato, schreibender Autor, aber ständig in Vorträgen auf weltweiten Konferenzen präsent. Bereits im Jahre 1967 sind seine Programmschriften erschienen, nämlich die Husserl-Lektüre »Die Stimme und das Phänomen«, die den Primat der Lautlichkeit in der Sprache bestreitet, das Hauptwerk »Grammatologie«, das den Vorrang der Schrift begründet, und schließlich eine |30|Aufsatzsammlung unter dem Titel »Die Schrift und die DifferenzDifferenz«, mit der Derrida die herrschende strukturale Betrachtung auf Prozesse, die »im Kommen sind«, umstellt. Die NietzscheNietzsche, Friedrich-Lektüre bietet für Derrida im Jahre 1976 den Einstieg in eine grundlegende Rechtsfrage[93], die Juristen scheinbar beantwortet haben: Wer ist Autor einer Verfassung? Dass es »das Volk« sei, halten inzwischen auch die Juristen für eine dekonstruierbare Aussage, die nicht über DekonstruktionenDekonstruktion reden. Derrida bewegt sich programmatisch »vor dem Gesetz«, liest auf einem weiteren Kolloquium in Cerisy-la-Salle im Jahre 1982 die gleichnamige Kafka-Parabel über den Türhüter »Vor dem Gesetz« und übersetzt die Position des »Mannes vom Lande« als vorbeurteilt, vorverurteilt, vorurteilsverhaftet, fast unübersetzbar aus dem französischen Titel »Préjugés«[94]. Es folgen weitere Beiträge über den Zusammenhang von Recht und Philosophie, mit denen Derrida die Kantische Rechtslehre aufnimmt[95], es folgen lange Ausführungen über NietzschesNietzsche, Friedrich Politik der Feindschaft[96], und es folgt vor allem der für die Rechtstheorie programmatisch gewordene Vortrag über »Force of Law« vor der amerikanischen Critical Legal Society im Jahre 1989[97]. Markenzeichen für Derrida-DekonstruktionenDekonstruktion sind lange Textlektüren, die das Augenmerk auf sprachliche Feinheiten richten, Worte, Wortklänge, Assoziationen, die der eilige Leser nicht entdecken wird, mit denen aber dem gelesenen Text etwas Neues »aufgepfropft« werden kann. Diesen Ausdruck verwendet Derrida selbst[98] und er versteht sich gern als Gärtner, als Kultivator, der ein Reis aufpfropft und aus Altem Neues wachsen lässt. Wie dieses Neue aussehen wird oder wie lange es braucht, um zu wachsen, verrät der Meistergärtner aber an keiner Stelle. Was aufgepfropft wird, kommt langsam und ist – ein Grundton der dekonstruktiven Philosophie – »im Kommen«. Was das für das Recht heißen könnte, bleibt noch zu entdecken, und das muss man inzwischen ohne autorisierte Anleitung tun. Derrida starb schnell und unerwartet im Oktober 2004. Hinterlassen hat er ein semiotisches Modell für den Umgang mit Sprachzeichen, das Besonderheiten aufweist, wenn man nur übliche hermeneutische Traditionen kennt, in dem aber gerade Juristen fortlaufend arbeiten, ohne es zu wissen. Das Modell soll zunächst in einer der DekonstruktionDekonstruktion an sich nicht angemessenen Kürze dargestellt werden (B), ehe man fragen kann, was davon auf das Recht passt (C) und was in der Rechtslehre bisher diskussionsweise angekommen ist (D) mit einigen wenigen Lektürehinweisen am Schluss (E).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Neue Theorien des Rechts»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Neue Theorien des Rechts» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Neue Theorien des Rechts» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.