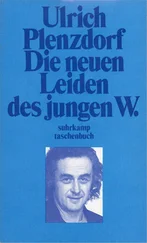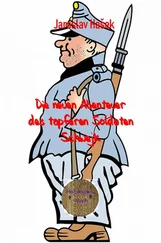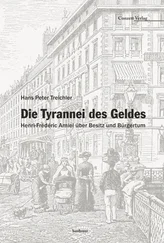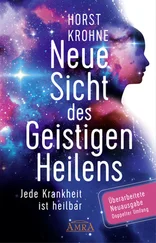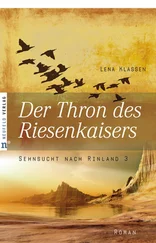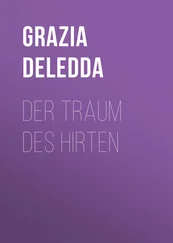Der Staat kommt in HabermasHabermas, Jürgen’ Konzeption erst dadurch ins Spiel, dass eine effektive Organisations- und Durchsetzungsgewalt des Rechts erforderlich wird – eine Serviceleistung für Recht und DemokratieDemokratie, die allein der Staat bisher anbietet. Die Staatsapparate folgen allerdings einer anderen Logik als praktische Diskurse: sie verständigen sich über administrative Macht, die ebenfalls in Rechtsform weitergegeben wird. Die Notwendigkeit, nicht nur Prozesse der Rechtsanwendung und -durchsetzung, sondern auch Rechtsetzungsprozesse staatlich zu institutionalisieren, bringt nun einerseits verschiedene Kompromittierungen der idealisierten Diskursprozedur mit sich: die Beschränkung auf einen kontingent-abgegrenzten demos , die Bewältigung von Zeitdruck für das Fällen bindender Entscheidungen, die Einführung des Mehrheitsprinzips, die Delegierung von rechtserzeugenden Diskursen an Parlamente usw.[30]. Dabei werden auf das Recht bezogene staatsbürgerliche Diskurse nicht vollständig institutionell absorbiert, sondern wandern zum Teil in die informelle politische Öffentlichkeit ab. Andererseits soll die administrative Macht der staatlichen Organe weiterhin ausschließlich von der »kommunikativen Macht«, die in demokratischer Rechtsetzung erzeugt wird, autorisiert werden. Die Autorisierungsbedürftigkeit |17|jeglichen staatlichen Handelns durch kommunikative Macht bringt auch ein neues Verständnis von Gewaltenteilung mit sich. Die Gesetzgebung und die ihr nachgeordneten Instanzen von Justiz und Verwaltung lassen sich »nach Kommunikationsformen und entsprechenden Potentialen von Gründen differenzieren«[31]: Im Gegensatz zur Gesetzgebung haben Verwaltung und Justiz keinen Zugriff auf das gesamte Spektrum von pragmatischen, ethischen und moralischen Gründen (das von ihnen ansonsten im Extremfall auch contra legem geltend gemacht werden könnte). Sie müssen daher »von der Gesetzgebung getrennt und an einer Selbstprogrammierung gehindert werden«[32]. Dass auch die Rechtsprechung über »die in Gesetzesnormen gebündelten Gründe nicht beliebig verfügen« kann, ist ein Aspekt der ursprünglich von Klaus Günther entwickelten Unterscheidung zwischen Normbegründungs- und Anwendungsdiskursen, die Richtern im Falle offenbar kollidierender Rechtsnormen nicht gestattet, diese Normen auf ihre praktische Vernünftigkeit zu überprüfen, sondern ihre Erörterungen im gegebenen Fall an der Frage ihrer Situationsangemessenheit ausrichtet[33]. Sie erlaubt die Differenzierung zwischen unparteilicher Anwendung und moralischer Beurteilung von Normen, zu der Richter kein Mandat haben. Derselbe Typ von »Sichtblende« (Ingeborg MausMaus, Ingeborg) gegenüber substantiellen Erwägungen von Ethik und Moral verhängt der Verwaltung einen Rückgriff auf eigenständige, von ihrer gesetzlichen Programmierung unabhängige, Legitimationsressourcen.
Charakteristisch für HabermasHabermas, Jürgen’ Konzeption der Rechtserzeugung ist sein Konzept einer »zweigleisigen« deliberativen Demokratie[34], die auf die parallele Aktivität institutionalisierter Gremien und informeller Öffentlichkeit(en) setzt. Die Kombination »starker«, entscheidungsbefugter, mit so genannten »schwachen« Öffentlichkeiten soll nicht nur Druck auf sich möglicherweise vermachtende parlamentarische Abläufe ausüben können[35]. Starke und schwache Öffentlichkeiten verfügen über verschiedene Qualitäten, so dass selbst unter idealen Rahmenbedingungen (überschaubare Bevölkerungszahl und Fläche, |18|direkt-demokratische Institutionen) sich eine arbeitsteilige politische Willens- und Entscheidungsbildung anbietet: Während starke Öffentlichkeiten unter Zeitdruck aktuelle Problemlösungen suchen müssen, kann »die« Öffentlichkeit, vom Handlungsdruck entlastet, sensibel auf neue Bedrohungen und Chancen reagieren. Da in ihr nicht um Entscheidungen gerungen wird, fällt den Beteiligten eine Distanzierung von ihren Interessen leichter[36]. Unter den realen Bedingungen komplexer Gesellschaften fällt es weitgehend schwachen Öffentlichkeiten zu, die Inklusion aller Bürger und aller Positionen und Argumente ins Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen. In innerstaatlichen Zusammenhängen soll HabermasHabermas, Jürgen zufolge die Dynamik politischer Steuerung dennoch weitgehend beim Parlament und den es dominierenden Akteuren liegen – nur in außergewöhnlichen, etwa krisenhaften Situationen obliegt es der politischen Öffentlichkeit, die Initiative zu übernehmen[37]. Die Aufgabe einer Verfassungsgerichtsbarkeit sieht HabermasHabermas, Jürgen darin, die Kommunikationsvoraussetzungen zu schützen, auf die die Bürger in starken und schwachen Öffentlichkeiten in der Ausgestaltung des Systems der Rechte angewiesen sind. Die Kompetenz der Verfassungsrechtsprechung, Gesetze zu invalidieren, beschreibt er als institutionell ausgelagerte Form einer »Selbstkontrolle« des parlamentarischen Gesetzgebers[38]. Seine Überlegungen, eine solche reflexive Prüfungsebene in Form eines Parlamentsausschusses zu institutionalisieren, sowie Bemerkungen zur parlamentarischen Bestellung der Verfassungsrichter zeigen jedoch, dass die »pragmatische[n] und rechtspolitische[n] Gründe«[39], die für die Ausdifferenzierung einer Verfassungsgerichtsbarkeit geltend gemacht werden können, unter gewaltenteiliger Rücksicht nicht hinreichend in die DiskurstheorieDiskurstheorie integriert sind[40]Demokratie.
Mit der politisch-philosophischen DiskurstheorieDiskurstheorie des Rechts nimmt HabermasHabermas, Jürgen einen zweiten Anlauf, um dem Phänomen des modernen Rechts gerecht zu werden. In seiner stärker soziologisch interessierten Theorie des kommunikativen Handelns kommunikatives Handeln hatte er zwischen Recht als Organisationsmittel für mediengesteuerte gesellschaftliche Subsysteme und Recht als Institution unterschieden, d.h. zwischen Recht als anonymem Mechanismus, der mithilfe seiner Disposition über die Vergabe von Macht oder Geld eine gesellschaftssteuernde Funktion übernimmt, und einem noch über Legitimitätsforderungen lebensweltlich |19|angebundenen Recht[41]. HabermasHabermas, Jürgen geht also zunächst von einer zumindest deskriptiven Angemessenheit der systemtheoretischen Beschreibung eines Rechtssystems aus, das sich aufgrund funktionaler Erfordernisse gegenüber anderen gesellschaftlichen Bedürfnissen abschotten muss, um mit ihrer Hilfe einen pathologischen Phänomenbereich zu erschließen[42]. Seine These ist, dass mehr und mehr gesellschaftliche Bereiche, die bisher »kommunikativ«, d.h. über internalisierte Normen, die im interpersonalen Umgang jederzeit in Frage gestellt werden können, integriert wurden, durch Recht als System »kolonialisiert« werden. Insbesondere das Sozialrecht biete ein Beispiel dafür, dass sich das Rechtssystem in Handlungsbereiche wie Familie, Pflege, Kindererziehung, etc. ausdehnt und die dort herrschenden kommunikativen Handlungszusammenhänge ergänzt und schließlich überformt. Auf der Basis der Demokratietheorie in Faktizität und Geltung werden die Verhältnisse nun zumindest der Möglichkeit nach umgekehrt: insofern kommunikative Impulse in der Rechtserzeugung zur Geltung gebracht werden können, dient das Recht als »Transformator«, der Botschaften von der gesellschaftlichen Basis im politischen und im Wirtschaftssystem verständlich werden lassen und die vollständig abgekoppelte systemische Reproduktion solcher Bereiche verhindern können soll[43].
B. Aufklärung der Rechts- und Demokratietheorie: MausMaus, Ingeborg
Ingeborg MausMaus, Ingeborg’ Rekonstruktion des RechtspositivismusPositivismus antwortet auf die Frage, wie unter den Bedingungen der fortgeschrittenen Industriegesellschaft mit den Entwicklungen neuer trans- und supranationaler Regelungsebenen demokratische Selbstbestimmung und Freiheitssicherung der Individuen durch Rechtsstaatlichkeit überhaupt noch möglich sind. Dabei steht sie in enger Verbindung zum »radikalen« Flügel der Kritischen TheorieKritische Theorie, besonders Herbert MarcuseMarcuse, Herbert[44]. Mit Franz L. NeumannNeumann, Franz L.[45] verweist Maus darauf, dass »politische wie soziale Herrschaft sich am ungehemmtesten durch völlige EntformalisierungEntformalisierung des Rechts verwirklichen« kann[46].
Читать дальше