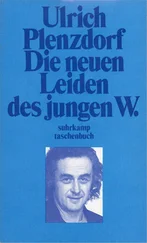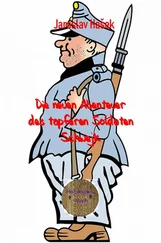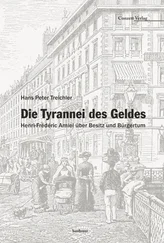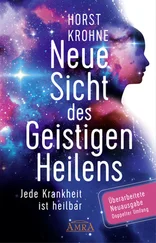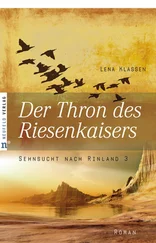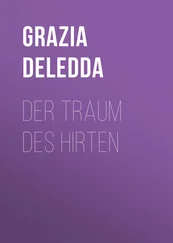1 ...6 7 8 10 11 12 ...30
|31|B. Die DekonstruktionDekonstruktion in fünf Operationen
I. Gegensätze in Texten suchen
DekonstruiertDekonstruktion werden fast immer Texte. Das mag erstaunen, weil Derrida sich durchaus allgemeiner philosophischer und lebensweltlicher Phänomene annimmt und die Freundschaft zwischen Menschen oder die Gabe des einen an den anderen untersucht. Für alle diese Lebensweltkonzepte präsentiert er aber schnell und ohne Umstände schon auf den ersten Blick problematische Texte. »O meine Freunde, es gibt keinen Freund« heißt der thematische Satz für die »Politik der Freundschaft«, der Aristoteles zugeschrieben wird[99], ohne dass Entstehung und Kontext klar wären, und ihm wird eine Ergänzung NietzschesNietzsche, Friedrich aus »Menschliches, Allzumenschliches« zugeordnet, die da lautet:
Freunde, es giebt keinen Freund, so rief der sterbende Weise. Feinde, es giebt keinen Feind, ruf ich, der lebende Thor[100].
Beide Sätze zeigen auf den ersten Blick, wie die dekonstruktive Interpretation sich bewegt und vor allem: wie sie in Bewegung kommt. Sie sucht Gegensätze auf und versucht, sie so zu steigern, dass sie sich nicht friedlich nebeneinander vereinbaren lassen, sondern in möglichst großer Nähe einen scheinbar oder wirklich unauflöslichen Widerspruch herstellen. Wer wissen will, was Freundschaft bedeutet, soll zunächst einmal nach der Feindschaft suchen und überlegen, in welchen Zusammenhängen er wie oft Feinden begegnet. Wer nach der Rechtfertigung der Todesstrafe fragt, soll sich mit den Bedingungen der Begnadigung befassen[101]. Wer die Unabhängigkeit eines Staates fordert, ist aufgefordert, darüber nachzudenken, welchen Abhängigkeiten er oder sie folgen[102]. Wer in der Welt »Schurken« oder gar »Schurkenstaaten« denunziert, mag über das Gute und den guten Staat nachdenken, der möglicherweise in weiter Ferne liegt[103]. Das alles sind verhältnismäßig grobe Oppositionen und Supplemente, vor allem solche, die lexikalisch ohne große weitere Bemühungen auffallen. Freundschaft und Feindschaft, Abhängigkeit und Unabhängigkeit, Schurken und Gutmenschen, Todeskandidaten und Begnadigte – diese Paarbeziehungen sind klassisch.
|32|II. Zu Paradoxa kondensieren
Weniger klassisch ist die zweite dekonstruktive Bewegung, die Derrida unter Bezug auf Montaigne oder NietzscheNietzsche, Friedrich im Freundschaftsbeispiel augenfällig demonstriert. Man wird auf das Verhältnis der Supplementarität und auf die damit einhergehende ParadoxieParadoxie in einem einzigen Satz gestoßen. Die Widersprüchlichkeit wird kondensiert an einer Stelle, an der man sie hören kann. Als Operation heißt das: Formuliere die Paradoxie und ziehe dabei den Widerspruch auf die deutlichst mögliche Form zusammen. Dazu darf man fernliegende, abseitige Methoden benutzen. Was sieht man, wenn man auf Europa sieht? Wie geht das überhaupt: auf Europa sehen? Von welchem Ort aus oder in welchem Medium lässt sich ein Erdteil überhaupt sehen? Da muss man schon eine Landkarte zu Hilfe nehmen, und wenn man über Phantasie verfügt, sieht man, dass Europa auf einer solchen Landkarte wie ein Kap aussieht oder wie eine Landspitze, die sich vor der viel größeren Landmasse des Kontinents Asien gleichsam in den Ozean schiebt[104]. Europa ist dann »ein Kap« so wie Afrika ins Kap der guten Hoffnung ausläuft oder Südamerika in Kap Horn mündet, und wenn Europa ein Kap ist, dann fragt man wegen des Gegensatzes nach dem »anderen Kap«. Eine solche Frage gelingt möglicherweise nur vor dem akademischen Publikum eines Kolloquiums über die kulturelle Identität Europas, vor dem Derrida im Jahre 1990 einen politischen Vortrag unter dem Titel »L’autre Cap«, also »Das andere Kap« hielt und nach dem Blick auf die Landkarte den Eindruck des Kaps auf das Wort übertragen hat, für das er eine zweifache Bedeutung untersucht. Das Kap ist die Kapitale und stellt eine »Frage im Femininum«[105]: »Hat eine Kapitale der europäischen Kultur heute einen Ort, gibt es einen Ort für sie?« (Kursivierung im Orig.). Die zweite, sächliche Frage richtet sich auf das Kapital, und Derrida zögert nicht, das Werk von Karl MarxMarx, Karl unter diesem Titel sogleich in seine kulturelle Identitätsfrage zu übernehmen, aber er erweitert die Frage auf den Mut »zu einer neuen Kritik der neuen Auswirkungen des Kapitals (in bislang unbekannten technisch-sozialen Strukturen)«[106]. Benutzt werden dabei rhetorische Figuren wie die Kondensation in Begriffen oder Sätzen, in denen ein einzelner Ausdruck (Freundschaft, Kap, Kapital) verschiedene Argumentationslinien oder Wertkomplexe zusammenbringt. Man wird einräumen müssen, dass der Fortgang einer Argumentation vom Bild auf einer Landkarte über die Bildung eines Wortes, dem man schließlich einen Buchstaben nimmt und einen anderen Artikel gibt, so dass man zu einem anderen Wort kommt, künstlich und nicht ohne Vorerfahrung nachvollziehbar ist. Der Weg vom Kap der guten Hoffnung über das Kap Europa zur Kapitale Europas (die es aber nicht gibt) zu MarxMarx, Karl’ »Kapital« gelingt nur Jacques Derrida. Aber eindrücklich wird diese Kondensation, wenn Derrida am Ende seines Vortrags |33|über die kulturelle Identität von den Pflichten redet, denen man genügen muss, um zum »anderen Kap« zu gelangen[107], zu dem Kap ohne Kapitale und jenseits allfälliger Akkumulation des Kapitals.
III. MetaphernMetapher ausbeuten
Der Weg dorthin ist nicht geradlinig. Die Bewegung der DekonstruktionDekonstruktion verweigert, was im platonischen Zusammenhang definitorisch heißen würde, also die Einordnung eines Wortes in ein größeres Ganzes, verbunden mit einer spezifischen DifferenzDifferenz, die dem Einzuordnenden seinen logischen Platz im Ganzen zuweist. Es gibt zwar ein Zentrum, eine Kapitale, aber die Dekonstruktion vermeidet den Hauptplatz und betont die Differenz. Solche DifferenzenDifferenz findet man, indem man einen Begriff buchstäblich untersucht, und das heißt: beim Namen nimmt. Für Derrida liegt darin eine »Aufkündigung« ( suspension ), eine Absage an Zustände, die auffallen. Die suspension befragt das Wort gegen seinen manifesten Sinn, indem sie am Buchstaben haftet und der bleibenden Schriftform Vorrang vor dem flüchtigen, mündlichen Ausdruck gibt. Das darf man in platonisch-sokratischer Tradition nicht machen. Wer ein Wort buchstäblich nimmt, behandelt es wie einen Namen, und dann entsteht das Gegenteil einer Definition. In der begriffssyllogistischen Tradition spricht man von »MetaphernMetapher«, und Juristen lernen, dass sie nicht metaphorisch, sondern begrifflich trenngenau reden sollen. Die dritte Operation besteht deshalb in einer zweifachen sprachlichen Bewegung. Man nimmt einen Begriff beim Namen und stellt Verbindungen her, die metaphorisch wirken und inhaltlich nutzbar gemacht werden können. Zu achten ist auf Assoziationen, mögen sie auch im Text als vollkommen nebensächlich erscheinen, mag sich der Autor im Zweifel vom Namen distanzieren und sagen, so habe er es nicht gemeint und man solle einfach ein anderes Wort benutzen. Mit der Buchstäblichkeit des Namens stößt man zur MetapherMetapher vor. Das klingt zunächst einmal rätselhaft, und bleibt es auch eine Zeitlang. Man fragt sich, wohin es führen soll und warum jemand, der die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika liest, als wesentliches Merkmal die Eingangsformel festhält (» We, therefore, the Representatives of the United States of America […] «)[108]. Man fragt sich, inwiefern die wechselnde Regieanweisung Enter the Ghost , dann exit the Ghost und schließlich re-enter the Ghost ein Drama wie »Hamlet« charakterisiert[109], und ganz ähnlich fragwürdig erscheint es, wenn ein Redner über das Recht des Stärkeren mit der Feststellung beginnt, Drehungen, Wendungen und Windungen, dazu der Turm und der Kreislauf von Runden und |34|Umrundungen bestimmten das Thema[110] . Es sind die abwandelnde Wiederholung wie der Umbau von Worten, mit denen ein Titel entwickelt und Begriffe wie Namen[111] benutzt werden, sodass ein Kap zur Kapitale wird und von dort ins Kapital hinüber gleitet.
Читать дальше