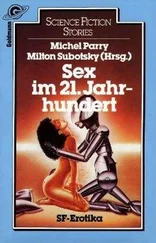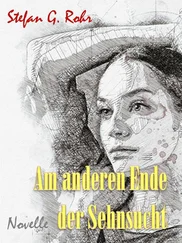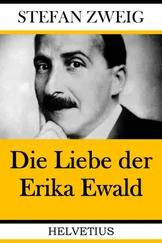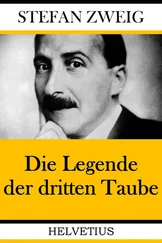1.2.2Austausch und Interdependenz
„Austausch- oder Interdependenztheorien“ sehen in der wechselseitigen Abhängigkeit von Menschen in sozialen Interaktionen und Beziehungen den Schlüssel zum Verständnis von Interaktionen in Gruppen (z. B. Blau 1964; Thibaut/Kelley 1959). Die Kernannahmen dieser Perspektive sind wie folgt: Menschen sind im Hinblick auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse voneinander abhängig (interdependent). Die Bildung von relativ zeitstabilen Gruppen ermöglicht einen sicheren und vorhersehbaren wechselseitigen Austausch von materiellen und immateriellen Ressourcen. Durch Kooperationen mit anderen Gruppenmitgliedern können zudem Ziele erreicht werden, die individuell nicht erreicht werden könnten. Da Menschen in Gruppen ihre Beziehungen, Regeln und Ziele aufeinander abstimmen und gemeinsam definieren müssen, lassen sich ihre Verhaltensweisen nicht einfach aus ihren individuellen Eigenschaften ableiten; eine Gruppe selbst verhält sich dementsprechend typischerweise auch anders als die Summe ihrer Mitglieder.
Im Einklang mit „Theorien der rationalen Entscheidung“ („Rational-Choice Theories“) gehen Vertreter von Austausch- oder Interdependenzansätzen zudem davon aus, dass Menschen Interaktionen, die instrumentell für die individuelle Zielerreichung sind, als positiv empfinden und sie dementsprechend wiederholen. Sie schließen sich daher Gruppen an und verbleiben in ihnen, wenn sie erwarten, dass die Interaktionen innerhalb von Gruppen zu positiven Ergebnissen für sie führen; sie verlassen die Gruppe, wenn die Bedürfnisbefriedigung unter den Erwartungen bleibt und sich positivere Alternativen für die Realisierung individueller Ziele bieten. Die Annahme der wechselseitigen Abhängigkeit als einer zentralen psychologischen Grundlage für Gruppenprozesse findet sich in zahlreichen Ansätzen der Forschung zu zwischenmenschlichen Interaktionen innerhalb von Gruppen. So basieren Erklärungsansätze zum sozialen Einfluss (➔ Kapitel 2) beispielsweise auf der Prämisse, dass sich Menschen von anderen Menschen beeinflussen lassen, da sie im Hinblick auf die Validierung ihres Bildes von der Realität (informationaler Einfluss) oder auf ihr Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit (normativer Einfluss) auf andere Gruppenmitglieder angewiesen sind.
Die Interdependenzannahme spielt auch eine zentrale Rolle bei der Erforschung von Kooperationsverhalten in Gruppen (➔ Kapitel 3). Darüber hinaus liefert sie auch einen Ausgangspunkt für die Erklärung intergruppalen Verhaltens. So postuliert die in Kapitel 5dargestellte „Theorie des realistischen Gruppenkonfliktes“ von Sherif et al. (z. B. Sherif 1966) beispielsweise, dass Vorurteile und Konflikte zwischen Gruppen dann entstehen, wenn innerhalb der Gruppen die Wahrnehmung vorherrscht, sie seien im Hinblick auf ein Ziel negativ interdependent (d. h., wenn eine Gruppe eine Ressource nur zulasten der anderen Gruppe nutzen kann).
1.2.3Soziale Kategorisierung und soziale Identität
Der „soziale Identitätsansatz“, der die „Theorie der sozialen Identität“ (Tajfel/Turner 1986) und ihre Weiterentwicklung in Form der „Selbstkategorisierungstheorie“ (Turner et al. 1987) umfasst, betont die kognitiven Grundlagen der Gruppenbildung. Diesem Ansatz zufolge ist Interdependenz zwar eine hinreichende, nicht aber eine notwendige Bedingung dafür, dass Menschen Gruppen bilden und sich entsprechend ihrer Gruppenzugehörigkeit verhalten. Notwendig ist vielmehr, dass Personen sich selbst und andere Personen als gleiche (austauschbare) Elemente einer sozialen Kategorie wahrnehmen. Ausgangspunkt der Entwicklung des sozialen Identitätsansatzes waren Ergebnisse der Experimente mit minimalen Gruppen von Tajfel und Mitarbeitern (z. B. Tajfel et al. 1971).
In einem paradigmatischen Experiment von Tajfel et al. (1971, Exp. 2) wurden die Untersuchungspersonen (14- bis 15-jährige Schüler) auf der Basis ihrer angeblichen Präferenzen für einen von zwei abstrakten Malern (Klee oder Kandinsky) in zwei Gruppen eingeteilt – tatsächlich erfolgte die Einteilung nach dem Zufallsprinzip. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurden sie gebeten, kleinere Geldbeträge zwei anderen Personen zuzuteilen, von denen jeweils eine Person zur Eigen- und die andere zur Fremdgruppe gehörte. Sich selbst konnten die Untersuchungspersonen kein Geld zuteilen. Die Gruppen werden als „minimal“ bezeichnet, da zentrale Bedingungen, die üblicherweise in Gruppensituationen vorherrschen, durch das experimentelle Paradigma gezielt ausgeschlossen wurden. So bestand weder innerhalb noch zwischen den Gruppen Face-to-Face-Interaktion, die Untersuchungspersonen wussten nicht, wer in der Eigen- und wer in der Fremdgruppe war, es bestand keine rationale oder instrumentelle Verbindung zwischen der Gruppeneinteilung und der Art der Aufgabe und die Zuteilung brachte keinen persönlichen Vorteil (d. h., die Gruppenmitglieder waren nicht interdependent). Gruppenstiftend war allein die Kategorisierungsinformation.
Überraschenderweise war schon unter diesen minimalen Bedingungen und in Abwesenheit von Interdependenz eine systematische Tendenz zur Bevorzugung der Mitglieder der Eigengruppe gegenüber Mitgliedern der Fremdgruppe zu beobachten.
Das Herzstück der Erklärung für die in den Minimalgruppenexperimenten beobachteten Effekte aus der Perspektive des sozialen Identitätsansatzes ist das Konzept der sozialen Identität. Der „Theorie der sozialen Identität“ zufolge stellt die Kategorisierung in Eigen- und Fremdgruppen die psychologische Basis dafür dar, dass sich Personen nicht länger im Sinne ihrer individuellen Identität, sondern auf der Basis ihrer Gruppenzugehörigkeit hinsichtlich ihrer sozialen Identität definieren. Formen der sozialen Diskriminierung, wie sie in basaler Form in minimalen Gruppenexperimenten zu beobachten sind, lassen sich dieser Perspektive zufolge als eine Strategie verstehen, eine positive soziale Identität herzustellen.
Die „Selbstkategorisierungstheorie“ hat die Bedeutung des Konzeptes der sozialen Identität zur Erklärung von Verhalten innerhalb und zwischen Gruppen weiter ausgearbeitet. Der Begriff „personale Identität“ bezieht sich in diesem Forschungszusammenhang auf eine Definition einer Person als einzigartiges und unverwechselbares Individuum, die auf einer interpersonalen Differenzierung auf der Basis individueller Merkmale beruht („ich“ vs. „du“ oder „ihr“). Der Begriff der „sozialen Identität“ bezieht sich demgegenüber auf eine Selbstdefinition als austauschbares Gruppenmitglied, die aus einer intergruppalen Differenzierung zwischen Eigen- und Fremdgruppe auf der Basis gruppentypischer Merkmale resultiert („wir“ vs. „die“). Relativ zur personalen Identität basiert die soziale Identität auf einer inklusiveren Selbstdefinition, da die Mitglieder einer Gruppe oder sozialen Kategorie, zu der die Person gehört (der Eigengruppe), in die Selbstdefinition eingeschlossen werden („wir Psychologen“, „wir Deutschen“ etc.).
Vertreter des sozialen Identitätsansatzes nehmen an, dass in dem Maße, in dem sich Menschen im Sinne ihrer sozialen Identität definieren, das Erleben und Verhalten dieser Person durch die in der entsprechenden Gruppe vorherrschenden Werte, Normen, Einstellungen etc. beeinflusst wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass personale und soziale Identität nicht als statische Konzepte zu verstehen sind, sondern als dynamisch und kontextabhängig. Eine Person kann sich also, je nach Kontextbedingungen in einer Interaktionssituation in erster Linie als Mann sehen (im Unterschied zu den anwesenden Frauen), in der nächsten als Psychologe (im Unterschied zu den anwesenden Biologen) und in der darauffolgenden als einzigartiges Individuum, wobei jeweils die entsprechenden identitätsspezifischen Werte, Normen und Einstellungen das Erleben und Verhalten bestimmen. Der soziale Identitätsansatz hat zu einer Vielzahl von Erklärungen für intragruppale Prozesse (➔ z. B. in Kapitel 2: sozialer Einfluss; in Kapitel 3: Führungsverhalten) oder intergruppale Prozesse beigetragen (➔ z. B. in Kapitel 4: Stereotype und Vorurteile; in Kapitel 5: Konflikte zwischen Gruppen).
Читать дальше