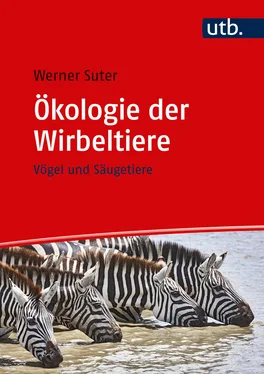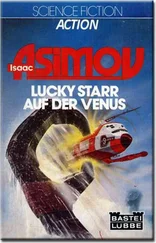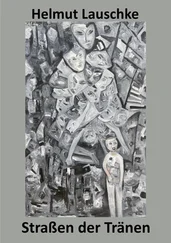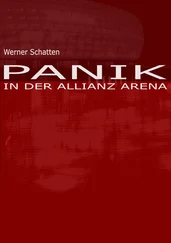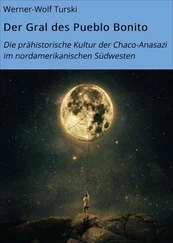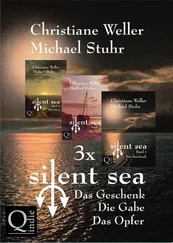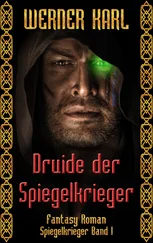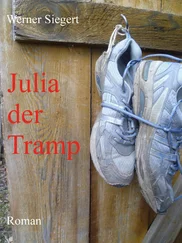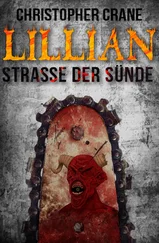Werner Suter - Ökologie der Wirbeltiere
Здесь есть возможность читать онлайн «Werner Suter - Ökologie der Wirbeltiere» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ökologie der Wirbeltiere
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ökologie der Wirbeltiere: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ökologie der Wirbeltiere»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ökologie der Wirbeltiere — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ökologie der Wirbeltiere», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1. Maximieren der Aufnahmerate, entweder der kurzfristigen Bruttoaufnahmerate von Biomasse oder der längerfristigen Nettoaufnahmerate von Nährstoffen. Diese berücksichtigt die Einschränkungen, die der Nährstoffgehalt der Nahrung und die Form und Funktionsweise des Verdauungstrakts auferlegen. Im Speziellen können die Aufnahme von Energie, Protein, Natrium oder die Verdauungsgeschwindigkeit maximiert werden. Modelle zeigen, dass Herbivoren bei geringem Angebot Pflanzen wählen sollten, die eine kurze Bearbeitungszeit benötigen, um damit die Bruttoaufnahmerate zu steigern. Bei Überfluss hingegen sollten sie selektiv hoch verdauliche Pflanzen herausgreifen, um eine höhere Verdauungsgeschwindigkeit zu erreichen und damit die Nettoaufnahmerate zu vergrößern (Hirakawa 1997). Wie Herbivoren unter einschränkenden Bedingungen einen Kompromiss bei der Nahrungszusammensetzung erreichen können, ist bereits in Kapitel 3.3behandelt und am Beispiel von Elch und Ziesel illustriert worden. Oft ist übrigens die Maximierung der Nettoaufnahmerate von Rohprotein von größerer Fitnessrelevanz als die Maximierung des Energiegewinns (Newman J. 2007).
2. Eine Balance in Form der Wahl komplementärer Nährstoffe anstreben. Eine solche Strategie setzt letztlich das Erkennen einzelner Nährstoffe respektive von deren Bedarf und Mangel voraus. Dies ist als nutritional wisdom bezeichnet worden, doch ist das Erkennen nur für Kalzium und Natrium nachgewiesen ( Kap. 2.2). Gezielte Nahrungswahl nach Kriterien der Nährstoffbalance ist sowohl im Experiment als auch bei Freilandstudien schwierig zu demonstrieren, aber bei Arthropoden belegt. Oft sind die Ergebnisse von Untersuchungen an großen Herbivoren aber mit weitaus einfacheren Hypothesen, etwa simplen Faustregeln wie «Friss vor allem junge Pflanzentriebe» (fresh flush), genauso kompatibel (Cassini 1991).
3. Die Aufnahme toxischer oder verdauungshemmender Sekundärstoffe minimieren. Die Lernfähigkeit von Herbivoren zur Vermeidung toxisch wirkender Pflanzen ist recht gut ausgebildet; zudem können viele Herbivoren mithilfe spezifischer Drüsen toxische Komponenten selbst relativ gut neutralisieren oder deren Wirksamkeit durch geeignete Zusammensetzung der Nahrung und die zeitliche Dosierung herabsetzen. Insgesamt sind aber die Strategien der Herbivoren im Umgang mit Sekundärstoffen noch ungenügend verstanden (du Toit et al. 1991; Duncan A. J. & Gordon 1999; Foley et al. 1999; Torregrossa & Dearing 2009).
Nahrungssuche in heterogener Umwelt
Außer den ernährungsphysiologischen Einschränkungen sehen sich Herbivoren zahlreichen umweltbedingten constraints gegenüber, welche die Nahrungssuche und Wahl der Nahrung beeinflussen. Neben der Qualität muss ja auch die Abundanz der Nahrung berücksichtigt werden, wenn die Nettoaufnahmerate maximiert werden soll. Dafür spielen die strukturellen Eigenschaften der Vegetation, wie Höhe, Dichte und die vertikale Verteilung der Biomasse, eine wichtige Rolle (Illius & Gordon 1993). Die meisten Landschaften sind bezüglich der Vegetationsstruktur sehr heterogen, und selbst einförmig wirkende Steppen können auf kleinem Raum unterschiedliche Muster in der Pflanzenqualität, Biomasse und Vegetationsstruktur aufweisen. Heterogenität kann also auf verschiedenen räumlichen Maßstäben (Skalen) evident sein, und Herbivoren treffen ihre Entscheidungen über Ort und Dauer der Nahrungssuche entsprechend. Es können nach Bailey & Provenza (2008) folgende Einheiten unterschieden werden (deutsche Bezeichnungen dafür sind nicht gebräuchlich):
1. Bite: Die kleinste räumliche Einheit ist ein Zweig, eine Einzelpflanze oder sogar ein kleiner Grasbüschel, der mit einem Biss geerntet werden können. Die Entscheidung eines Herbivoren, bei einer bestimmten Pflanze zuzubeißen, betrifft also eine Fläche von 1–100 cm2, je nach der Körpergröße und der Morphologie seiner Kiefer. Da Herbivoren jeden Tag 10 000–40 000 Mal zubeißen müssen (Illius & Gordon 1993), liegt die zeitliche Maßstabgröße für den Entscheid bei 1–2 s. Die Messgröße dafür ist der bite size, also die pro Biss geerntete Pflanzenmasse.
2. Feeding station: Im Rahmen einer Bissfolge machen Herbivoren einzelne Schritte, um benachbarte Zweige oder Gräser zu erreichen, bleiben aber am Ort (Maßstab bis einige m2 respektive wenige min). Die Aktivität lässt sich als Bissrate messen.
3. Patch: Flecken einheitlicher Artenzusammensetzung (m2 bis etwa 1 ha), die für die Dauer von bis zu 30 min beweidet werden. Beim Wechseln zwischen patches wird die Bisssequenz unterbrochen. Auf einem patch wird in der Regel die Zeitdauer der Nahrungsaufnahme gemessen.
4. Feeding site: Bezeichnet in etwa ein Nahrungshabitat, also Flächen (1–10 ha) bestimmter Vegetationszusammensetzung, die sich zur Nahrungssuche eignen und in denen sich ein Tier während der Aktivitätsphase der Nahrungssuche (etwa 1–4 Stunden) aufhält.
Entscheidungen, welche die Bissgröße und -rate (1.) und die Aufenthaltsdauer auf einem patch (3.) betreffen, spielen wohl die größte Rolle; zumindest sind ihnen zahlreiche Untersuchungen gewidmet. Die räumliche Hierarchie dieser Einheiten kann gegen oben noch erweitert werden und umfasst dann Flächen, die von einem Tier während eines ganzen Tages, einer Saison oder in noch längeren Zeitabschnitten genutzt werden. Solche großmaßstäblichen Aspekte werden in den Kapiteln 5und 6angesprochen.

Abb. 3.14 Ein sogenannter grazing lawn in einer tansanischen Küstensavanne (links). Durch die wiederholte Beweidung derselben Stellen können Herbivoren das Gras sehr kurz und so in einem steten juvenilen Zustand halten; die nachwachsenden Sprosse enthalten einen wesentlich geringeren Faseranteil und sind damit besser verdaulich. Weiderasen sind nicht auf Ökosysteme mit hohen Huftierdichten beschränkt, sondern kommen auch vor, wo andere herbivore Säugetiere und Vögel, vor allem Gänse, weiden (Drent & Van der Wal 1999). Zudem sind analoge Vorgehensweisen von Laubäsern (Huftieren und Raufußhühnern) bekannt. Im Rahmen des allgemeinen allometrischen Zusammenhangs zwischen Bissgröße und Körpergröße wirkt sich die Morphologie der Kieferpartie modifizierend auf die Bissgröße aus. Zwar ist die Breite des Unterkiefers zwischen den vierten Schneidezähnen, die sogenannte incisor arcade breadth, grundsätzlich ebenfalls eine Funktion der Körpergröße. Zusätzlich ist sie bei eher selektiv weidenden Herbivoren schmaler, bei mehr flächig grasenden Arten wie dem abgebildeten Weißbartgnu (rechts) hingegen breiter, was größere Bissgrößen zulässt (Illius & Gordon 1988). Kleinere Herbivoren können damit auf kleinerer räumlicher Skala selektiver fressen als größere Arten mit ähnlichen Ansprüchen (Laca et al. 2010).
Bissgröße, Bissrate und Aufnahmerate
Die Bissgröße nimmt allometrisch mit der Körpergröße zu und damit auch die momentane Aufnahmerate zu Beginn der Nahrungssuche, während die Bissrate, bei großen artspezifischen Schwankungen, über die Körpergröße konstant bleibt. Dabei gibt es keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen herbivoren Vögeln und Säugetieren, was bedeutet, dass das Kauen der Säugetiere (das bei Vögeln fehlt; Kap. 2.4) keinen Einfluss auf die Aufnahmerate hat (Steuer et al. 2015). In einem Versuch mit drei ungleich großen Hirscharten, die Zweige von winterkahlen Bäumen ästen, entsprach die Dicke der gefressenen Zweige jeweils der Dicke der Zweige, die den jüngsten Jahreszuwachs am Baum bildeten; die Unterschiede zwischen den Hirscharten waren aber weitgehend eine Funktion der Körpergröße (Shipley et al. 1999). Die Bissgröße kann bei Grasfressern aber auch mit der Vegetationshöhe variieren. Eine höhere Grasnarbe wird einer tieferen vorgezogen, wenn sich so eine höhere Aufnahmerate erzielen lässt. Dies gilt aber nur, solange die Grasqualität vergleichbar ist, das heißt, wenn es sich wirklich um eine höhere Nettoaufnahmerate des leichter verdaulichen Anteils handelt (Illius & Gordon 1993). Meist jedoch sind niedrige Gräser jünger und faserärmer und damit von höherer Qualität. In den afrikanischen Savannen ziehen die meisten Herbivoren kürzeren Graswuchs vor; manche Arten, die wie das Weißbartgnu (Connochaetes taurinus) Grasnarben auf der feeding station- oder patch-Ebene flächig beweiden, schaffen sich so mosaikartig Weiderasen (grazing lawn; Abb. 3.14). Thomsongazellen (Eudorcas thomsoni) nutzen solche Rasen gerne und erreichen den höchsten Energie-gewinn bei niedrigen, aber nicht den allerniedrigsten Grashöhen (Abb. 3.15; Fryxell et al. 2004). Dies ist offenbar ein trade-off zwischen Qualität und Abundanz, den auch viele andere Herbivoren eingehen (Fryxell et al. 2014). Weiteres dazu in Kap. 8.8.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ökologie der Wirbeltiere»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ökologie der Wirbeltiere» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ökologie der Wirbeltiere» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.