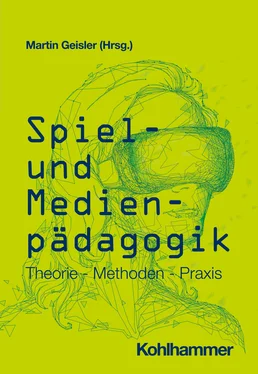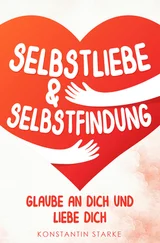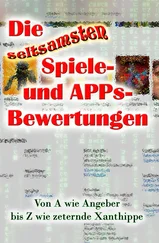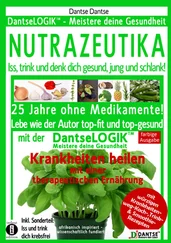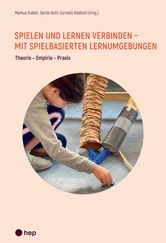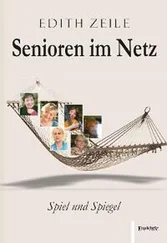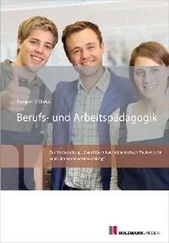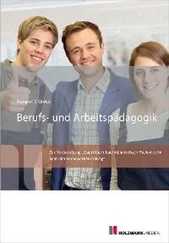Blickt man auf die Bedürfnisse, die Jugendliche haben und ihren Entwicklungsprozess prägen, wird deutlich, dass digitale Medien im Sinne der Post-Digitalität inzwischen entscheidenden Einfluss nehmen oder zumindest zu den früheren Formen der Bedürfnisbefriedigung hinzukommen. Das Bedürfnis nach a) Erlebnis wurde durch Unternehmungen mit Freund*innen und medialen Erlebnissen in Film und Fernsehen gedeckt, heute kommen Internet, Soziale Netzwerke, Video-Plattformen und virtuelle Spielwelten hinzu. Der Wunsch nach b) Zugehörigkeit erfolgte über Freund*innen, Vereine und Familie, deren Funktion durch (Online-) Communities und die Kommunikation über Soziale Netzwerke teils sogar ersetzt wird. Die eigene c) Identitätsentwicklung wurde durch die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und im Dialog der Generationen voran getrieben, heute geschieht dies auch in Communities und virtuellen Spielformen, wie MMORPGs (Massive Multiplayer Online Roleplaying Games), die eine spielerische und experimentelle Form des Ausprobierens unterschiedlicher Persönlichkeitsdarstellung gegenüber Dritten ermöglichen, ohne negative Konsequenzen im realen Leben befürchten zu müssen. Das d) Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit erfolgte durch das Rebellieren gegen Autoritäten, sei es im Elternhaus oder gegen Obrigkeiten, heute vollzieht sich die Abgrenzung von Erwachsenen vor allem in digitalen Medien, wenn die digitalen Räume exklusiv von Jugendlichen genutzt werden und Erwachsene sie gar nicht erst nutzen. Facebook z. B. wurde in dem Moment für Jugendliche uninteressant, als ihre Eltern sich entsprechende Accounts eingerichtet hatten und es fand eine Migrationsbewegung zu anderen Diensten statt. Auch die Tatsache, dass Eltern den Plattformen kritisch gegenüberstehen, ermutigt Jugendliche erst recht, sie zu nutzen. Das verständliche Bedürfnis nach Abgrenzung von Erwachsenen im digitalen Raum hat allerdings auch zur Folge, dass die Aktivitäten oft unter Ausschluss pädagogischer Einflussnahme stattfinden, was bezogen auf den Kinder- und Jugendschutz entsprechende Herausforderungen mit sich bringt. E) Orientierung und Sicherheit gaben gemeinsam mit anderen Jugendlichen konsumierte Medien mit ihren Vorbildern sowie sichtbare Zugehörigkeitsmerkmale, wie Bekleidung oder bestimmte Marken. Smartphone, Computerspiele und Internetplattformen erweitern diese Bedürfnisbefriedigung entsprechend, auch ohne, dass Zugehörigkeiten außerhalb der Mediennutzung wahrgenommen werden können. Die f) sexuelle Orientierung wurde von Jugendzeitschriften und in Interaktion mit Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts bedient, heute konsumieren schon Kinder Hardcore-Pornografie über einschlägige und frei verfügbare Internetseiten. Und das Bedürfnis nach g) Status wurde mit sportlichen Aktivitäten und Marken-Bekleidung gedeckt, zu denen sich inzwischen die Anzahl von Likes in den Sozialen Netzwerken, Aufmerksamkeit-generierende Posts oder Erfolge in Online-Games hinzugesellen.
Pädagogik und Kulturelle Bildung agieren schon immer mit Lebensweltbezug. Entsprechende Angebote für eine digital lebende Generation kommen nicht umhin, auch digitale Medien aufzugreifen und Zielgruppe entsprechend in ihrer Lebenswelt abzuholen. Der Medienpädagogik fällt hier eine Schlüsselrolle zu, nämlich zwischen digital und analog zu vermitteln, Anschlussmöglichkeiten offen zu legen und auf mögliche Schnittstellen hinzuweisen. Das kann ein im virtuellen Raum umgesetztes Theaterstück sein, die Bearbeitung von Film- oder Computerspielmusik im Rahmen der Musikvermittlung, das Schreiben von Geschichten in Hypertext-Formaten oder das Aufgreifen von medialen Unterhaltungsformen, wie Serien und Filmen in der Bildenden Kunst als Basis für einen kreativen Schaffensprozess nutzbar zu machen. Dabei nimmt Medienpädagogik im Sinne einer ganzheitlichen Kulturellen Bildung nur einen Teil in einem sich wechselseitig befruchtenden Fächerkanon ein.
2.3 Handlungsfelder und Qualifikation
Eingangs wurde bereits angedeutet, wie vielschichtig die Handlungsfelder der Kulturellen Bildung sind. Vielleicht liegt es an dieser Vielfalt, dass es mitunter schwer fällt, Kulturelle Bildung zu beschreiben oder zu definieren. In Malerei, Fotografie, Musik, Tanz, Zirkus, Literatur, Handwerk, Bildhauerei, Theater, Museen und vielen anderen Bereichen engagieren sich Menschen und versuchen mit ihren Mitteln etwas zur Entwicklung der Gesellschaft oder des Einzelnen beizutragen. Berthold Brecht sieht in jeder künstlerischen Betätigung die Freisetzung aller Produktivität zur Gestaltung eines freieren Lebens der Menschen (vgl. Brauneck 1993, S. 339). Er beschreibt, sicherlich nicht zuletzt geprägt durch die marxistische Gesellschaftslehre, den gesellschaftlichen Zustand als Produkt seiner eigenen Praxis. Folglich ist die Gesellschaftslage durch gesellschaftliche Praxis zu verändern (vgl. Krabiel 1993, S. 128). »Die heutige Welt ist dem Menschen nur beschreibbar, wenn sie als eine veränderbare Welt beschrieben wird.« (Brauneck 1993, S. 334) Derartige Veränderungen vollziehen sich permanent und aktuell insb. durch den Wandel zur Informationsgesellschaft. Lernende anzuregen und zu begleiten, die eigene Lebenswelt zu verändern, ist grundlegendes Ziel jedes pädagogischen Handelns.
Über die theoretischen, strukturellen und politischen Rahmenbedingungen stellt die Auseinandersetzung mit den Handlungsfeldern der Kulturellen Bildung die Praxis in den Vordergrund. Dennoch ist es unerlässlich, dass Theorie und Praxis einen Transfer bilden. Die Theorie muss sich an der Praxis orientieren. Aber auch die Praktiker*innen sind gut beraten, sich mit den Hintergründen ihres Handelns zu befassen. Erst auf diese Weise können z. B. Spiel- und Medienpädagog*innen erkennen, dass sich trotz der augenscheinlichen Vielfalt zahlreiche Gemeinsamkeiten aufzeigen, dass wichtige Überlegungen an anderer Stelle bereits vollzogen wurden, dass eine Kombination der Handlungsfelder methodisch und didaktisch bereichern und dass sie nicht nur den Horizont der Zielgruppen erweitern. Natürlich dürfen und sollen Anleitende leidenschaftlich für ihren Fokus werben und begeistern. Für die Entfaltung von Kompetenzen, für die persönliche Begeisterung und für Langzeitmotivation ist es jedoch wichtiger, Angebote für Klient*innen bereitzustellen und diesen die Wahl des rezeptiven oder produktiven Mediums zu überlassen.
Die Handlungsfelder der Kulturellen Bildung stellen in der Summe zugleich eine gute Definition dar. Kulturelle Bildungsprozesse werden in ihrer Wahrnehmungs-, Handlungs-, Wissens- und Erkenntnismöglichkeit erst verständlich, wenn sie konkret und in Abhängigkeit zu den verschiedenen Künsten beschrieben werden. (vgl. Bockhorst 2012, S. 426). »Die Reflexion über die Besonderheiten des sich Bildens in den Sprachen der Kunst, des Spiels und der Medien, die Auseinandersetzung mit den komplexen Prozessen des ästhetischen Lernens und der Unterstützung künstlerischer und kultureller Kompetenz, muss im Feld der Akteure und Anbieter Kultureller Bildung stets im Fokus stehen« (ebd.). Im Verlauf soll dies zumindest für Spiel und Medien erfolgen. Diese vertiefte Auseinandersetzung darf jedoch nicht dazu führen, andere Sparten zu ignorieren. In zahlreichen spiel- und medienpädagogischen Projekten finden sich bereits Schnittmengen zur Kunst, zum Theater, zur Literatur usw. Computerspielpädagogische Projekte wie »Mein Avatar und ich«, welches im Verlauf Techniken des Improvisationstheaters einbezieht, »Pic your Game life« oder die In-Game-Photography, die Screenshots als Kunstwerke ansieht, die Verbindung zur Literatur im Projekt »Digitale Spiele und Lesen«, zum Sport im Projekt »RealLife Jumper«, zahlreiche Projekte die Architektur im Spiel »Minecraft« betonen u. v. a. finden sich inzwischen in entsprechenden Projektsammlungen. Sie alle demonstrieren die bereits bestehende praktische Vermischung der Handlungsfelder. Es ist an der Zeit diese auch theoretisch und im Selbstverständnis zu untersetzen. Die Bedeutung der Vielfalt von Kunst- und Ausdrucksformen wird auch offenbar, wenn der Blick auf die unangeleiteten Aktivitäten gerichtet wird. Die alltägliche und häusliche Spiel- und Mediennutzung vieler Kinder und Jugendlicher finden allerdings überwiegend konsumierend statt. Nur relativ wenigen Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen gelingt der Sprung von »Consumer« zum »Prosumer«, bei dem sie selbst aktiv werden. Formelle Bildungseinrichtungen können dazu nur bedingt beitragen. Die Kulturelle Bildung, mit ihrem interdisziplinären Wesen, kann entsprechende ergänzende Anregungen geben.
Читать дальше