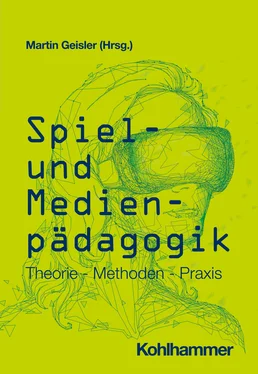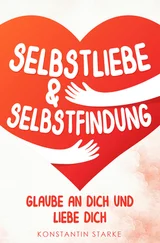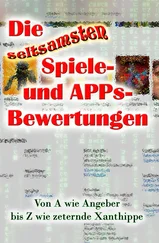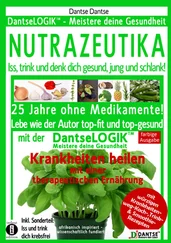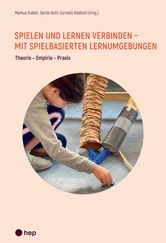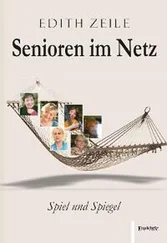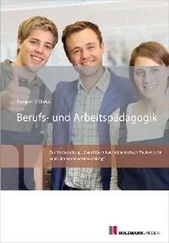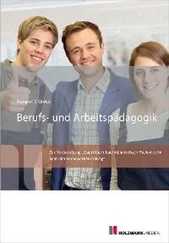Eine von Bildern dominierte Welt, kann nur mit Hilfe ästhetischen Denkens dechiffriert werden. Ästhetisches Denken entwickelt sich, neben der nicht geringer zu schätzenden Schriftsprache, zu einer wichtigen Kompetenz. So wird offenbar, welche Bedeutung die Kultur- und Medienpädagogik für alltägliche Lebensbereiche hat. »Die Schulung der Wahrnehmung als Basisqualifikation ästhetischer Denkweise könnte dabei eine zentrale Rolle spielen.« (Röll 1998, S. 64) Wahrnehmungskompetenz ist eine wesentliche Fähigkeit für die angemessene Beurteilung von realer und medialer Wirklichkeit. Eine zeitgemäße Medienpädagogik ist daher untrennbar auch mit der Auseinandersetzung von Wahrnehmung, Semiotik, Ästhetik, Kunst und Kultur verbunden. Diese wiederum sind als Grundlagen seit langer Zeit Gegenstandbereiche der Kulturellen Bildung. Sie kennzeichnet sich durch sehr einbeziehende und grundsätzliche Ansätze. Zugleich ist sie innerhalb ihrer Handlungsfelder praxisnah und prozessorientiert. Im Ergebnis bedeutet Kulturelle Bildung die Fähigkeit zur erfolgreichen Teilhabe an kulturbezogener Kommunikation mit positiven Folgen für die gesellschaftliche Teilhabe insgesamt (vgl. Ermert 2009). Wirksamkeit, Entfaltung und Akzeptanz sind wichtige Elemente, um Menschen das Gefühl von Gestaltung, Einfluss, Partizipation sowie Mit- und Selbstbestimmung zu verleihen. So verdeutlichen sich die Nähe zwischen Kultureller Bildung, Sozialer Arbeit und Politischer Bildung.
Je nach speziellem Thema oder Methode erscheint es darüber hinaus sinnvoll weitere Disziplinen zu beachten und einzubeziehen. Die meisten bildlichen Ausdrucksformen sehen sich heute beispielsweise fast zwangsläufig mit einer Auseinandersetzung im Umgang mit Daten konfrontiert. Dies wiederrum schließt an die Themen Datensicherheit und »BigData« an. Eine normative, kreative und/oder pädagogische Auseinandersetzung führt auf diese Weise deduktiv von der Kulturellen Bildung, über die Medienpädagogik zu Fragen der Wissenschaft, Informatik, Ethik, Recht usw. hin zur Erstellung eines künstlerischen oder pädagogischen Prozesses oder Produktes. Dabei zeigt sich, dass auch die Medienpädagogik als zugleich allgemeine und spezielle Disziplin wiederum Impulse für die Kulturelle Bildung aufzeigt und bearbeitet. Die Facetten und Bereiche Kultureller Bildung stehen daher in einem Wechselwirkungsprozess zu einander. Dies wiederum wird z. B. dadurch deutlich, dass sich die Bereiche Spiel- und Medienpädagogik über das Medium des Computerspiels zunehmend verknüpfen. Für diese Symbiose ist es zunächst nicht zwangsläufig nötig eine übergeordnete Struktur zu definieren. Für das Durchdringen der Themen, der Hintergründe, der Ziele und der Methoden ist die Kulturelle Bildung als gemeinsame Basis jedoch empfehlenswert und bereichernd.
Kulturelles und pädagogisches Handeln wird bestimmt durch die Anforderungen der Gesellschaft (vgl. Spanhel 2011, S. 107). Dies geht mit der Haltung systemischen Denkens einher, in welcher Menschen stets in der Abhängigkeit ihrer jeweiligen sie umgebenden sozialen Systeme betrachtet werden. In diesem Zusammenhang wird gleichfalls deutlich, dass Menschen nicht nur sich selbst verändern können, sondern auch Einfluss auf die sozialen Systeme haben (vgl. König/Volmer 2016, S. 9). Bereits diese Grundlagen deuten darauf hin, wie komplex und vielschichtig die Themen geworden sind (oder schon immer waren), mit denen sich die Spiel- und Medienpädagogik befassen muss. Eine Medienpädagogik, die klient*innenorientiert agieren will, muss fachübergreifend denken, komplexe Zusammenhänge sehen und die darin für sie wesentlichen Dynamiken erkennen. Natürlich lässt sich dieser Gedanke auch umkehren und induktiv auffassen. Aus einer zunächst spontanen und naiven Idee entspinnt sich nicht selten ein Netzwerk an Professionen, Theorien und anderen zu berücksichtigenden Bereichen. Der ganzheitliche Gedanke beinhaltet auch die Chance sich selbst und seine Wirkungsmöglichkeiten als Teil des Ganzen wahrzunehmen und nicht als isoliert und unabhängig von anderen Belangen. Kulturelle Bildung und alle ihre Facetten können als eine Art Brennpunkt verstanden werden, vom dem aus vielzähligen Aktivitäten und Schnittstellen möglich sind.
Es ist nötig, sich einerseits einer Profession zu widmen und Expertise zu erlangen, andererseits den Blick für naheliegende Bereiche offen zu halten, diese zu berücksichtigen oder gar einzubeziehen. Dann, ggf. im Teamteaching, fachübergreifend zu denken, auch in dem Bewusstsein, nicht für alle Themenbereiche umfassende Kenntnisse zu besitzen und mit anderen zu kooperieren, die entsprechende Expertise mitbringen. Diese an sich recht einfache Logik, stellt sich in der Praxis teils herausfordernd dar. Die Bereitschaft über den »Tellerrand« zu blicken, die in einer zunehmend komplexeren, globalen und digitalen Welt unentbehrlich ist, bedeutet auch das Verlassen von Komfortzonen. Lehrende galten lange Zeit als Expert*innen für ihre jeweiligen Fachdisziplinen. Eingehend mit dem Wandel von der Gutenberg-Galaxie zur Internet-Galaxie (vgl. Geisler 2019, S. 13f.) stehen sie nun vor der Herausforderung, ihre Arbeit zunehmend als Coaches, Navigator*innen und Lehrbeleiter*innen zu verstehen (vgl. Röll 2003, S. 216ff.). Darin liegt jedoch in der Übergangsphase das Risiko einen Anteil der Berufsidentität aufzugeben. So wird der Lehrende zum Lernenden. Allerdings mit einem umso breiteren Verständnis über Zusammenhänge, Prozesse und Synergien.
Betrachtet man das Spiel als Methode oder Mittel zur Aneignung von Welt (vgl. Piaget 1992, S. 139ff) wird schnell deutlich, welchen Stellenwert es in der kindlichen Entwicklung und weiterführend in der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen einnimmt. Die spielerische und von Motivation und Neugier geprägte Exploration des Selbst in einer von Erwachsenen dominierten Gesellschaft hat entscheidende Wirkungen auf den Entwicklungsprozess des Menschen und das sich Zurechtfinden in einer immer komplexer werdenden Umwelt. Ergänzend können Planspiele oder Simulationen als spielerische Vermittlungsmethoden auch bei Erwachsenen die Komplexität des Alltags auf ein einfacheres Maß reduzieren und Wechselwirkungsprozesse sowie Abhängigkeitsfaktoren in Systemen transparent vermitteln. In Simulationsspielen wie »Ecopolicy« (Brett- und Computerspiel) oder »Democracy« (Computerspiel) agieren Spieler*innen als Entscheidungsträger*innen, um einen Staat zu lenken. Dabei werden die Auswirkungen dieser Entscheidungen nach jeder Runde transparent dargestellt, ausgewertet und dienen den Spielenden dazu, ihre nächsten Züge und Eingaben entsprechend anzupassen und aus Erfolgen sowie Misserfolgen zu lernen. Zufällige Spielereignisse bieten zusätzliche Herausforderungen, auf die reagiert werden muss und die wiederum Auswirkungen auf die nächsten Entscheidungen haben. Auch für Gruppen konzipierte Planspiele verfolgen diesen Zweck, nur dass hier ein weiterer Aspekt hinzukommt, nämlich das Interagieren mit anderen in (gruppen-)dynamischen Prozessen. Diese soziale Interaktion in Spiel- und Lernumgebungen erfordert seitens der Spielenden eine Übernahme und Aneignung von vorgegebenen Rollen im Wettbewerb oder Zusammenarbeit mit anderen Spiel-Identitäten, die oft eigene Ziele innerhalb des Settings verfolgen. Hierzu schlüpfen sie in die jeweilige Rolle und schau-spielern entsprechend. Dabei bringen sie zwar ihre eigenen Erfahrungen und ihre Persönlichkeit in das (Schau-)Spiel mit ein, agieren aber rollenbezogen und als anderer Charakter. Dies gelingt mit Kreativität sowie der Fähigkeit des Menschen, sich in andere hineinversetzen und aus sich selbst herausgehen zu können. Der Psychologe Donald W. Winnicott bescheinigt dem Spiel mit Identitäten eine schöpferische Kraft, die es ermöglicht, aus den Spielerfahrungen wiederum Rückschlüsse auf das Selbst zu ziehen und Veränderungsprozesse in Gang zu setzen (vgl. Winnicott 1973). Allen Spielformen gemein ist, dass Spieler*innen im Spiel an sich aufgehen, die Umgebung oder Zeit vergessen und sich ganz auf die Anforderungen und das Agieren konzentrieren. Die skizzierten Beispiele belegen die von Roger Caillois in seinem Werk »Les jeux et les hommes« (Caillois 1958) vorgenommene Unterteilung von Spielen in vier Kategorien: agon (Wettkampf), alea (Zufall), illinx (Rausch) und mimikry (Maskierung), die einzeln oder auch kombiniert vorkommen können.
Читать дальше