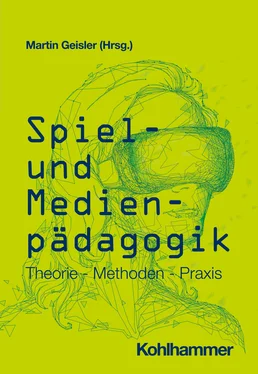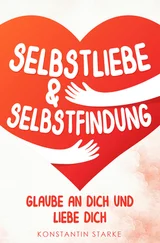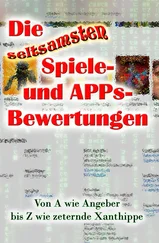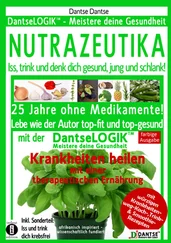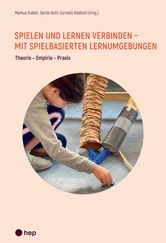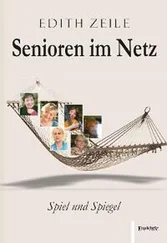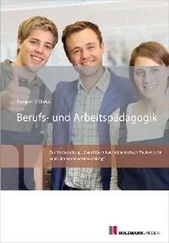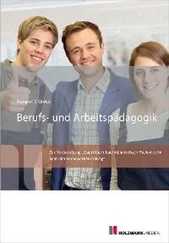Die Verwendung von digitaler Technik kann auch ein Motivator und Aktivator für hybride Nutzungsformen in der Kulturellen Medienbildung sein. In Filmprojekten wird die Faszination für das Medium aufgegriffen, um eigene Filme zu realisieren. Nicht selten bilden Filme und Serien die Basis für eigene Storyentwicklung und Realisierung. Die Projekte drehen sich nicht nur um medienbezogene Inhalte, wie Kamera, Licht, Ton, Tricktechnik, Schnitt usw., sondern auch um Elemente anderer Fachdisziplinen, wie Werkpädagogik und Bildende Kunst beim Kulissenbau oder der Anfertigung von Kostümen und Requisite. Es finden sich Bezüge zu Literatur und Storytelling bei der Drehbuchentwicklung, die Verknüpfung zu Schauspiel und Theater beim Agieren vor der Kamera und die Verwendung von Musik und Geräuschen als Gestaltungsmittel. Nicht selten gibt es aber gerade bei aufwendigen Projekten, wie der Filmproduktion, motivationale Stolpersteine im Verlauf, wie den zeitraubenden und aufwendigen Schnitt oder nötige Nachvertonung und manche Anleitende finden sich dann nach Feierabend selbst am Rechner wieder, um den Film zu vollenden, da der Zielgruppe die Lust vergangen ist. »Der Erfolg eines Peer-to-Peer-Filmprojektes hängt besonders stark von der Einstellung und Motivation der Teilnehmer ab. Die Motivation der Teilnehmer wird insbesondere dann als hervorragend beschrieben, wenn die Teilnehmer das Projekt für sich adaptieren und möglichst frei »ihren eigenen Film« drehen.« (Kempa 2010, S. 84f) Hier muss darauf geachtet werden, dass die Akteure selbst von der Idee und dem zu erwartenden Ergebnis begeistert sind und im Prozess dabei bleiben. Ein solches Projekt von oben überzustülpen, wäre kontraproduktiv – Partizipation ist das Zauberwort
Die Nutzung von Smartphones als multimediale Universalmaschine in den Hosentaschen von Kindern und Jugendlichen kann eine weitere Motivationsquelle für Projekte sein, die Kunst, Kultur und Medien miteinander verbinden. Jedes Gerät ist mit Sensoren und Funktionen ausgestattet, die eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung stellen. So können im Rahmen der Kunstvermittlung kreative Foto-Projekte oder Stop-Motion-Filme mit der eingebauten Kamera realisiert werden, in der Musikpädagogik Mikrofon und Lautsprecher zum Einsatz kommen oder die GPS-Anbindung für mobile Spielformen genutzt werden. Auch experimentelle Ansätze mit der eingebauten Sensorik sind möglich, wenn physikalische Gesetzmäßigkeiten zum Zuge kommen oder ausgelesen werden können. Den kreativen Nutzungsmöglichkeiten sind hier kaum Grenzen gesetzt. Die wenigsten Kinder und Jugendlichen sind sich aber dessen bewusst, was sie mit dem Gerät alles anstellen könnten, und die Verwendung dient meist nur der Unterhaltung und Kommunikation. Hier gilt es also im Sinne der Kulturellen Bildung ein technisches Gerät für den kreativen und künstlerischen Einsatz und Bildungsprozesse erst nutzbar zu machen und es als Werkzeug zur Auseinandersetzung mit Welt zu erkennen.
Oft lohnt zur Ideenfindung auch ein Blick auf die medialen Nutzungsgewohnheiten, die Kinder und Jugendliche an den Tag legen. In den letzten Jahren erlebt beispielsweise die Fotografie in medienpädagogischen Projekten eine Renaissance. Das hat mit der Beobachtung zu tun, dass Kinder und Jugendliche mit dem Smartphone ständig Fotos machen und sie über Soziale Medien wie Instagram verbreiten. Sie sind wichtiger Bestandteil von Jugendkultur und dienen hier vornehmlich der Kommunikation und Beziehungsarbeit. Das Interesse an Fotografie kann im Sinne künstlerischer Auseinandersetzung und ästhetischer Bildung nutzbar gemacht werden. »Dabei bieten Fotografie-Projekte mit Kindern und Jugendlichen sowohl aus pädagogischer wie auch aus künstlerischer Perspektive sehr gute Voraussetzungen und Möglichkeiten, wesentliche Prinzipien und Methoden der kulturellen Bildung wie Partizipation, Interessenorientierung, Stärkenorientierung, Selbstwirksamkeit oder künstlerischen Eigenwert umzusetzen« (Arbeitsstelle »Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW« 2015, S. 7). Ähnliche Anknüpfungspunkte ergeben sich für Filmprojekte mit Blick auf die Nutzung von Videoplattformen, für das Geschichten-Erzählen auf Basis von Social-Media- und Messenger-Postings, für die Werkpädagogik bei der Ausgestaltung von Making-Projekten unter Einbeziehung digitaler Technologie oder für Tanz-Projekte, die das Interesse an Games aufgreifen, die die Spielenden zum Tanz-Karaoke animieren. Es muss aber berücksichtigt werden, dass Kinder und Jugendliche verständlicherweise kein Interesse daran haben, dass ihre Vorlieben, Aktivitäten und Kulturräume pädagogisiert werden und Zielen Dritter dienen. Auf Partizipation und Berücksichtigung der intrinsischen Motivation der Zielgruppe kann jedoch aufgebaut werden.
Kinder und Jugendliche sind Expert*innen bei der Nutzung digitaler Geräte und Medien und diese Kompetenz können sie in Projekte miteinbringen. Allerdings bedeutet die Wahrnehmung, Achtung und der Einbezug kreativer Ausdrucksformen von Nutzenden nicht automatisch, dass diese einen reflektierten Umgang mit neuen Medien betreiben. Die Zahl derer, die innovativ und kreativ Medien gestalten, bleibt ausbaufähig. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen kann eine medienpädagogische Anleitung gut gebrauchen, um über den Tellerrand zu schauen, sich selbst zu hinterfragen, aktiv zu werden und etwas Neues auszuprobieren. Dabei ist durchaus zu berücksichtigen, dass viele Medien zunächst einmal den »Konsumenten« suchen und nicht etwa von sich aus zur Kreativität aufrufen. Hier sind (MedienPädagog*innen, Künstler*innen und Kulturschaffende gefragt, diese Vermittlungsarbeit zu leisten. Die Frage ist allerdings, ob sie die Kenntnisse und Kompetenzen mitbringen, Medien, das jeweilige Kulturfeld und Pädagogik gleichermaßen in Projekten abdecken zu können. An der Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid wurde in Zusammenarbeit mit der TH Köln ein Weiterbildungsformat »Kulturelle Bildung und Medienkompetenzen« KuBiMedia 9 9 Die Dokumentation des Forschungs- und Entwicklungsprojekts KuBiMedia wurde im Magazin für Kulturelle Bildung der BKJ »Kulturelle Medienbildung« veröffentlicht und steht zum Download zur Verfügung: https://www.bkj.de/publikation/kulturelle-medienbildung , Zugriff am 24.05.2020.
entwickelt, erprobt und evaluiert. Dieses Projekt hat das Ziel, Künstler*innen und Kulturschaffenden sowohl Medienkompetenzen zu vermitteln, die sie wiederum in ihre künstlerische und kulturelle Arbeit mit einfließen lassen können, wie auch grundlegende pädagogische Konzepte und Methoden an die Hand zu geben. Motiv der Weiterbildungsteilnehmer*innen war, im Sinne einer Lebensweltorientierung, digitale Medien als Motivationsbasis ihrer Kultur- und Kunstvermittlung nutzbar zu machen. Auch wenn viele Künstler*innen und Kulturschaffende haupt- oder nebenberuflich in der Kulturellen Bildung tätig sind, fehlt ihnen meist eine pädagogische Ausbildung. Diese kann durch ein Weiterbildungsformat sicherlich nicht ersetzt werden und so erweist sich letztlich eine intensive Zusammenarbeit der Disziplinen als Königsweg, wenn Tandem-Teams gebildet werden, in denen sich die jeweiligen Kompetenzen wunderbar ergänzen. Das Weiterbildungsformat ist in diesem Sinne inzwischen an der Akademie verstetigt worden. Das Zusammenspiel von (Medien)Pädagogik, Kultureller Bildung und Kunstvermittlung in interdisziplinären Ansätzen und Projekten kann die Zielgruppenarbeit enorm bereichern und ermöglicht allen Beteiligten gleichermaßen den Blick über den Tellerrand.
Arbeitsstelle »Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW« (2015): Merkheft 5 – Fotografie in Schule und Jugendarbeit. Schriftenreihe der Arbeitsstelle »Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW«: Remscheid.
Bilstein, J./Ecarius, J./Keiner, E. (Hrsg.) (2011): Kulturelle Differenzen und Globalisierung: Herausforderungen für Erziehung und Bildung. Wiesbaden: Springer.
Читать дальше