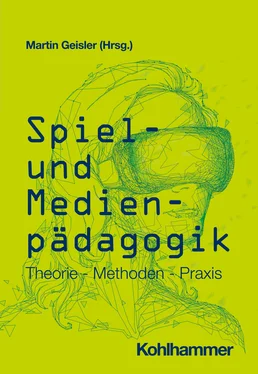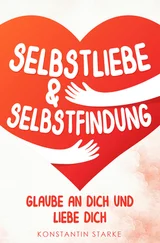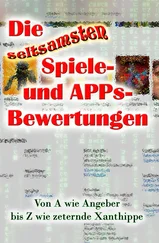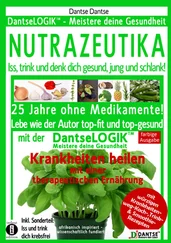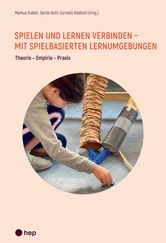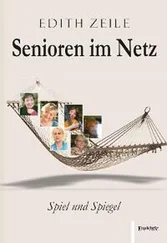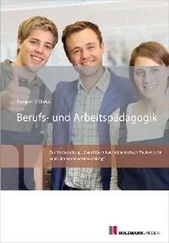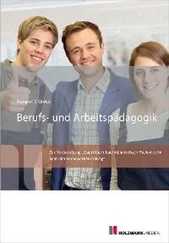2. Spiel mit Identitäten – Die Fähigkeit, alternative Identitäten annehmen und erforschen zu können.
3. Modellbildung und Simulation – Die Fähigkeit, dynamische Modelle realer Prozesse konstruieren, anwenden und analysieren zu können.
4. Wiederverwendung von Inhalten – Die Fähigkeit, Medieninhalte auf kreative Weise wiederverwenden zu können.
5. Adaptives Multitasking – Die Fähigkeit, die Umgebung global erfassen und bei Bedarf jederzeit auf einzelne Details fokussieren zu können.
6. Verteilte Wahrnehmung – Die Fähigkeit, kreativ mit Systemen interagieren zu können, die die Erweiterung kognitiver Kompetenzen ermöglicht.
7. Kollektive Intelligenz – Die Fähigkeit, kollektiv Wissen zur Verfolgung eines gemeinsamen Ziels produzieren zu können.
8. Bewertung von Medieninhalten – Die Fähigkeit, Glaubwürdigkeit und ethische Vertretbarkeit von Medieninhalten beurteilen zu können.
9. Transmediale Navigation – Die Fähigkeit, Erzählwelten über mediale Systemgrenzen hinweg multimedial verfolgen zu können.
10. Informationsvernetzung – Die Fähigkeit, über Netzwerke Informationen und Wissen suchen, analysieren und publizieren zu können.
11. Umgang mit alternativen Normen – Die Fähigkeit, unterschiedliche gesellschaftliche Wertesysteme verstehen und sich alternativen Normen anpassen zu können. (vgl.: Wagner 2008)
2.6 User generated content (UGC) und Schnittmengen zur Kulturellen Bildung
Nach dem Grundprinzip der Lebensweltorientierung agierend, greifen Sozial-, Kultur-, Spiel- und Medienpädagog*innen die Interessen von Kindern, Jugendlichen sowie allen anderen Zielgruppen auf, betrachten, analysieren und konzipieren Umgangsweisen, fügen nicht selten zusätzliche Aspekte ein bzw. betonen vorhandene oder forcieren Reflexionen. Bei der Förderung von Kompetenzen und der Vermittlung von Kultureller Bildung müssen Anleitende keineswegs davon ausgehen, dass Fähigkeiten bei Teilnehmenden noch nicht vorhanden sind. Nicht selten haben Kinder und Jugendliche längst Methoden gefunden, sich auszudrücken, ihr Umfeld zu gestalten, teilzuhaben und auf diese Weise entsprechende Kompetenzen entwickelt. »Digitale Medien stellen einen wesentlichen Faktor heutiger kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe dar. Dies gilt insbesondere für Jugendliche, da sie ihre kulturellen Praktiken vor allem in Bezug auf oder in Medien ausleben. […] In ihrem mobilen und vernetzten Medienhandeln pflegen Jugendliche nicht nur Beziehungen, agieren in Communities, demonstrieren ihre Zugehörigkeit zu Szenen und inszenieren sich in verschiedenen Formen, sondern sie beteiligen sich auch aktiv an der Gestaltung der Medienkultur bzw. an dem Prozess der Mediatisierung« (Helbig 2016, S. 2).
Im Bereich der Arbeit mit digitalen Spielen ist dabei der »user generated content« (nutzergenerierter Inhalt) von großer Bedeutung. Let’s Plays, Cosplaying, Casemodding, Parcours, Fan-Fiction oder viele weitere Formen sind keine Ergebnisse pädagogischer Intentionen und tragen doch enormes Bildungs- und kulturell wertvolles Potenzial in sich. Bei entsprechender Neugier, Offenheit und Vorerfahrung werden Anleitenden schnell vielfältige Schnittmengen zu Bereichen der Kulturellen Bildung offenbar. So ergeben sich beispielsweise allein für Cosplaying methodische Brücken zur Kunst, zum Theater, Handwerk, Zirkus, dem Spiel und den Medien. Die Haltung, die sich ergibt, wenn Anleitende diese Bereiche erkennen, akzeptieren, berücksichtigen, aufgreifen und ggf. für ihre Kontexte modifizieren, beruht auf drei Schritten: Zunächst gilt es, durch Lebenswelt- und Ressourcenorientierung kreative Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen (1). Die Aktivitäten sollten dann, ohne sie dabei in ihrem Mehrwert zu fragmentieren, mit fachlichen Methoden aus Bereichen der Kulturellen Bildung verknüpft und mit einem didaktischen Modell bzw. einer Zielstellung versehen werden (2). Schließlich soll Transfer und Mehrwert im Sinne der Förderung von (Schlüssel-) Kompetenzen erzielt werden. Zudem sollten Anleitende ggf. eine qualitative Überprüfung ihrer Methoden und der erreichten Ziele ergänzen (3).
Digitale Spiele haben einen künstlerischen und ästhetischen Wert. Dennoch dürfen und sollen sie, ganz im Sinne der Definition von Johan Huizinga, auch nutzlos, zweckfrei und zum Spaß da sein. In der Kulturellen Bildung, der Spiel- und Medienpädagogik werden sie, neben ihrem unterhaltenden und informellen Wert, zu pädagogischen Instrumenten. Anleitende fordern Nutzer*innen dazu auf, sich über sie auszudrücken, sich zu entwickeln, etwas zu interpretieren oder etwas neu zu erschaffen. Darin liegt sowohl eine große Chance als auch ein gewisses Risiko. Spiel-, Erlebnis- und Entfaltungsräume sind auch Rückzugsorte. Jugendliche nutzen sie auch als Abgrenzungsmechanismen. Diese wichtige Funktion im Kontext von Identitätsprozessen, sollte nicht durch zu starkes Eindringen, Unterwandern oder gar Instrumentalisieren seitens der Pädagog*innen aufgehoben werden. Es gilt demnach zwar Interessen, Lebenswelten und nutzergenerierte Inhalte aufzugreifen, die Hoheit über diese Räume jedoch nicht an sich zu ziehen. Anleitende müssen ihre »Tools« gut auswählen und sie nutzen, um ihre jeweilige Zielgruppe zu aktivieren und zu motivieren.
2.7 Aktivierung von Zielgruppen
Mit Blick auf die mediatisierte Lebenswelt von post-digital aufwachsenden Kindern und Jugendlichen stellt sich die Frage, wie sie motiviert werden können, sich auch auf Aktivitäten in anderen Kulturbereichen einzulassen. Eine Möglichkeit kann sein, das Interesse an Medien aufzugreifen und es mit anderen Kulturdisziplinen zu verknüpfen. »Getreu dem pädagogischen Leitspruch »Kinder dort abzuholen, wo sie stehen«, können sich in fachübergreifenden Ansätzen neue Möglichkeiten auftun, Kinder für andere Inhalte und Beschäftigungen jenseits des Bildschirms zu begeistern, die sie vielleicht sonst gar nicht erst kennengelernt hätten (Pohlmann & Waschk 2015, S. 206). Dabei können digitale Medien und Medienerlebnisse einen Ausgangspunkt bilden, um Kinder und Jugendliche zu einer kreativen Auseinandersetzung mit Medienwelten zu führen, sie auf dem Weg aus fachlicher Perspektive zu begleiten und kulturelle Praktiken zu vermitteln. Ein Ansatz könnte beispielsweise sein, mit Medienheld*innen neue Geschichten in Text, Bild, (Impro-)Theater oder Trickfilm zu erzählen und auf die Fantasie zu bauen. Sie könnten der Frage nachgehen: Was machen Mario, Bibi Blocksberg oder Harry Potter eigentlich in ihrer Freizeit? »Medien können die Fantasie anregen, wenn die Rezipient*innen an ihre individuellen Erfahrungen und Handlungswünsche konkret anknüpfen können und das Medium attraktive Freiräume zum Imaginieren lässt und zur Fantasietätigkeit in oder nach der Rezeption anregt« (Götz 2006, S. 404). Die Aufgabe für Anleitende besteht darin, einen Raum oder ein offenes Setting zu gestalten, in denen Kinder und Jugendliche ihre Fantasie in einem kreativen Schaffensprozess ausleben können. Medien können, müssen aber nicht weiterer Teil dieses Prozesses sein, das gelingt auch mit Stift, Pinsel, Papier oder auf der Bühne. Auch die Vermittlung kultureller Bildungsinhalte lässt sich mit einer solchen Methode verknüpfen, wie eine Erzählung, über die von Campbell skizzierten Stationen einer Heldenreise (vgl. Campbell 1999) umzusetzen oder eine vorangehende Filmanalyse zu bestimmten Merkmalen von Erzählung, Charakterentwicklung und Dramaturgie.
Ein anderer Ansatz kann es sein, z. B. die in Medien dargestellten Erzähl-Welten in Spielformen mit Rollenspiel- und erlebnispädagogischen Elementen zu überführen. Die Zauberwelt von »Harry Potter«, die Fantasy-Welt aus »Der Herr der Ringe« oder die Geschichten aus Computer-Rollenspielen bilden die mediale Basis für ein Pen-&-Paper-Rollenspiel oder ein Live-Action-Roleplaying-Game (LARP). Kinder und Jugendliche gestalten ihre eigenen Held*innenfiguren, denken sich eine Hintergrundstory des Charakters aus, schneidern Kostüme und agieren schauspielerisch in dieser Rolle in einem Spielsetting. Ein solches Projekt auf Basis von Games wurde vom Computerprojekt Köln e. V., vom Institut Spielraum und Student*innen der Sozialen Arbeit an der TH Köln in Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugend und Schule in Mülheim an der Ruhr als Ferienangebot umgesetzt und ist auf dem Spieleratgeber-NRW dokumentiert 8 8 Heinz, D. & Kohring, T.: »Quest in Mittelmülheim«, https://www.spieleratgeber-nrw.de/site.2617.de.1.html , Zugriff am 24.05.2020 9 Die Dokumentation des Forschungs- und Entwicklungsprojekts KuBiMedia wurde im Magazin für Kulturelle Bildung der BKJ »Kulturelle Medienbildung« veröffentlicht und steht zum Download zur Verfügung: https://www.bkj.de/publikation/kulturelle-medienbildung , Zugriff am 24.05.2020.
. Motivation für die Jugendlichen am Projekt teilzunehmen, war vielfach der Bezug zu Computerspielen, welche aber nur einen kleinen Raum am ersten Tag einnahmen. Durch die vielfältigen anderen kulturellen Aktivitäten im Verlauf der Woche geriet dieses Bedürfnis schnell in den Hintergrund. Einige waren sogar derart begeistert von den neu entdeckten Möglichkeiten, dass sie sich auch im Nachgang anderen kulturellen Beschäftigungen zuwandten: »Mama, zu Weihnachten wünsche ich mir eine Nähmaschine!« war die Ansprache an die Mutter, die ihren vierzehnjährigen Sohn abends aus dem Jugendzentrum abholte.
Читать дальше