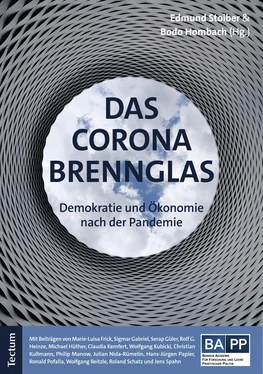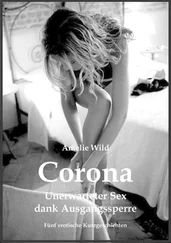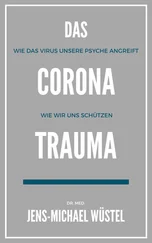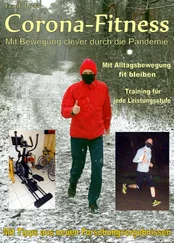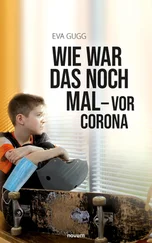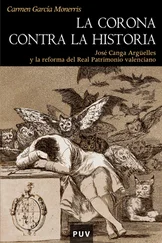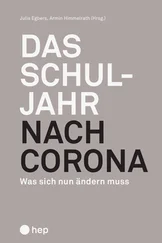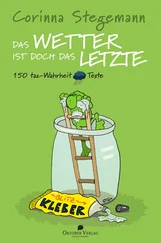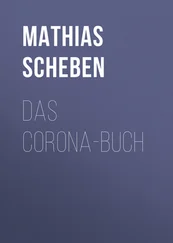Hombach: Eine Oper ist nicht deshalb schlecht, weil Rollen schlecht besetzt sind und die Regie dilettiert. Man darf durchaus über situative Stärken und Schwächen der Demokratie sinnieren. Beim demokratischen Wahlakt geht es doch nicht darum, den besten Experten oder den mit dem höchsten Bildungsstand zu erwählen. Auch der IQ ist selten Entscheidungskriterium. Es zählt anderes. Der Einser-Jurist Dr. Stoiber hat als Ziehvater Herr Dr. Strauß ausgewählt und sich entwickeln und in Etappen aufsteigen lassen. Aufstiege über breite Berufserfahrungen, Qualifikationsbelege und erfolgreiche Problembewältigung sind nicht typisch für gegenwärtige politische Karrieren. Deshalb muss in unserer Demokratie wissenschaftliche Politikberatung und eine bestens qualifizierte Administration der Legislative fachlich zur Seite stehen. Wenn es an Umsetzung mangelt, was man gegenwärtig viel zu oft diagnostizieren muss, ist das in erster Linie nicht, wie Medien gerne schreiben, politisches, sondern administratives Versagen. Es gehört zur Natur der Demokratie, sich immer wieder selbst zu befragen, ihre Schwächen zu erkennen und ihre nutzbare fachliche Infrastruktur hochkarätig zu organisieren und aufzustellen. Einige der erfolgreichen asiatischen Staaten sind auch Demokratien. Es geht bei einer Seuchenbekämpfung nicht ohne Einschränkung von Grundrechten. Die muss jedoch zeitlich begrenzt und angemessen sein. Totale Transparenz und Überwachung sind immer totalitär. Unsere eigentliche Misere ist für mich nicht die Schwerfälligkeit der Demokratie, sondern erschütterndes Versagen der Administration. Von der Corona-App bis zum Impfdebakel, vom Berliner Flughafen bis zur Kölner Oper, von der maroden Schultoilette bis zur Leverkusener Autobahnbrücke: Wir präsentieren der Welt eine peinliche Lachnummer nach der anderen. Da läuft was falsch. Beobachtbar ist die dramatische Diskrepanz zwischen fantastisch rasanter, wissenschaftlicher Erkenntnis und deren Umsetzung in die Praxis. Das ist wie Vollgas geben und mit dem anderen Bein auf der Bremse stehen. So läuft ein Motor heiß und fliegt einem irgendwann um die Ohren. Die Pandemie bringt es auf den Schmerzpunkt: Wir produzieren Ideen und Lösungen am Fließband, aber sie werden selten Realität. Im Pandemie-Wettlauf ähneln wir dem Hasen. Das Virus dem Igel. Wir rennen hinterher. Das Virus lacht sich schief. Asiatische Länder sind nicht erfolgreich, weil autokratisch, sondern weil geübter, rationaler, konsequenter.
Stoiber: In der ersten Welle hat sich gezeigt, wie gut die föderale Struktur funktionieren kann, etwa im Vergleich zum zentralistischen Frankreich. Wenn die Inzidenz in Schleswig-Holstein anders ist als in Bayern, sind zentralistische Maßnahmen falsch und die verfügbaren Instrumente zur Corona-Eindämmung müssen differenziert angewendet werden. Aber die Instrumente an sich sollten in Katastrophenfällen wie der Corona-Pandemie, die das ganze Bundesgebiet betreffen, einheitlich sein, das heißt: gleiche Regeln für gleiche Infektionslagen. Eine Inzidenz von 200 muss in einem Landkreis in Schleswig-Holstein die gleichen Konsequenzen haben wie eine Inzidenz von 200 in einem bayerischen Landkreis. Das dient auch der Akzeptanz durch die Bürger. Die Bundeskanzlerin hat Recht, wenn sie Sonderwege einzelner Länder bei identischer Infektionslage, etwa bei Sperrstundenregelungen, kritisiert und sagt, dass hier die Subsidiarität versagt habe. Auch in der Digitalisierung des Schul- oder Gesundheitswesens, etwa beim „Digitalpakt Schule“ oder der Entwicklung von Software für Gesundheitsämter, scheinen einheitliche Vorgaben sinnvoll. Deshalb muss man sicher aus den Erfahrungen der Extremsituation Pandemie über die Notwendigkeit einer erneuten Staatsinventur nachdenken, um die Entscheidungsabläufe zu optimieren. Der Vorschlag des Unionsfraktionsvorsitzenden im Bundestag Ralph Brinkhaus, die Effizienz unseres Staatswesens in seinen Abläufen auf den Prüfstand zu stellen, geht genau in diese Richtung.
Hombach: Für mich spricht nichts dafür, dass Zentralismus mal eine bessere Lösung war, besser ist oder eine bessere sein wird. Vernünftige Arbeitsteilung ist es. Der regionale Ansatz hat sich auch jetzt als angepasster, lebensnäher und damit wirksamer erwiesen. Es wäre erstaunlich, wenn ich mit Herrn Stoiber beim Respekt vor dem Föderalismus auseinander wäre. Föderalismus gehört gestärkt, nicht geschwächt. Aber ganz selbstverständlich müssen wir auch hier vor allem die umsetzungsfördernde Infrastruktur verbessern, digitaler werden und die Handlungsabläufe effizienter gestalten und abstimmen. Dass die Arbeitsteilung immer wieder auf dem Prüfstand stehen muss, ist ein Allgemeinplatz. Sie ist aber zu selten auf der Tagesordnung. Was sich zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten abgespielt hat und weiter abspielt, ist letztlich Surrogat für Debatten, mit der unsere Vertreter im Bundestag in der medialen Vermittlung nicht stattfinden.
Stoiber: Die Abstimmungen unter den Ländern waren mühsam, eine Beteiligung des Bundestages kaum erkennbar …
Hombach: … dafür agierte der Bundesrat ersatzweise, was wenigstens etwas demokratischen Disput und Konsenskultur erkennen ließ.
Stoiber: Ja, aber verstehen die Leute das? Bekomme ich so bei den Menschen Verständnis? Wir müssen über die Frage, ob die Kompetenzordnung, ob unsere Staatsordnung für einen Vorgang dieser Art gewappnet ist, ganz offen diskutieren. Da, wo die Debatte hingehört: im Bundestag. Ich sehe schon, dass die Pandemie hier schonungslos Schwächen im System aufgedeckt hat. Dazu gehört, dass der Bundestag, die erste Kammer dieses Landes, in der Pandemie als Ort der Debatte viel zu kurz kam.
Hombach: Ich sagte schon: Nicht nur konfrontiert mit dem Virus hat die Talkshow dem Bundestag die Show gestohlen. Der Bundesrat und die Länder haben eine Ersatzfunktion wahrgenommen. Die Positionen der Ministerpräsidenten waren realitätsbezogen und nachvollziehbar. Sie sind eben dichter am Volk. Sie sind nebenbei präsenter und bekannter geworden.
Stoiber: Aber das ist doch nicht der Sinn dahinter! Es geht doch nicht um Prominenz und Bekanntheit von Personen, sondern um die Sache.
Hombach: Genau in der Sache wurden unterschiedliche Konzepte erkennbar. Das war positiver Wettbewerb. Der hat angestachelt. Das erbärmliche hausgemachte Impfdebakel wurde ans Licht gebracht und ausgeleuchtet. Daraus wurden – verspätet – Konsequenzen gezogen. Auf der europäischen Ebene versuchte man, peinlich schönzureden. Das Kanzleramt hat sich zunächst bei Frau von der Leyen untergehakt und verbreitet, bei der Impfstoffbestellung sei alles gut und richtig gelaufen. Erst als die vor Ort aufsteigende Wut von den Ministerpräsidenten nach Berlin getragen wurde, wurde das Geschwurbel aus Brüssel als freche Propaganda entlarvt.
Stoiber: Bei so tiefgreifenden Eingriffen in die Grundrechte der Menschen kann kein Bundesrat und schon gar keine Talkshow das Parlament ersetzen. Es reicht nicht, immer nur zu sagen: „Versteckt euch, fürchtet euch, redet mit niemandem!“, wie es der Soziologie Richard Sennett ausgedrückt hat. Das ist zwar epidemiologisch richtig, hat aber gesellschaftspolitisch verheerende Folgen. Das haben viele Leute vermisst: dass im Parlament die Debatte über Lösung A, B oder C stattfindet.
Wir leben in einem doppelten Föderalismus, einem deutschen und einem europäischen. Ist das Fluch oder Segen in dieser Situation?
Hombach: Der Föderalismus ist leistungsfähig und gut, wo er sinnvoll ist. Das ist er nicht beim Einhegen globaler Gefahren. Das von mir verehrte und geliebte Europa ist stark als das größte gemeinsame Vielfache. Es ist schwach als der kleinste gemeinsame Nenner. Die Weisheit eines Systems ist nicht immer auch seine Klugheit. Ich bin für Reformen, wenn sie nicht Vorteile beseitigen, sondern Stärken fördern. Und die Unterscheidung zwischen beidem erleichtern. Die real existierende Europäische Union ist leider nicht dazu angetan, die Stärken zu fördern, sondern eher auf niedrigem Niveau zu nivellieren. Gerade wer Europa liebt, darf die Reformen, vor allem die der Administration, nicht länger verschieben.
Читать дальше