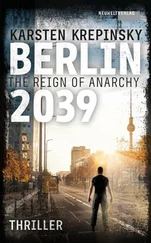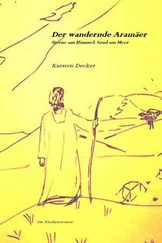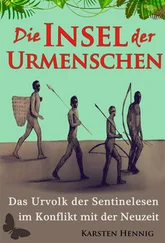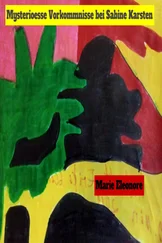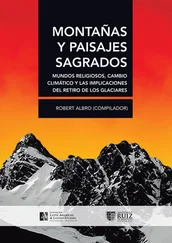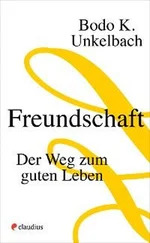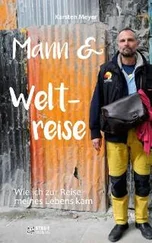Beispiele: Öffentlicher Vertrauensverlust nach Untreueverdacht gegen einen Topmanager, Diebstahl oder Verlust von sensiblen Kundendaten, bewusste Verletzung oder Umgehung von Umweltauflagen, zahlreiche (berechtigte) Kundenbeschwerden auf diversen Kanälen mit entsprechender medialer Berichterstattung, Guerilla-PR-Aktion einer NGO mit großer Medienresonanz .
Interne versus externe Krise
Krisen sind gefährlich – für den Geschäftsfortgang wie auch für das öffentliche Ansehen. Dennoch macht es einen gravierenden Unterschied, ob einen die Krise „von außen“ trifft (etwa durch einen terroristischen Anschlag auf ein Firmengebäude) oder ob das Problem hausintern ist (beispielsweise das Fehlverhalten eines leitenden Angestellten). Daher unterscheidet man grob in interne und externe Krisen.
Eine interne Krise hat ihren Ausgang in der Mitte des Unternehmens. Sie wird also durch Handlungen oder Ereignisse ausgelöst, die das Unternehmen selbst (mit) zu verantworten hat. Interne Krisen können beispielsweise ausgelöst werden durch:
 Gravierende Produktfehler (mit Gefährdungspotenzial für viele Menschen)
Gravierende Produktfehler (mit Gefährdungspotenzial für viele Menschen)
 Persönliches Fehlverhalten von Management oder Mitarbeitern (Untreue, Steuerhinterziehung, sexuelle Belästigung)
Persönliches Fehlverhalten von Management oder Mitarbeitern (Untreue, Steuerhinterziehung, sexuelle Belästigung)
 Verlust oder Diebstahl sensibler (Kunden-)Daten
Verlust oder Diebstahl sensibler (Kunden-)Daten
 Betriebsunfälle, etwa durch fehlende Sicherheitsvorkehrungen
Betriebsunfälle, etwa durch fehlende Sicherheitsvorkehrungen
 (Massen-)Entlassungen, Stilllegung von Produktionsstandorten
(Massen-)Entlassungen, Stilllegung von Produktionsstandorten
Interne Krisen stellen eine gravierende Gefahr für die Reputation und damit für das Geschäft dar. In diesem Fall ist es entscheidend, wie schnell das Unternehmen oder die Organisation selbst zur Aufklärung und zum Abstellen der Missstände (etwa bei fehlenden oder missachteten Sicherheitsvorkehrungen) beiträgt und das auch öffentlich glaubhaft machen kann. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, neue Kontrollmechanismen zu etablieren und dafür ad hoc renommierte externe Experten zu gewinnen (beispielsweise ein neues Vorstandsmitglied für Compliance oder einen Datenschutzbeauftragten).
Eine externe Krise ist ein Krisenfall, der durch externe Faktoren ausgelöst wird. Dies können beispielsweise sein:
 Branchenweiter Streik
Branchenweiter Streik
 Kampagnen bis hin zum Rufmord
Kampagnen bis hin zum Rufmord
 Naturkatastrophen
Naturkatastrophen
 (Produkt-)Erpressung
(Produkt-)Erpressung
 Erpresserischer Hackerangriff mit Lahmlegen der IT-Infrastruktur des Unternehmens
Erpresserischer Hackerangriff mit Lahmlegen der IT-Infrastruktur des Unternehmens
 Terroristischer Anschlag
Terroristischer Anschlag
 Fehlverhalten anderer Unternehmen der Branche mit negativen Folgen für das eigene Image
Fehlverhalten anderer Unternehmen der Branche mit negativen Folgen für das eigene Image
Im Gegensatz zur internen Krise hat die externe Krise den – relativen – kommunikativen Vorteil, dass das negative Ereignis von außen auf das Unternehmen oder die Organisation einwirkt, also nicht hausgemacht ist. Entscheidend ist hier jedoch das weitere Krisen-Handling, um im öffentlichen Bewusstsein stets Herr der Lage zu bleiben. Eine Opferrolle mit ihrem Mitleids- und Sympathiefaktor hält nicht lange vor. Schon bald werden kritische Fragen gestellt werden, wie gut man auf diese externen Bedrohungen vorbereitet war und wie man weiteren Schaden abwenden kann oder inwieweit man glaubhaft das Fehlverhalten anderer Unternehmen der Branche bei sich ausschließen kann („Unsere zertifizierten internen Kontrollmechanismen stellen sicher, dass so etwas bei uns nicht passiert. Das überprüfen wir auch permanent.“).
| Eine Krise ist ein verschärfter Notfall und stellt eine potenzielle Bedrohung für das Kerngeschäft dar. Die Kommunikationskrise ist ein Sonderfall der Krise, bei dem vor allem ein Imageschaden droht . |
 |
1.2Skandalfaktoren als Krisen- Treiber
„Sex sells“, lautet eine bekannte Weisheit von Boulevardjournalisten. Und ebenso: „Bad news are good news“, also: „Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“ – weil sie öffentliche Aufmerksamkeit erregen und damit die Verbreitung erhöhen. Ähnlich ist es mit den Skandalfaktoren in der Krisenkommunikation: Sie bestimmen maßgeblich mit, wie groß die emotionale Empörung werden kann. Je mehr von ihnen zusammenkommen und je stärker sie ausgeprägt sind, desto interessanter wird der Fall für die Medien und desto größer ist die Gefahr eines öffentlichen Skandals.
Das Vorhandensein von – internen wie externen – Skandalfaktoren ermöglicht eine gute Einschätzung, wie hoch das Risiko einer medialen Skandalisierung ist. Entscheidend ist dabei stets die Außensicht unter der Fragestellung: „Welches schuldhafte Versagen werden uns die Medien und/oder die Kunden unterstellen?“ Gelungene Krisenkommunikation nimmt auf die Skandalfaktoren Bezug und entkräftet sie. Hier eine Liste mit Beispielen von Skandalfaktoren:
 Vermeidbarkeit (Hätte der Vorfall vermieden werden können?)
Vermeidbarkeit (Hätte der Vorfall vermieden werden können?)
 Schuld (Gibt es ein schuldhaftes Verhalten in der Organisation?)
Schuld (Gibt es ein schuldhaftes Verhalten in der Organisation?)
 Motivlage und Eigennutz (Wurde aus niederen Motiven gehandelt? Wurden bewusst eigene Interessen über diejenigen Dritter gestellt?)
Motivlage und Eigennutz (Wurde aus niederen Motiven gehandelt? Wurden bewusst eigene Interessen über diejenigen Dritter gestellt?)
 Handlungsalternativen (Hätte auch anders entschieden werden können?)
Handlungsalternativen (Hätte auch anders entschieden werden können?)
 Vertuschung (Wurde aktiv versucht, einen bestehenden Missstand zu leugnen oder zu vertuschen?)
Vertuschung (Wurde aktiv versucht, einen bestehenden Missstand zu leugnen oder zu vertuschen?)
 Auswirkungen (Welche – möglicherweise gravierenden – Folgen sind zu erwarten?)
Auswirkungen (Welche – möglicherweise gravierenden – Folgen sind zu erwarten?)
Читать дальше
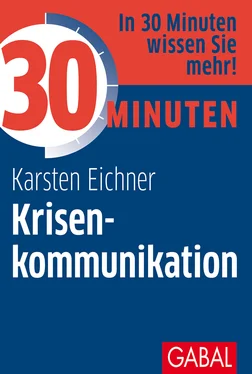
 Gravierende Produktfehler (mit Gefährdungspotenzial für viele Menschen)
Gravierende Produktfehler (mit Gefährdungspotenzial für viele Menschen)