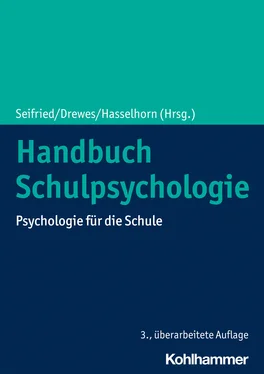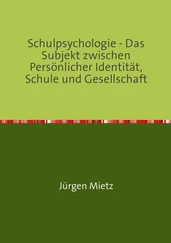Weiterhin ist das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG zu beachten, mit der Folge, dass grundsätzlich Erziehungsmaßnahmen der Eltern zu respektieren sind. Das führt dann zu einer Konfliktsituation, wenn Minderjährige eine schulpsychologische Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, die Zustimmung der Eltern aber fehlt oder (noch) unbekannt ist und Minderjährige die Einbeziehung der Eltern verweigern. Hier liegt eine verfassungsrechtliche Interessenkollision vor, die im Sinne »praktischer Konkordanz« zum Ausgleich gebracht werden muss. Dieser Ausgleich geschieht manchmal schon in der Aufgabenbeschreibung psychologischer Dienste, in dem dort die Zustimmung der Eltern ausdrücklich vorgesehen ist: Dann ist abstrakt bereits entschieden, dass das Selbstbestimmungsrecht des Minderjährigen zurückzustehen hat. Fehlt eine Regelung, ist zwischen dem Elternrecht und dem Selbstbestimmungsrecht abzuwägen. Dabei kommt es auf die Einsichts- und Urteilsfähigkeit der minderjährigen Person an, auf die Schwere und Reichweite der Angelegenheit und auf die Eingriffstiefe in das Elternrecht, wobei prinzipiell dessen Gewicht mit zunehmendem Alter der minderjährigen Person abnimmt. Geht aus der Abwägung das Selbstbestimmungsrecht der minderjährigen Person als überwiegend hervor, haben ggf. die Eltern den mittelbaren Eingriff in ihre Privatsphäre hinzunehmen, wenn die Schulpsychologin bzw. der Schulpsychologe Familieninterna erfährt.
Das Aufgabenspektrum in der Schulpsychologie hat sich allerdings häufig erweitert. Neben konzeptioneller Arbeit, Vorträgen usw., bei denen nebensächlich ist, ob sie nur angeboten werden, weil mit ihnen typischerweise keine Grundrechtseingriffe einhergehen, seien die Gefahreneinschätzungen in Notlagen erwähnt. Diese Aufgaben der Gefahreneinschätzung verlassen häufig zwangsläufig den Angebotscharakter. In solchen Notfallsituationen erfolgt ggf. ein Eingriff ohne die z. B. ansonsten erforderliche Einwilligung der Eltern. Deshalb ist gerade dafür eine eher ausführliche und verbindliche Aufgabenbeschreibung sinnvoll bzw. nötig, die sich möglichst nachvollziehbar auf eine gesetzliche Ermächtigung zurückführen lässt.
Aber auch außerhalb von Notfällen kann sich die Rechtfertigung eines Eingriffs ergeben, ohne dass es zwingend einer Einwilligung bedarf: Wenn z. B. eine Schule oder Lehrende eine Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen in die eigene Maßnahme einer erzieherischen Einwirkung einbindet, kann deren Handeln und Einwirken z. B. auf den Klassenverband auch ohne Einwilligung der Eltern gerechtfertigt sein, weil es der Gewährleistung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit oder dem Schutz der Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrenden oder anderer beteiligter Personen oder Sachen in verhältnismäßiger Weise dient.
Zwar gibt es inzwischen auch in schulpsychologischen Beratungsstellen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die approbiert sind. Das ändert jedoch nichts daran, dass Psychotherapie grundsätzlich keine schulpsychologische Aufgabe ist, weshalb die Landespsychotherapeutenkammern auch dann nicht für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zuständig sind, wenn diese approbiert sind.
Es geht bei schulpsychologischen Dienstleistungen um das informationelle Selbstbestimmungsrecht, wenn Daten bzw. Geheimnisse Betroffener an Dritte weitergegeben werden, seien es Eltern, Lehrende, die Schule oder das Jugendamt. Solche Weitergaben sind (erneute) Grundrechtseingriffe. Vor diesem Grundrechtseingriff sind die Betroffenen grundsätzlich geschützt durch das Datenschutzrecht, bei Schulpsychologinnen und Schulpsychologen aber insbesondere durch die sogar strafbewehrte Schweigepflicht gem. § 203 Strafgesetzbuch (StGB); entweder die betroffene Person willigt ein oder es liegt eine Befugnis oder Pflicht zur Weitergabe vor.
7.2 Schweigepflicht und Datenschutz
7.2.1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Datenschutz und berufliche Schweigepflicht ziehen am selben Strang, sind aber trotz Überscheidungen in ihren Schutzbereichen durchaus nicht identisch. § 1 Abs. 2 Satz 3 BDSG legt fest, dass die Schweigepflicht gem. § 203 StGB dem Datenschutzrecht vorgeht, und es ist anzunehmen, dass dies als allgemeiner Grundsatz auch in der Anwendung der Landesdatenschutzgesetze gilt. Das gilt jedoch nur in Verbotsrichtung: Scheint eine Datenübermittlung nach Datenschutzrecht erlaubt zu sein, so entfällt deswegen nicht die Strafbarkeit wegen Schweigepflichtsverletzung, d. h. die Geheimnisoffenbarung bleibt trotz (vermeintlicher) datenschutzrechtlicher Übermittlungsbefugnis unter Strafandrohung verboten. Umgekehrt kann eine Geheimnisoffenbarung zwar straflos sein, lässt aber ggf. nicht eine datenschutzrechtliche Unzulässigkeit entfallen. Es gilt also der jeweils engere Maßstab. Es sind stets Schweigepflicht und Datenschutz für sich zu prüfen. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass der Datenschutz zwar auch jede mitarbeitende Person betrifft, in der behördeninternen Kommunikation aber eher transparent ist, während Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Schweigepflichtsverletzung in persona kraft Berufszugehörigkeit unmittelbar Strafe droht. Folglich hat diese Berufsgruppe insbesondere die Schweigepflicht gem. § 203 StGB im Blick.
7.2.2 Datenschutzrechtliche Anforderungen an die Schulpsychologie
Für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gelten grundsätzlich die Bestimmungen aus den Landesdatenschutzgesetzen. Sofern handschriftliche Aufzeichnungen gemacht werden, gelten auch für diese die Landesdatenschutzgesetze. Dabei ergeben sich jedoch in Hinblick auf die Schulpsychologie keine spezifischen Anforderungen. D. h. es ergeben sich datenschutzrechtlich kaum abweichende Anforderungen wie für alle anderen in öffentlichen (Schul-)Einrichtungen Tätigen. Vielmehr ist es die berufsbezogene Schweigepflicht, aus der sich ein im Vergleich zu Tätigen in anderen öffentlichen Einrichtungen strengerer Maßstab insbesondere in Bezug auf Zugriffsmöglichkeiten Dritter auf den Computer bzw. auf gespeicherte Daten ergibt.
7.2.3 Schweigepflicht
Begriff und Rechtsquellen
Die Pflicht der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Inhalte der Dienstleistung vertraulich zu behandeln, ergibt sich gleich aus mehreren Quellen. Die schärfste Regelung ist das Strafrecht, und deswegen steht der Geheimnisschutz gem. § 203 StGB auch stets im Fokus. Freilich gilt die Strafvorschrift auch für das Amtsgeheimnis, so dass diese Berufsgruppe gleich zweifach von Strafe bedroht ist. Allerdings ist im Alltag folgender Unterschied gravierend: Das Berufsgeheimnis gilt grundsätzlich auch innerbehördlich, das Amtsgeheimnis nicht. Die Vertraulichkeit ergibt sich aber auch standardmäßig aus dem öffentlich-rechtlichen Verhältnis zu den Inanspruchnehmenden, und teilweise ist das in den Schulgesetzen der Länder auch nochmals ausdrücklich geregelt. Sie ergibt sich nachrangig bei berufsverbandlich organisierten Berufsangehörigen ggf. auch aus Ethischen Richtlinien des Verbandes, denn dies ist eine vertragliche Bindung.
Tatbestandsmerkmale des § 203 StGB
Als Psychologe erfahrene Geheimnisse
»Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist.« (§ 203 StGB) Geschützt werden mit der Vorschrift nicht die Berufsangehörigen in ihrer Berufsausübung oder die Amtstragenden mit ihrer Amtswaltung, sondern das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Inanspruchnehmenden.
Читать дальше