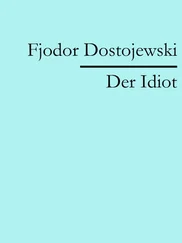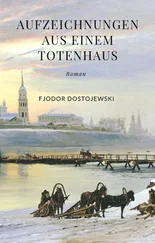»Sie sagen immer ›Geheimnis‹; was heißt das: sein Geheimnis erfüllt haben?« fragte ich und sah mich nach der Tür um. Ich freute mich, daß wir allein waren, und daß ringsum unverbrüchliche Stille herrschte. Die untergehende Sonne schien grell ins Zimmer. Er sprach ein wenig schwülstig und unklar, aber sehr überzeugt und in einer starken Erregung, als freue er sich in der Tat sehr über mein Kommen. Aber ich bemerkte wohl, daß er zweifellos fieberte, und zwar recht stark. Ich war gleichfalls krank und fieberte seit dem Augenblick, da ich zu ihm gekommen war.
»Was das Geheimnis ist? Alles ist ein Geheimnis, lieber Freund, in allem ist das göttliche Geheimnis. In jedem Baume, in jedem Kraute ist dieses selbe Geheimnis beschlossen. Ob nun ein kleines Vöglein singt, ob die ganze Schar der Sterne in der Nacht am Himmel glänzt – das alles ist dieses Geheimnis, gleicherweise. Und das größte Geheimnis liegt in dem, was die Seele des Menschen in jener Welt erwartet. So ist es, lieber Freund!«
»Ich weiß nicht, in welchem Sinne Sie . . . Ich sage das natürlich nicht, um mich über Sie lustig zu machen, und Sie können mir glauben: ich glaube an Gott; aber alle diese Geheimnisse hat der Verstand schon lange durchschaut, und was er noch nicht entdeckt hat, das wird alles entdeckt werden, ganz sicher, und vielleicht in kürzester Frist. Die Botanik weiß ganz genau, wie der Baum wächst, der Physiolog und der Anatom wissen sogar, warum der Vogel singt, oder werden es bald wissen; und was die Sterne betrifft, so sind sie nicht nur alle gezählt, sondern jede ihrer Bewegungen ist genau auf die Minute ausgerechnet, so daß man sogar auf tausend Jahre hinaus voraussagen kann, genau auf die Minute, wann irgendein Komet erscheinen wird . . . Und heutzutage ist auch schon die Zusammensetzung der entferntesten Sterne bekannt. Nehmen Sie ein Mikroskop – das ist ein Vergrößerungsglas, das die Dinge millionenfach vergrößert, und schauen Sie sich einen Wassertropfen dadurch an: Sie werden dort eine ganze neue Welt erblicken, eine ganze Welt von lebenden Wesen; und sehn Sie, auch das war ein Geheimnis, aber man hat es doch entdeckt.«
»Ich habe wohl davon gehört, mein Lieber, mehr als einmal haben mir die Leute davon erzählt. Da ist nichts zu sagen, das ist ein großes und rühmliches Werk; alles ist dem Menschen gegeben nach Gottes Willen; nicht umsonst hat Gott ihm seinen lebendigen Odem eingeblasen: ›Lebe und erkenne‹.«
»Nun, das sind Gemeinplätze. Sie sind also kein Feind der Wissenschaft, kein Klerikaler? Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen . . .«
»Nein, lieber Freund, ich habe von Jugend auf Achtung vor der Wissenschaft gehabt, und wenn ich selbst nicht gescheit darin bin, so murre ich doch nicht darüber: ist sie mir nicht zuteil geworden; so ist sie andern zuteil geworden. Es ist vielleicht auch besser so, weil so jeder sein Teil hat. Weil auch nicht jedem die Wissenschaft zum Nutzen dienen würde, lieber Freund. Gar mancher kann sich keine Grenze ziehen, gar mancher möchte die ganze Welt in Erstaunen setzen, und ich würde das vielleicht mehr als irgendein andrer wollen, wenn ich gelehrt wäre. Aber wo ich jetzt ganz und gar nicht gelehrt bin, wie kann ich mich da überheben, wo ich doch selber ganz und gar nichts weiß? Du aber bist jung und hast scharfe Augen, und dir ist das als Gebiet gegeben, lerne du nur. Suche alles zu erkennen: wenn dir dann ein Gottloser oder ein Frecher begegnet, so kannst du ihm antworten, und er kann dich mit seinen hitzigen Redensarten nicht irreführen und deine unreifen Gedanken nicht verwirren. – Und so ein Glas, wie du sagst, hab' ich selbst gesehen, es ist noch nicht so lange her.«
Er holte Atem und seufzte. Ich hatte ihm durch mein Kommen entschieden große Freude gemacht. Sein Durst, sich mitzuteilen, war fast krankhaft. Außerdem täusche ich mich ganz bestimmt nicht, wenn ich behaupte, daß er mich zuweilen mit ganz besondrer Liebe ansah: er legte seine Hand liebkosend auf die meine und streichelte mir die Schulter . . . allerdings manchmal, muß ich gestehen, vergaß er mich dann wieder ganz, es war, als säße er ganz allein; und wenn er auch eifrig weitersprach, so sprach er doch gleichsam in die leere Luft.
»Lieber Freund,« fuhr er fort, »es lebt da im Gennadios-Kloster ein sehr gescheiter Mann. Er ist aus vornehmer Familie, nach seinem Range Oberstleutnant und sehr reich. Als er noch in der Welt lebte, wollte er sich nicht durch eine Heirat binden; jetzt ist es schon das zehnte Jahr, daß er sich von der Welt abgeschlossen hat, er liebt die stillen, schweigsamen Zufluchtstätten, und sein Gefühl hat das weltliche Sorgen und Eifern abgetan. Er hält alle Klosterregeln ein, aber Mönch werden will er nicht. Und Bücher, lieber Freund, hat er soviel, wie ich noch bei keinem Menschen gesehen habe, – er selbst hat mir gesagt, sie haben ihn achttausend Rubel gekostet. Er heißt Piotr Valerianytsch. Er hat mich zu verschiedner Zeit viel gelehrt, und ich hab' ihm immer furchtbar gern zugehört. Also frage ich ihn einmal: ›Wie kommt es, Herr, daß Sie bei Ihrem großen Verstand, und wo Sie schon zehn Jahre im Mönchsdienst leben und in der vollkommenen Abtötung Ihres Willens – wie kommt es, daß Sie nicht das löbliche Ordensgelübde ablegen, um dadurch noch vollkommener zu werden?‹ Und er gibt mir zur Antwort: ›Was redest du da von meinem Verstande, Alter; vielleicht hat mich mein Verstand zu seinem Gefangnen gemacht, und nicht ich habe ihm seine Grenzen gesetzt. Und was redest du von meinem Mönchsdienst: vielleicht habe ich längst das eigne Maß für mich verloren. Und was redest du von der Abtötung meines Willens? Meinem Gelde würde ich sofort entsagen, Rang und Stand würde ich hergeben, und alle meine Orden würde ich auf den Tisch legen, aber meiner Pfeife Tabak kann ich nicht entsagen, und kämpfe doch schon zehn Jahre darum. Was wäre ich also für ein Mönch, und was für eine Willensabtötung rühmst du an mir?‹ – Ich wunderte mich damals über diese Demut. Na, und also im vorigen Sommer, um die Zeit der Peter- und Paulsfasten, komme ich wieder in dieses Kloster – Gott hatte mich hingeführt – und da sehe ich, in seinem Zimmer steht eben so ein Ding – ein Mikroskop – das hatte er sich um viel Geld aus dem Ausland kommen lassen. ›Wart', Alter‹, sagt er zu mir, ›ich zeig' dir etwas ganz Erstaunliches, weil du so etwas noch nie gesehen hast. Sieh diesen Wassertropfen, er ist rein wie eine Träne: na, also, schau dir an, was darin ist, und du wirst sehen, daß die Mechaniker bald alle Geheimnisse Gottes durchforscht haben werden, nicht ein einziges werden sie für dich und mich übriglassen.‹ Mit den Worten sagte er das, ich hab' es genau behalten. Aber ich hatte in so ein Mikroskop schon fünfunddreißig Jahre vorher hineingeschaut, bei Alexander Wladimirowitsch Malgasow, unserm Herrn, Andrej Petrowitschs Onkel von Mutters Seiten, von dem Andrej Petrowitsch dann nachher, nach seinem Tode, das Stammgut geerbt hat. Er war ein großmächtiger Herr, ein hoher General, und hielt sich eine große Hundemeute, und ich war damals lange Zeit Jäger bei ihm. Na, und damals stellte er auch so ein Mikroskop auf, das er mitgebracht hatte, und befahl dem ganzen Gesinde, Männern und Weibern, sie sollten eins nach dem andern herkommen und hineinschauen, und da wurde denn auch allerhand gezeigt: ein Floh und eine Laus, eine Nadelspitze, ein Haar, ein Tropfen Wasser. Und das war ein Spaß: die Leute fürchteten sich, hinzugehen, und vor dem Herrn fürchteten sie sich auch – er konnte sehr böse werden. Manche konnten überhaupt gar nicht hineinschauen, sie kniffen die Augen zu und sahen gar nichts; andre grausten sich und schrien, und Sawin Makarow, der Starost, hielt sich die Augen mit beiden Händen zu und schrie: ›Macht mit mir, was ihr wollt, – ich geh' nicht hin!‹ Törichtes Gelächter gab's da genug. Piotr Valerianytsch sagte ich aber nichts davon, daß ich schon früher, vor fünfunddreißig Jahren, das gleiche Wunder gesehen hatte, weil ich sah, er hatte große Freude daran, es mir zu zeigen; darum tat ich so, als ob ich mich schrecklich wunderte und entsetzte. Er ließ mir Zeit zur Überlegung und fragte dann: ›Na, Alter, was sagst du jetzt?‹ Ich aber verneigte mich und sagte zu ihm: ›Gott sprach: es werde Licht, und es ward Licht‹, und er fragte auf einmal hastig zurück: ›Ward nicht am Ende Finsternis?‹ Und das sagte er so sonderbar, und lachte nicht einmal dazu. Da wunderte ich mich über ihn, und er war förmlich böse geworden und sagte nichts mehr.«
Читать дальше