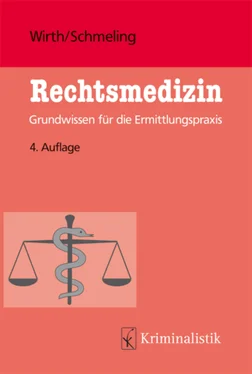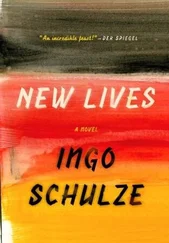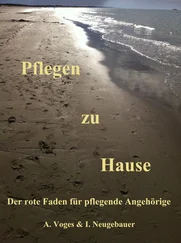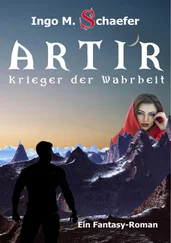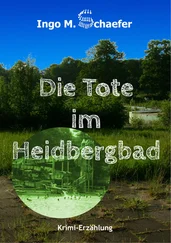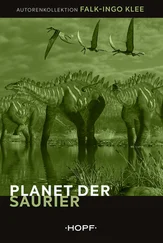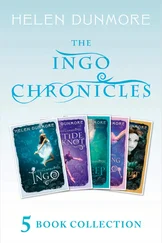Bis zu 6 Stunden post mortem reagiert nicht mehr der gesamte Muskel auf eine mechanische Reizung, sondern ein Schlag löst nur noch eine lokale Reaktion in Form einer fingerstarken, sog. idiomuskulären Wulstbildung aus. Bevorzugt wird der Bizepsmuskel geprüft.
Die supravitale, elektrische Reizung der Skelettmuskulatur erfordert spezielle Geräte, von denen einige Modelle käuflich zu erwerben sind. Die Elektroden werden vorwiegend neben den äußeren Augenwinkeln oder neben den Mundwinkeln eingestochen. Die Reizung mit Gleichstrom (galvanisch) führt bis zu 4 Stunden post mortem und die mit gepulstem Gleichstrom (faradisch) bis zu 6 Stunden post mortem zu einem Zusammenziehen der Augenlider oder des Mundes.
Aufgrund des verhältnismäßig kurzen Zeitraums, in dem mechanische und elektrische Erregbarkeit der Muskulatur erhalten bleiben, hat der Rechtsmediziner nur selten Gelegenheit, diese supravitalen Reaktionen bei der Todeszeitschätzung zu berücksichtigen. Selbst wenn ein gerade Verstorbener aufgefunden und der Rechtsmediziner umgehend angefordert wird, können die Benachrichtigung, der nicht selten lange Anfahrtsweg und der Arbeitsablauf am Tatort seinen frühzeitigen Einsatz verzögern.
Über einen längeren Zeitraum als am Muskel sind die supravitalen Pupillenreaktionen nachweisbar. Dabei wird geprüft, ob durch Einspritzen von Pharmaka in das Auge eine Erweiterung oder eine Verengung der Pupillen bewirkt werden kann (bis zu 15 Stunden post mortem). Eine sog. Doppelreaktion, bei der zuerst ein erweiterndes, danach ein verengendes Mittel in das Auge injiziert wird, lässt sich bis zu 12 Stunden post mortem beobachten.
Weitere supravitale Erscheinungen, wie Reaktionen der Schweißdrüsen und der Haarbalgmuskeln auf chemische Mittel, haben sich in der Praxis nicht durchsetzen können.
Die Ausbildung der Totenflecke als frühe Leichenveränderung wird beeinflusst durch die Dauer der Agonie, die Todesursache und die Füllung des Blutgefäßsystems (Blutarmut, Blutverlust). Dementsprechend differieren die Angaben über die zeitliche Abfolge in der Fachliteratur recht deutlich. Dennoch sind gewisse Rückschlüsse für die Todeszeitschätzung ableitbar ( Tabelle 2).
Die Totenstarre wird in mehreren Gelenken geprüft, beginnend an Kiefergelenken und Hals, danach an oberen und unteren Gliedmaßen. Sind die Gelenke frei beweglich, kann das bedeuten, dass die Totenstarre noch nicht ausgebildet oder bereits gelöst ist oder manuell gebrochen wurde. Berücksichtigt man die übrigen Leichenerscheinungen, dürfte eine Interpretation möglich sein. Trotz einer großen Schwankungsbreite der zeitlichen Abfolge von Eintreten und Dauer der Totenstarre sind die Angaben bei kritischer Wertung zur Todeszeitschätzung nutzbar ( Tabelle 2).
Bei offensichtlich strafrechtsrelevanten Todesfällen empfiehlt es sich für den Leichenschauarzt, lediglich den Eintritt der Totenstarre festzustellen, ohne die Beweglichkeit der Gelenke mit grober Kraft zu prüfen. Alle weiteren Handgriffe sollte der Rechtsmediziner vornehmen.
Tab. 2: Schätzung der Todeszeit in der frühen Postmortalphase (nach Reinhardt und Mattern , 1999) [2]
| Totenflecke |
|
|
|
| Beginn |
nach |
20 – 30 |
Minuten |
| Konfluieren |
nach |
2 – |
Stunden |
| Umlagerbarkeit |
|
6 – 1 |
Stunden |
| Wegdrückbarkeit |
bis |
36 |
Stunden |
| Erkalten |
|
|
| Abnahme der Rektaltemperatur um etwa 1°Cpro Stunde bei Zimmertemperaturen |
|
| Totenstarre |
|
|
| Beginn |
nach |
2 – 4 |
Stunden |
| Vollständige Ausbildung |
nach |
6 – 8 |
Stunden |
|
|
(6 – 12 |
Stunden) |
| Wiederauftreten nach gewaltsamer Lösung |
bis |
8 |
Stunden |
| Spontane Lösung |
nach |
2 – 3 |
Tagen |
Für die frühe Postmortalphase, also die ersten Stunden nach Eintritt des Todes, ist die Temperaturmessung zur Feststellung der Leichenabkühlung die wichtigste Methode der Todeszeitschätzung. Um aus dem Absinken der Körpertemperatur verwertbare Rückschlüsse auf die Todeszeit ziehen zu können, werden folgende Daten gebraucht:
| • |
Körpertemperatur, |
| • |
Umgebungstemperatur, |
| • |
Körpergewicht, |
| • |
Auffindungsumstände. |
Zur Feststellung der Körpertemperatur wird ein besonderes Thermometer benötigt, ein Fieberthermometer ist ungeeignet. Es lassen sich sowohl Glas- als auch elektronische Thermometer verwenden, die einen besonders langen Messansatz, eine Ablesegenauigkeit von 0,1 °C, einen Messbereich von 0 °C bis 45 °C aufweisen und geeicht sind. Das Thermometer ist mindestens 8–10 cm tief in den Mastdarm (Rektum) einzuführen und darf zum Ablesen nicht entfernt werden. Ein weiterer üblicher Messort ist der Bereich der Darmgekrösewurzel. Hierzu wird in der linken Unterbauchregion ein kleiner Schnitt angelegt und das Thermometer bzw. der Messfühler durch die Bauchdecke eingeführt. Da es sich um einen Eingriff in die Integrität des Körpers handelt, bleibt dieses Verfahren dem Arzt vorbehalten.
Auf die Abkühlung der Leiche hat die Umgebungstemperatur einen entscheidenden Einfluss. Um einen verlässlichen Messwert zu erhalten, muss die Temperatur so bald wie möglich in unmittelbarer Nähe des Körpers gemessen werden. Besonderheiten der Aufliegefläche müssen protokolliert werden (z. B. Fußbodenheizung, Isoliermatte, Betonfußboden). Eine rasche Temperaturfeststellung ist notwendig, um den Einfluss von Veränderungen am Leichenfundort auszuschließen. Auswirken können sich das Öffnen oder Schließen von Türen und Fenstern, das Betätigen der Heizung und nicht zuletzt die Anwesenheit mehrerer Personen. War die Umgebungstemperatur zwischen Todeseintritt und Zeitpunkt der Untersuchung nicht konstant, so ist von einem Mittelwert oder einem Umgebungstemperaturbereich auszugehen.
Das Körpergewicht darf nicht geschätzt, sondern muss exakt bestimmt werden. Im Regelfall erfolgt das Wiegen des unbekleideten Körpers vor der Leichenöffnung.
Schließlich müssen je nach Sachlage verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, die Einfluss auf den Abkühlungsverlauf ausüben (z. B. Temperaturschwankungen während des Tages, Körperhaltung, Bekleidung und Bedeckung). Deshalb sind die Auffindungsumstände sorgfältig zu erfassen. Bei Leichenfunden im Freien können Informationen vom zuständigen Wetterdienst eingeholt werden.
Für die Todeszeitberechnung aus Mastdarm- und Umgebungstemperatur gibt es mathematische Formeln, Nomogramme und Computerprogramme. Davon hat sich für praktische Belange das Temperatur-Todeszeit-Bezugsnomogramm von Henßge durchgesetzt. Verwendet werden Nomogramme für Umgebungstemperaturen von 23,2 °C und darunter (Abbildung 4a) sowie für Umgebungstemperaturen von 23,3 °C und darüber (Abbildung 4b). Die Methode erlaubt bis etwa zur 30.–40. Stunde post mortem eine gute Abschätzung der Todeszeit.
Bei Verwendung des Nomogramms werden als Erstes die Rektaltemperatur der Leiche und die Umgebungstemperatur auf der entsprechenden Skala markiert und beide Punkte durch eine Gerade verbunden. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit der Diagonalen des Nomogramms und der Mittelpunkt des Fadenkreuzes bilden die Bezugspunkte für eine zweite Gerade, die bis zum Kreisbogen des betreffenden Körpergewichts eingezeichnet werden muss. Am Schnittpunkt der zweiten Geraden mit der Körpergewichtskurve ist die Todeszeit in Stunden ablesbar. Auf dem äußersten Kreisbogen befindet sich der zugehörige 95 %-Toleranzbereich, der durch den Schnittpunkt der zweiten Geraden mit der äußersten Kurvenlinie angezeigt wird.
Читать дальше