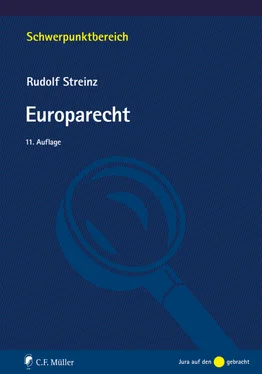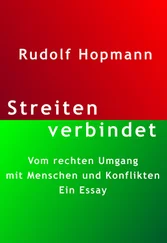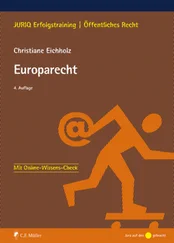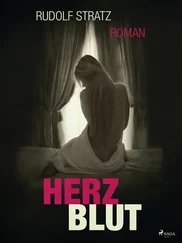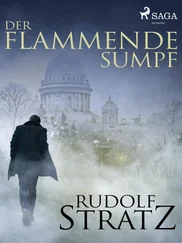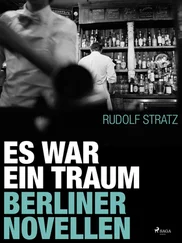25
Die Zusammensetzung des Ratesaus Staatenvertretern brachte eine gewisse Schwerfälligkeit des Entscheidungsverfahrens mit sich, weil diese im Gegensatz zur Kommission nicht nur dem Unionsrecht, sondern auch dem nationalen Recht verpflichtet sind und auch nationale Interessen vertreten dürfen, solange sie ihrer Verpflichtung aus Art. 4 Abs. 3 EUV ( Art. 10 EGV ) nachkommen, das Unionsinteresse zu wahren und zu fördern (s. Rn 386). Zwar sah bereits der EWGV von 1957 mit Ablauf der einzelnen Stufen der Übergangszeit Mehrheitsentscheidungen vor (vgl zB Art. 43 Abs. 2 UAbs. 3 aF EGV ). Dies wurde jedoch durch die sog. Luxemburger Vereinbarung vom 29.1.1966 praktisch außer Kraft gesetzt, wonach gegen den Willen eines Mitgliedstaates keine Mehrheitsentscheidungen mehr zu Stande kamen (s. Rn 367 ff). Die Berichte zur Reform des institutionellen Systems der Gemeinschaften (insbes. Bericht der Drei Weisen, 1979) bemühten sich daher, eine Forderung des Europäischen Rates vom Pariser Gipfel 1974 aufgreifend, um eine Verbesserung des Beschlussverfahrens im Rat. Erst seit Mitte der 80er-Jahre kommt es aber auch in gewichtigen Bereichen zunehmend zu Mehrheitsentscheidungen, wofür Art. 11 der Geschäftsordnung des Rates (vgl Rn 374) institutionelle Vorkehrungen trifft. Durch den Vertrag von Nizza und erweitert durch den Vertrag von Lissabon wurden die Mehrheitsentscheidungen auf fast alle Regelungsgegenstände des EGV ausgedehnt; mit Ausnahme von als (zumindest von einzelnen Mitgliedstaaten) besonders sensibel empfundenen Bereichen (vgl Rn 372). Bei Mehrheitsentscheidungen musste, wenn ein Mitgliedstaat diese Nachprüfung forderte, seit 1.1.2005 die qualifizierte Mehrheit der gewichteten Stimmen zusätzlich 62% der Gesamtbevölkerung umfassen (galt gem. Art. 16 Abs. 5 EUV iVm Art. 3 Abs. 3 Protokoll Nr 36 bis 31.10.2014). Seit dem 1.11.2014 (mit Übergangsbestimmungen bis 31.3.2017) müssen generell als „demographisches“ Quorum 65% der Bevölkerung der EU neben 55% der Mitglieder des Rates, gebildet aus mindestens 15 Mitgliedern (Art. 16 Abs. 4 UAbs. 1, Abs. 5 EUV) erreicht werden.
26
Interne Reformen der Kommissionhatte insbesondere der Spierenburg-Bericht (1979) im Auge. Ihre Rolle wurde durch die Einheitliche Europäische Akte vor allem mit der Ausweitung der Übertragung von Durchführungsbefugnissen gestärkt (zur weiteren Stärkung durch den Vertrag von Lissabon s. Rn 571 ff). Den Herausforderungen, die die Erweiterung der Europäischen Union auf bis zu 27 Mitgliedstaaten an die Arbeitsfähigkeit der Kommission stellt, versuchte der Vertrag von Nizza dadurch zu begegnen, dass nach (zum 1.1.2007 erfolgten) Erreichen dieser Mitgliederzahl die Zahl der Kommissionsmitglieder vom Rat einstimmig festgesetzt wird. Sie sollte unter der Zahl der Mitgliedstaaten liegen und die Kommissionsmitglieder sollten auf der Grundlage einer gleichberechtigten Rotation ausgewählt werden. Dies wurde vom Vertrag von Lissabon aufgegriffen (vgl Art. 17 Abs. 4 und 5 EUV: zwei Drittel der Zahl der jetzt (noch) 28 Mitgliedstaaten, also derzeit 19 Kommissare), allerdings wegen Irland anlässlich des erforderlichen zweiten Referendums zum Vertrag von Lissabon gegebene Zusicherungen dahingehend unterlaufen, dass der Europäische Rat gemäß Art. 17 Abs. 5 UAbs. 1 EUV „einstimmig eine Änderung dieser Anzahl beschließt“[16]. Dies ist auch erfolgt[17]. Dies läuft zwar der Intention der Vorschrift zuwider, lässt sich aber – anders als die Bestimmung des Vertrags von Nizza – mit ihrem Wortlaut vereinbaren. Die Rolle des Kommissionspräsidenten wurde weiter gestärkt (s. Rn 395).
b) Europäische Politische Union
27
Neben der erfolgten Ausdehnung des EGKS-Modells auf die Bereiche der EWG und der EAG dachte man sehr bald daran, die Europäischen Gemeinschaften zu einem Verband neuer Rechtsqualität durch eine völlige Neugestaltung der innerhalb und außerhalb der Gemeinschaften bestehenden Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten zu machen. Diesem Projekt wurde der Name „Europäische Union“ oder „Europäische Politische Union“ oder „Politische Union“ gegeben. Die Projekte zielten zum Teil auf generelle, dh auf die gesamten Gemeinschaften bezogene (zB Fouchet-Plan, 1961), oder partielle, dh auf die zu den bestehenden Gemeinschaften hinzutretenden Bereiche beschränkte (zB Davignon-Bericht, 1970)[18], auf intergouvernementale, zum Teil auch supranationale (zB EPG, 1953) Strukturen. 1984 legte das Europäische Parlament einen Entwurf für einen Vertrag zur Gründung der Europäischen Union vor[19].
28
Durchgesetzt haben sich diejenigen Konzeptionen, die eine Ergänzung der Integration im Wege der Gründungsverträge durch eine institutionalisierte Zusammenarbeit in den Bereichen außerhalb dieser Verträge (EPZ, s. Rn 30 ff) und eine Verklammerung beider Bereiche vorsahen[20], mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) vom 28.2.1986 (s. Rn 35 f). Diese gab in Art. 1 Abs. 1 die „Europäische Union“ als Ziel vor.
29
Diese „Europäische Union“ wurde mit dem sog. Unionsvertrag von Maastricht (s. Rn 37 ff), der am 1.11.1993 in Kraft getreten ist, gegründet. Während dadurch im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion tatsächlich eine (allerdings differenzierte) Integration stattfindet, blieben die Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik und innere Sicherheit in der Sache nach wie vor dem Kooperationsmodell verhaftet. Ferner fehlt eine demokratische Repräsentation, die die Gleichheit der Wahl voraussetzen würde (vgl Rn 50, 385).
c) Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ)
30
Seit der Haager Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs vom Dezember 1969 bemühten sich diese um eine Angleichung der Außenpolitik der Mitgliedstaaten in einem politischen Kooperationsverfahren. Zunächst wurde erkannt, dass der wirtschaftliche Integrationsprozess ein Mindestmaß an Übereinstimmung in der Außenpolitik erfordert, da in der gemeinsamen Handelspolitik (Art. 207 AEUV) gegenüber Drittstaaten einheitlich aufgetreten werden muss. Später wurde in immer mehr Bereichen gesehen, dass Fortschritte im Binnenbereich ein gemeinsames Vorgehen nach außen erfordern.
31
Beispiele:
Die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen muss mit einer gemeinsamen Haltung gegenüber Drittstaaten (Ausländerpolitik, Asylpolitik) einhergehen; Embargo-Maßnahmen: Politischer Beschluss, dass ein Embargo verhängt wird, sodann Embargo-Maßnahmen gemäß Art. 207 AEUV; vgl Art. 215 AEUV. S. Rn 1324 f, 1331.
32
Aufbauend auf dem Davignon-Bericht (1970) sollte die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) als zwischenstaatlicher Kooperationsmechanismus durch Information und regelmäßige Konsultation zu einer Angleichung der Außenpolitik der Mitgliedstaaten beitragen. Die Pariser Gipfelkonferenz 1974 übertrug diese Aufgabe dem Europäischen Rat. Die Struktur der EPZ wurde im Londoner Bericht der Außenminister (1981) zusammengefasst.
33
Die EEA ( Rn 35 f) schuf in ihrem Titel III hierfür eine vertragliche Rechtsgrundlage. Danach hatte die EPZ folgende Organe: Präsidentschaft (entsprechend dem Vorsitz im Rat); Politisches Komitee (Beamtenebene, Kontinuität und Vorbereitung der Ministersitzungen); Europäische Korrespondentengruppe (Überwachung der Durchführung der EPZ); Arbeitsgruppen; Sekretariat in Brüssel. Die EEA (vgl Art. 1 Abs. 1 ) verknüpfte die Europäischen Gemeinschaften und die EPZ (daher auch der Name „ Einheitliche Europäische Akte“).
34
Die Unterscheidung in die Grundtypen Integration („Vergemeinschaftung“) und Zusammenarbeit („Intergouvernementalität“) blieb auch im Unionsvertrag von Maastricht und seiner Fortentwicklung in Amsterdam und Nizza prinzipiell erhalten (zum Vertrag von Lissabon s. Rn 61). Dies kam bereits in den Bezeichnungen „gemeinsame Politik“ und „Zusammenarbeit“ (der Mitgliedstaaten) zum Ausdruck. Allerdings wurden die „vergemeinschafteten“ und die „intergouvernemental strukturierten“ Bereiche durch einen einheitlichen institutionellen Rahmen und das materielle Kohärenzgebot (vgl Art. 3 EUV aF ) verbunden und die Handlungsformen der früheren EPZ verrechtlicht (vgl Rn 48; freilich blieb die Frage der Rechtsnatur der EU strittig, vgl Rn 143). Teilbereiche wurden „vergemeinschaftet“.
Читать дальше