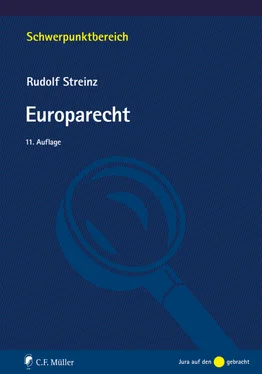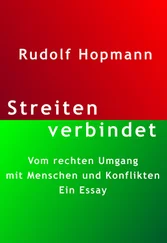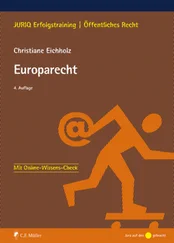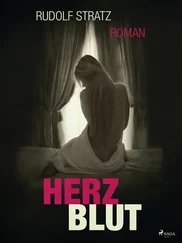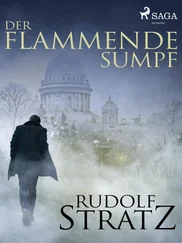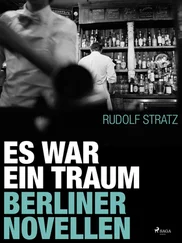1 ...8 9 10 12 13 14 ...52 § 2 Entwicklung und Stand der Europäischen Integration› III. Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Union › 2. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG)
2. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG)
19
Dem Ansatz Schumans folgend wurden nach der Gründung der EGKS ehrgeizige Versuche zu einer weite Gebiete umfassenden Integration unternommen. Am konkretesten fortgeschritten war bereits das Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft(EVG), das in der Bundesrepublik Deutschland zu schweren innenpolitischen Auseinandersetzungen („Kampf um den Wehrbeitrag“) führte und 1954 in der französischen Nationalversammlung scheiterte. Mit dieser EVG eng verknüpft war der Entwurf der Satzung einer Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG), die die Integration von EGKS und EVG sowie weitere Kompetenzen im Wirtschaftsbereich vorsah, die Außenpolitik dagegen noch ausklammerte. Mit dem Scheitern der EVG war auch ihr Schicksal besiegelt.
20
Damit war klar, dass eine politische Integration in Europa nur schrittweise zu erreichen war, und man konzentrierte sich auf die wirtschaftliche Integration, in der Hoffnung, dass diese eine politische Integration nach sich ziehen werde (funktionalistischer Ansatz, „Spill-over-Effekt“). Aus Gründen des Weltwirtschaftsrechts, nämlich der Meistbegünstigungsklausel des GATT, wonach Zollzugeständnisse zwischen einzelnen Mitgliedern des GATT automatisch allen anderen zugutekommen, konnte auf europäischer Ebene eine weitgehende Liberalisierung nur über eine Zollunion erreicht werden, da nach Art. XXIV Abs. 8 des GATT Zollunionen als regionale Präferenzzonen unter Befreiung von der Meistbegünstigungsklausel erlaubt sind, soweit sie grundsätzlich alle Produkte umfassen. Dies und die Mitte der 50er-Jahre aufkommende Bestrebung, die Energieprobleme durch Kernenergie zu lösen, was sowohl aus ökonomischen als auch aus sicherheitspolitischen Gründen nur auf europäischer Ebene verantwortbar erschien, führte 1955 zur Konferenz von Messina, die einen Ausschuss einsetzte, der Pläne für einen Gemeinsamen Markt und für eine Atomgemeinschaft ausarbeiten sollte (Leitung: P.H. Spaak ). Auf deren Grundlage wurden die Vertragstexte von EWG und EAG ausgearbeitet und am 25.3.1957 in Rom unterzeichnet. Die Römischen Verträgesind am 1.1.1958 in Kraft getreten.
§ 2 Entwicklung und Stand der Europäischen Integration› III. Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Union › 3. Überblick über die Reformen der Europäischen Gemeinschaften – Die Europäische Union
3. Überblick über die Reformen der Europäischen Gemeinschaften – Die Europäische Union
21
Die Europäischen Gemeinschaften waren von Anfang an Gegenstand weitreichender Reformpläne, die zum Teil von außen herangetragen, größtenteils aber im Auftrag der Gemeinschaftsorgane selbst entwickelt wurden. Sie reichen von grundlegenden Strukturänderungen über Reformen des bestehenden institutionellen Systems bis hin zu bloßen Verbesserungen der Arbeitsweise der Institutionen. Daneben wurden Kompetenzausweitungen bzw -klarstellungen initiiert. Die Pläne konnten teilweise und nur zögerlich realisiert werden, wobei bei manchen Initiativen zu beobachten ist, dass sie zwar auf andere Weise, letztlich aber doch zumindest mit partiellem Erfolg verwirklicht wurden.
a) Reform des institutionellen Systems der Gemeinschaften
22
Die EGKS war, wie es auch in dem durch den Fusionsvertrag (FusV, s. Rn 270) gestrichenen Art. 9 aF EGKSV expressis verbis zum Ausdruck kam, supranational dahingehend, dass die Hohe Behörde (= gem. Art. 9 Abs. 1 S. 2 FusV aF , später Art. 7 EGKSV: Kommission) das Hauptrechtsetzungsorgan war. EAG und EG waren dagegen anders, nämlich insoweit ähnlich wie internationale Organisationen im Allgemeinen, strukturiert. Hauptrechtssetzungsorgan war (und ist neben dem Europäischen Parlament bis heute) der Rat (s. Rn 349), der sich aus Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten zusammensetzt, während der Kommission neben Durchführungsbefugnissen die Aufgabe der Initiative, dh des Ingangsetzens der Integration, und der Kontrolle, dh des Inganghaltens der Integration, zukommt (s. Rn 398). Das Europäische Parlament, das in den Gründungsverträgen „Die Versammlung“ hieß und erst seit der Einheitlichen Europäischen Akte auf vertraglicher Grundlage so heißt (vgl Art. 3 EEA ), soll eine demokratische Repräsentation der Völker der Mitgliedstaaten auf Gemeinschaftsebene (vgl Art. 189 EGV ) bzw jetzt der „Unionsbürgerinnen und Unionsbürger“ auf Unionsebene (Art. 14 Abs. 2 EUV) gewährleisten. Zum Ausgleich für eine derartige sog. „Exekutivmacht“ ohne (zumindest damals) hinreichende demokratische Kontrolle auf Gemeinschaftsebene bzw jetzt Unionsebene wurde die Einrichtung eines Gerichtshofs für unerlässlich gehalten, dem die weite Befugnis übertragen wurde, über die Wahrung des Rechts bei der Ausführung des Gemeinschaftsrechts bzw jetzt des Unionsrechts zu wachen (vgl Art. 220 EGV ; Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 EUV).
23
Die Pläne zu institutionellen Reformen der Gemeinschaften verfolgten von Anfang an vor allem folgende Ziele:
| 1. |
Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments (Mitgesetzgeber; „Investitur“ der Kommission); |
| 2. |
Verbesserung des Entscheidungsverfahrens im Rat (Mehrheitsabstimmung); |
| 3. |
Steigerung der Effizienz der Arbeitsweise der Kommission (Komitologie). |
24
Die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments(EP) wurde vor allem von diesem selbst gefordert. Grundlegend war die Entschließung vom 27.6.1963[11], in der es ein Mitentscheidungsrecht bei der Gesetzgebung und bei der Ernennung der Kommission, ein Recht zur „Ratifizierung“ internationaler Abkommen sowie verstärkte Haushaltsbefugnisse verlangte. Die Reformberichte unterstützten dies teilweise: Der Vedel-Bericht (1972)[12] forderte eine parlamentarische Mitentscheidung dahingehend, dass Entscheidungen des Rates nicht ohne Zustimmung des Parlaments in Kraft treten können. Der Marjolin-Bericht zur Wirtschafts- und Währungsunion (1975)[13] forderte ein unmittelbar gewähltes Parlament mit echten gesetzgeberischen Befugnissen. Seit 1972 gehört die Bekräftigung, die Kontrollrechte des Parlaments zu verstärken, zum ständigen Repertoire von Erklärungen des Rates zu institutionellen Fragen. Tragweite und Ernsthaftigkeit solcher Forderungen lassen sich an den tatsächlich ergriffenen Maßnahmen, zu denen die Initiative von den Regierungen ausgehen muss, ablesen. Bis hin zum Maastrichter Unionsvertrag (s. Rn 42) zeigt sich hier eine Diskrepanz. Gleichwohl wurde die Rechtsstellung des EP erheblich ausgebaut. Hervorzuheben sind insbesondere die 1975 eingeführte Beteiligung am Haushaltsverfahren, die Übung, das Parlament auch in nicht zwingend vorgeschriebenen Fällen zu hören (fakultative Anhörung), das Fragerecht gegenüber Rat und Kommission, die durch den Vertrag von Maastricht eingeführte und seither verstärkte, zudem vom EP extensiv genutzte Beteiligung an der Besetzung der Kommission (s. dazu Rn 394), die Beteiligung an bestimmten völkerrechtlichen Verträgen der Gemeinschaften bzw Union sowie schließlich die Beteiligung an der Gesetzgebung durch das Verfahren der Zusammenarbeit, das die Einheitliche Europäische Akte eingeführt hat, und das durch den Unionsvertrag eingeführte Verfahren der Mitentscheidung, das im Amsterdamer Vertrag noch verstärkt wurde und durch den Vertrag von Lissabon zum „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ (Art. 289 Abs. 1, Art. 294 AEUV) und damit zum Regelverfahren erklärt wurde. Seit 1979 wird das EP direkt gewählt, wobei jedoch bis jetzt trotz gewissen Vereinheitlichungen (insbesondere Verhältniswahlrecht)[14] kein einheitliches Wahlverfahren zustande gekommen ist, obwohl das EP dafür das (einzige) Initiativrecht hat (vgl Art. 223 Abs. 1 AEUV). Eine noch weiter gehende Übertragung echter Legislativbefugnisse auf das EP kann allerdings nicht ohne weiteres bejaht werden (s. Rn 385). Der Beitritt von 13 neuen Mitgliedstaaten zum 1.5.2004 bzw 1.1.2007 und 1.7.2013 erschwert den Erhalt (bzw überhaupt erst die Herstellung) annähernd angemessener (dh proportionaler) Repräsentation zusätzlich. Der Vertrag von Lissabon legt als Höchstzahl 750 Abgeordnete zuzüglich des Präsidenten[15] fest und bekennt sich jetzt ausdrücklich zum Prinzip der degressiven Proportionalität (Art. 14 Abs. 2 S. 2 und 3 EUV), das durch die Einführung eines demographischen Faktors bei der Beschlussfassung im Rat austariert werden soll (s. Rn 362).
Читать дальше