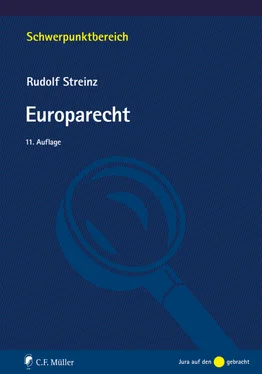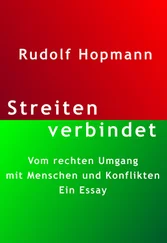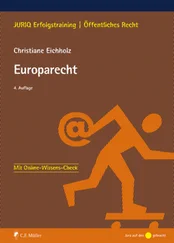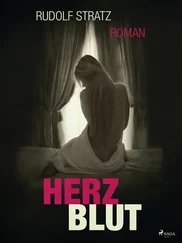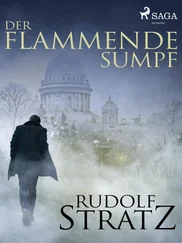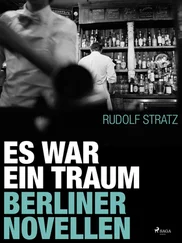42
Eine wesentliche Aufwertung erfuhr das Europäische Parlament. Die bisherigen Rechtsetzungsverfahren der Anhörung und der Zusammenarbeit wurden inhaltlich übernommen ( Art. 252 EGV ) und durch ein neues Verfahren der Mitentscheidung ( Art. 251 EGV ; jetzt Art. 294 AEUV) ergänzt (s. Rn 558 ff). Dieses Verfahren machte in seinem Anwendungsbereich das Europäische Parlament tatsächlich zum Mitgesetzgeber. Außerdem erhielt das Parlament das Recht, die Kommission zu Initiativen aufzufordern (s. Rn 336). Ferner brachte der Unionsvertrag ein Petitionsverfahren und einen Bürgerbeauftragten des Europäischen Parlaments. Zudem gelang durch eine neue Sitzverteilung eine Reduktion des durch die deutsche Wiedervereinigung weiter erhöhten Ungleichgewichts in der Vertretung, die auch die Interessen der anderen großen Mitgliedstaaten berücksichtigte.
43
Als neues Nebenorgan führte der Unionsvertrag einen Ausschuss der Regionen ein ( Art. 263 ff EGV , jetzt Art. 305 AEUV, s. Rn 184).
44
Als redaktionelle Änderungwurden durch den Maastrichter Vertrag Teile des FusVwieder in den EWGV übernommen. Dieser wurde zudem in Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV)umbenannt, um klarzustellen, dass sich die Gemeinschaft von einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft in Richtung auf eine Politische Union hin entwickelt hat.
45
Materiell-rechtlichwies der Maastrichter Vertrag der neu benannten Europäischen Gemeinschaftneue Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu, in denen die EWG vor 1993 zwar schon umfassend tätig war, allerdings mit zweifelhaften Kompetenzgrundlagen (meist Art. 235 EWGV , jetzt Art. 352 AEUV). Darüber hinaus wurden die Titel über die Kompetenzen, in denen die Gemeinschaft nur unterstützend tätig wird, neu gefasst und die Kompetenzen hierdurch teils begrenzt, teils erweitert[28]. Eingefügt wurde zudem ein Titel über die Entwicklungszusammenarbeit mit Drittstaaten, dh Entwicklungsländern ( Art. 177–181 EGV ; jetzt Art. 208–211 AEUV)[29]. Die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete gemäß Art. 182 ff EGV blieb davon unberührt (vgl Art. 179 Abs. 3 EGV )[30].
46
Kernstück des Vertrags von Maastricht war die Schaffung der Wirtschafts- und Währungsuniondurch eine eng koordinierte Wirtschaftspolitik, haushaltswirtschaftliche Vorschriften, die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse im Hinblick auf die Einführung des Euro als einheitlicher Währung, die Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die vorrangig am Ziel der Preisstabilität orientiert ist, und die Schaffung eines Europäischen Systems der Zentralbanken und einer Europäischen Zentralbank (s. Rn 1181 ff).
47
In Art. 17 EGV (jetzt Art. 20 AEUV) führte der Maastrichter Vertrag die Unionsbürgerschaftein, durch die den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten zusätzliche, nicht vom Gebrauch der Grundfreiheiten des EGV (jetzt AEUV) abhängige Rechte gegenüber den anderen Mitgliedstaaten eingeräumt werden (s. Rn 1023 ff).
48
Außerhalb der Europäischen Gemeinschaft schaffte der Maastrichter Vertrag durch die Titel V und VI des EUV die Grundlagen für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP, Art. 11–28 EUV aF – hierbei handelte es sich um eine weitgehende Übernahme der vormaligen EPZ; jetzt Art. 23–46 EUV) sowie die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI, nach dem Vertrag von Amsterdam PJZS, Art. 29–42 EUV aF ; jetzt integriert in den RFSR, Art. 82–89 AEUV, s. Rn 1055 f). Grundsätzlich herrschten hier Koordination, Kooperation und Konsultation vor. In bestimmten Fällen waren jedoch auch rechtlich verbindliche Maßnahmen des Rates vorgesehen (vgl Art. 34 Abs. 2 EUV aF ). Diese waren dem vom Gemeinschaftsrecht getrennten Unionssekundärrecht zuzurechnen.
b) Der Vertrag von Amsterdam
49
Die in Art. N Abs. 2 EUV/Maastricht vorgesehene Regierungskonferenz zur Überprüfung der Bestimmungen des EUV, für die eine Revision vorgesehen wurde („Maastricht II“), begann im März 1996 in Turin und wurde mit dem Amsterdamer Vertragvom 2.10.1997[31] abgeschlossen. Er trat am 1.5.1999 in Kraft.
50
Durch den Amsterdamer Vertrag wurde das Verfahren der Mitentscheidung erheblich ausgeweitet und im Sinne einer im Wesentlichen gleichwertigen Beteiligung von Rat und Europäischem Parlament reformiert. Das Problem der Ungleichheit der Wahl wurde zwar erkannt ( Art. 190 Abs. 2 UAbs. 2 EGV ) , aber nicht gelöst, sondern durch die „Begrenzung“ der Anzahl der Abgeordneten sogar verschärft (vgl Rn 309). Die Rechte des Europäischen Parlaments wurden sachgerecht verbessert. Eine wirkliche Reform der Institutionen, die vor allem im Hinblick auf die damals bevorstehenden Erweiterungen der EU für erforderlich gehalten wurde, gelang freilich nicht. Es ist bemerkenswert, dass einige Mitgliedstaaten dieses Defizit ausdrücklich zu Protokoll gaben[32]. Auch im Hinblick auf die mit einer erheblichen Ausweitung der Mitgliedstaaten einhergehenden Integrationsprobleme schuf der Amsterdamer Vertrag in einem neuen Titel VII (Art. 43–45 EUV aF) und in Art. 11 EGV die Möglichkeit für eine engere Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten (jetzt Art. 20 EUV, Art. 326–334 AEUV). Damit wurde das Konzept eines Europas mehrerer Geschwindigkeiten, das bereits bisher zB in der Sozialpolitik (vgl Rn 1192 ff) und der Währungsunion (vgl Rn 1173 ff) verankert war, allgemein institutionalisiert, allerdings in einer schwer praktikablen und – auch nach der Reform durch den Vertrag von Nizza (s. Rn 54) – bislang noch wenig praktizierten Form[33]. S. zur Verstärkten Zusammenarbeit (VZ) Rn 583 ff.
51
Der Amsterdamer Vertrag schuf als neue Institution einen „Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“, der personell mit dem Generalsekretär des Rates identisch war und den Rat in Angelegenheiten der GASP unterstützte ( Art. 26 EUV aF ; jetzt mit geänderter Funktion in Art. 27 EUV, s. Rn 306). Zu den erheblichen redaktionellen und technischen Änderungen[34] gehörte die vollständige Umnummerierung der Verträge.
52
Materiell-inhaltlichwar vor allem die „Vergemeinschaftung“ eines wesentlichen Teils des Bereichs Justiz und Inneres, nämlich Visa, Asyl, Einwanderung und anderer Politiken betreffend den freien Personenverkehr, durch Übertragung in die „Erste Säule“ (Titel IV, Art. 61–69 EGV ; jetzt Art. 67, Art. 77–79 AEUV) bedeutsam. In der „Dritten Säule“ verblieb die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS, Titel VI EUV aF). Diese wurde im Rahmen des Ziels, den Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten ( Art. 29 Abs. 1 EUV aF ; jetzt Art. 67 AEUV), ausgebaut (s. dazu Rn 1046 ff).
53
Der Vertrag von Nizzawurde durch die Regierungskonferenz 2000 ausgehandelt, auf dem Gipfel von Nizza vom 7.–11.12.2000 politisch vereinbart und am 26.2.2001 unterzeichnet[35]. Der Ratifikationsprozess erwies sich einmal mehr als schwierig. Die Iren hatten dem Vertrag in einem ersten Referendum ihre Zustimmung überraschend versagt. Nach einem zweiten, positiven Referendum konnte der Vertrag am 1.2.2003 in Kraft treten[36]. Das Verhandlungsmandat für die Regierungskonferenz beruhte zum einen auf dem „Protokoll (Nr 7) über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union“ zum Amsterdamer Vertrag, zum anderen auf den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates bei seinen Treffen in Köln und Helsinki 1999. Daraus ergab sich als Kernziel der Regierungskonferenz die Herstellung der Erweiterungsfähigkeit der Europäischen Union durch eine Lösung der institutionellen Probleme (Mehrheitsentscheidung im Rat, Arbeitsfähigkeit von Kommission und Parlament durch Begrenzung der Mitgliederzahl), die nur teilweise gelang. Einige Bestimmungen wurden erst auf der Grundlage des Protokolls über die Erweiterung der EU[37] mit deren Realisierung 2004 bzw 2007 wirksam.
Читать дальше