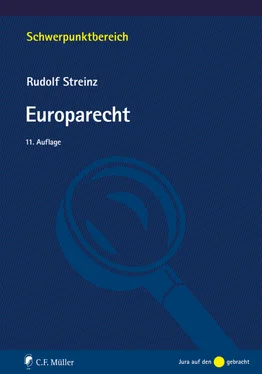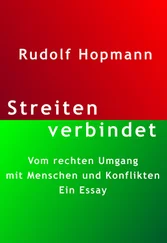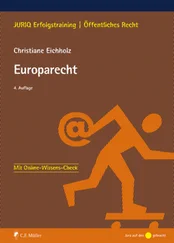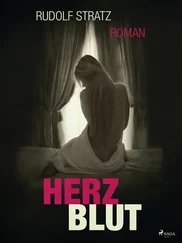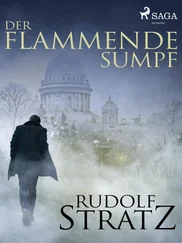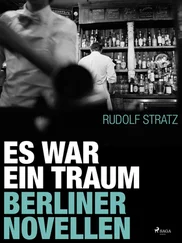62
Die Regelungen des Verfassungsvertrags zu den Institutionenwerden weitgehend beibehalten. Hinsichtlich der (allerdings allein wegen der Haltung Polens) am heftigsten umstrittenen Frage der Mehrheitsabstimmungen im Rat trat die doppelt qualifizierte Mehrheiterst ab 1.11.2014 in Kraft, mit einer besonderen Übergangsregelung bis zum 31.3.2017 und ergänzt durch die Übernahme des Beschlusses von Ioannina zu Sperrminoritäten (vgl Art. 16 Abs. 4 und 5 EUV; Art. 238 AEUV). Die Bestimmungen über die Kompetenzverteilungzwischen der Union und den Mitgliedstaaten werden inhaltlich übernommen (Art. 5 EUV; Art. 2–6 AEUV). Besonders betont wird die fortbestehende Souveränität und Staatlichkeit der Mitgliedstaaten und die Tatsache, dass die Union auf den Mitgliedstaaten beruht und ihre Kompetenzen von diesen nach wie vor herleitet. Dies war einschließlich des an traditionelle völkerrechtliche Formulierungen angelehnten Art. 4 Abs. 2 EUV allerdings teilweise bereits im Verfassungsvertrag enthalten. Anders als dort, wo die „Verfassung“ die Europäische Union begründet, „geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten“ (Art. I-1 Abs. 1 EVV) , gründen gemäß Art. 1 Abs. 1 EUV „die Hohen Vertragsparteien“ untereinander eine Europäische Union. Art. 48 Abs. 2 S. 2 EUV sieht bei Vertragsänderungen auch eine Verringerung der der Union übertragenen Zuständigkeiten vor. Übernommen wurde auch das ausdrückliche Recht der Mitgliedstaaten, aus der Europäischen Union auszutreten(Art. 50 EUV). Damit sollte wohl dokumentiert werden, dass die EU keine „Zwangsgemeinschaft“ ist, wobei man die Realisierung eines Austritts für unwahrscheinlich hielt. Zum „Brexit“ s. Rn 70und Rn 109.
63
Die materiellen Änderungengegenüber den bestehenden Verträgen, die von der Regierungskonferenz 2004 (s. Rn 57) beschlossen wurden und damit tatsächlich die Substanz des Verfassungsvertrags darstellen, werden grundsätzlich übernommen, und zwar in den geänderten, aber nach wie vor so genannten EU-Vertrag (EUV)und in den geänderten und in Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)umbenannten EG-Vertrag. Beide Verträge haben ausdrücklich den gleichen rechtlichen Stellenwert (Art. 1 Abs. 3 S. 2 EUV). Dadurch wird deutlich gemacht, dass der „Arbeitsvertrag“ nicht von sekundärer Qualität ist und klargestellt, dass allen Bestrebungen zwischen einem Grundvertrag und einem Arbeitsvertrag, der eventuell einem vereinfachten Vertragsänderungsverfahren unterworfen werden kann, zu unterscheiden, eine Absage erteilt wird. Das (schöne) Wort „Gemeinschaft“ wird durchgehend durch das Wort „Union“ ersetzt, da die einheitliche Union die Europäische Gemeinschaft ersetzt und ihre Rechtsnachfolgerin ist (Art. 1 Abs. 3 S. 2 EUV). Die Drei-Säulen-Struktur wird wie im Verfassungsvertrag aufgehoben. Allerdings kommt die Sonderstellung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik durch deren Regelung auch im neuen Unionsvertrag (Art. 21–46 EUV) und nicht – wie die Materien der jetzigen Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (Art. 82–89 AEUV) – im Vertrag über die Arbeitsweise der EU deutlich zum Ausdruck. Diese Sonderstellung wird in Art. 24 Abs. 1 UAbs. 2 EUV näher ausgeführt und durch eine Erklärung, die ausdrücklich die fortbestehenden Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten festhält, insbesondere auch die Mitgliedschaft eines Mitgliedstaates der EU (dies betrifft Frankreich und das Vereinigte Königreich) im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, unterstrichen[52]. Zumindest symbolisch kommen die Vorbehalte der Mitgliedstaaten in diesem Bereich dadurch zum Ausdruck, dass der „Außenminister der Union“ nicht so, sondern „Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik“ genannt wird, der allerdings auch die Aufgaben des bisherigen Kommissars für die Außenbeziehungen der EG übernimmt (Art. 27, Art. 15 Abs. 2 und 3 EUV). Die Union erhält – wie im Verfassungsvertrag (Art. I-7 EVV) – Rechtspersönlichkeit (Art. 47 EUV)[53], was angesichts der bisherigen ausdrücklichen Rechtspersönlichkeit der EG ( Art. 281 EGV ) und der Vereinheitlichung zur Union konsequent ist.
64
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Unionwird zwar nicht in die Verträge aufgenommen, aber durch Art. 6 Abs. 1 EUV diesen rechtlich gleichgestellt. Ein besonderes Protokollregelt, dass die Charta für das Vereinigte Königreich und Polen im Rahmen von dessen Maßgabe nicht verbindlich ist. Die Ratifikation eines entsprechenden Protokolls wurde der Tschechischen Republik zugesichert, worauf diese aber später verzichtet hat (s. Rn 760).
65
Der Vertrag von Lissabon führt gegenüber dem Verfassungsvertrag auch neue Elementeein, die durch jüngste Entwicklungen in der Umweltpolitik und der Energiepolitik motiviert sind (Art. 191 Abs. 1, Art. 194 Abs. 1 AEUV).
66
Auf Drängen des französischen Staatspräsidenten Sarkozy wurde der „freie und ungestörte Wettbewerb“ (Art. I-3 Abs. 2 EVV) , der als „redlicher“ bzw „unverfälschter Wettbewerb“ seit Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 zu deren Zielen gehört (vgl Erwägungsgrund 4 der Präambel, Art. 3 lit. f. EWGV ), gestrichen. Zu einer Änderung der Wettbewerbspolitik führte dies nicht, zumal sich die Rechtslage wegen des Protokolls Nr. 27 nicht ändert (s. Rn 1063). Zwar ist Wettbewerb sicher nicht alles und vor allem kein Endziel. Protektionismus für die nationale Wirtschaft steht allerdings einem Binnenmarkt ohne Binnengrenzen diametral entgegen.
67
Der Vertrag von Lissabon bedurfte der Ratifikationdurch alle (damals) 27 Mitgliedstaaten, die bis zur Europawahl 2009 geplant war. Während die Regierungen der anderen Mitgliedstaaten Referenden – zum Teil mit fragwürdigen Begründungen – vermieden, war das Referendum in Irland obligatorisch und führte prompt zur Ablehnung des Vertrages am 12.6.2008 mit 53,4% zu 46,6% der Stimmen. Um ein zweites Referendum zu ermöglichen, machte der Europäische Rat am 18./19.6.2009 Irland Zugeständnisse hinsichtlich der Wahrung bestimmter Rechte der irischen Verfassung (Schutz des Rechts auf Leben, Schutz der Familie, Schutz der Rechte auf Bildung) gegenüber der Grundrechtecharta und dem Vertrag von Lissabon, der irischen Neutralität, der Sozialpolitik sowie der Beibehaltung eines Kommissars pro Mitgliedstaat (s. Rn 392). Dies sollte rechtsverbindlich mit primärrechtlicher Qualität in einem Protokoll verankert werden, das zusammen mit dem nächsten Beitrittsvertrag ratifiziert werden sollte[54]. Sicher im Hinblick auf diese Zugeständnisse, aber auch unter dem Eindruck der Wirtschafts- und Finanzkrise, stimmten am 2.10.2009 67,1% gegen 32,9% bei immerhin 58% Beteiligung für den Vertrag, den Irland daraufhin ratifizierte. Danach ratifizierten auch Polen und – nach dem Zugeständnis eines Protokolls hinsichtlich der Grundrechtecharta (s. Rn 760) – als letzter Staat auch die Tschechische Republik, sodass der Vertrag am 1.12.2009 in Kraft treten konnte.
68
In Deutschland hatten der Bundestag mit großer Mehrheit, weit über den geforderten zwei Dritteln seiner Mitglieder (Art. 23 Abs. 1 S. 3 iVm Art. 79 Abs. 2 GG), und der Bundesrat ohne Gegenstimme dem Vertrag zugestimmt. Die Ratifikation wurde jedoch durch Organklagen und Verfassungsbeschwerden aufgehalten. Am 30.6.2009 entschied das BVerfG nach eingehender Darlegung des Vertrags und des verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstabs, dass der Vertrag von Lissabon und das Zustimmungsgesetz dazu „nach Maßgabe der Gründe“ den aufgezeigten verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen und „keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken“ bestehen[55]. Das BVerfG betonte einerseits die „Europarechtsfreundlichkeit“ des Grundgesetzes, bestätigte und präzisierte aber andererseits ausdrücklich seine Kontrollkompetenz (Identitätskontrolle einschließlich Grundrechtskontrolle, Ultra-vires-Kontrolle) und postulierte, dass ein „Identitätswechsel zu einem „europäischen Bundesstaat“ eine Entscheidung des Verfassungsgesetzgebers (Art. 146 GG) erfordere (s. Rn 141). Da das BVerfG aber das deutsche Begleitgesetz zum Vertrag von Lissabon wegen unzureichender Sicherung der „Integrationsverantwortung“ des Bundestages für verfassungswidrig erklärte und dessen Nachbesserung vor der Ratifikation des Vertrages verlangte, konnte der Bundespräsident den Vertrag erst nach der – rasch erfolgten – Verabschiedung des Gesetzes über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der EU[56], das neben dem neuen Integrationsgesetz (IntVG) Änderungen des EUZBBG und des EUZBLG enthält (s. Rn 386, 388), den Vertrag ratifizieren.
Читать дальше